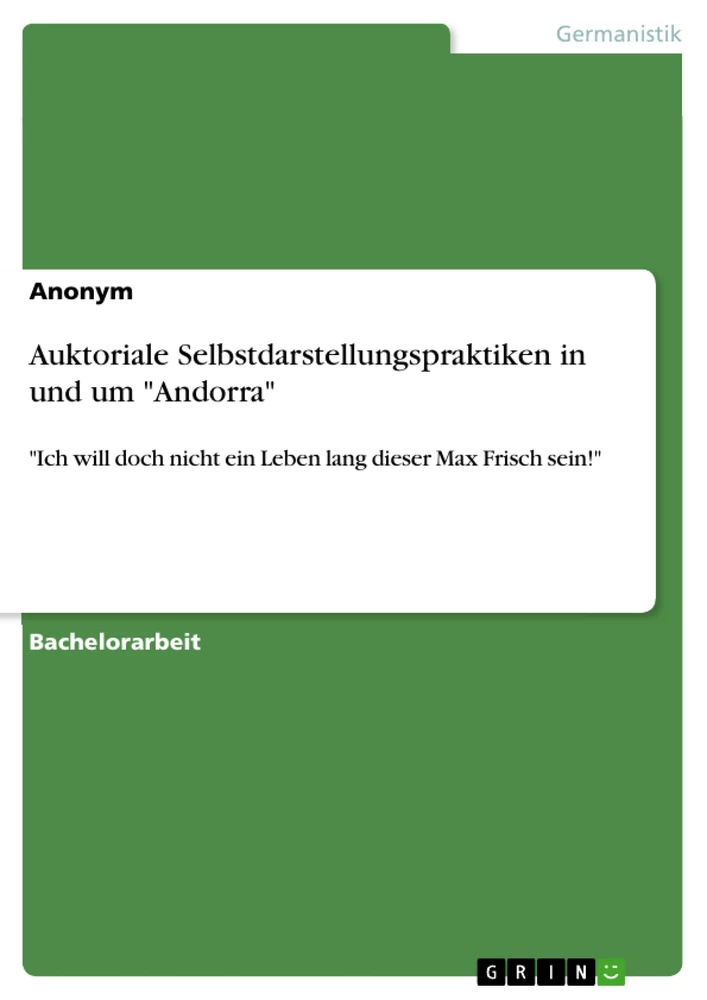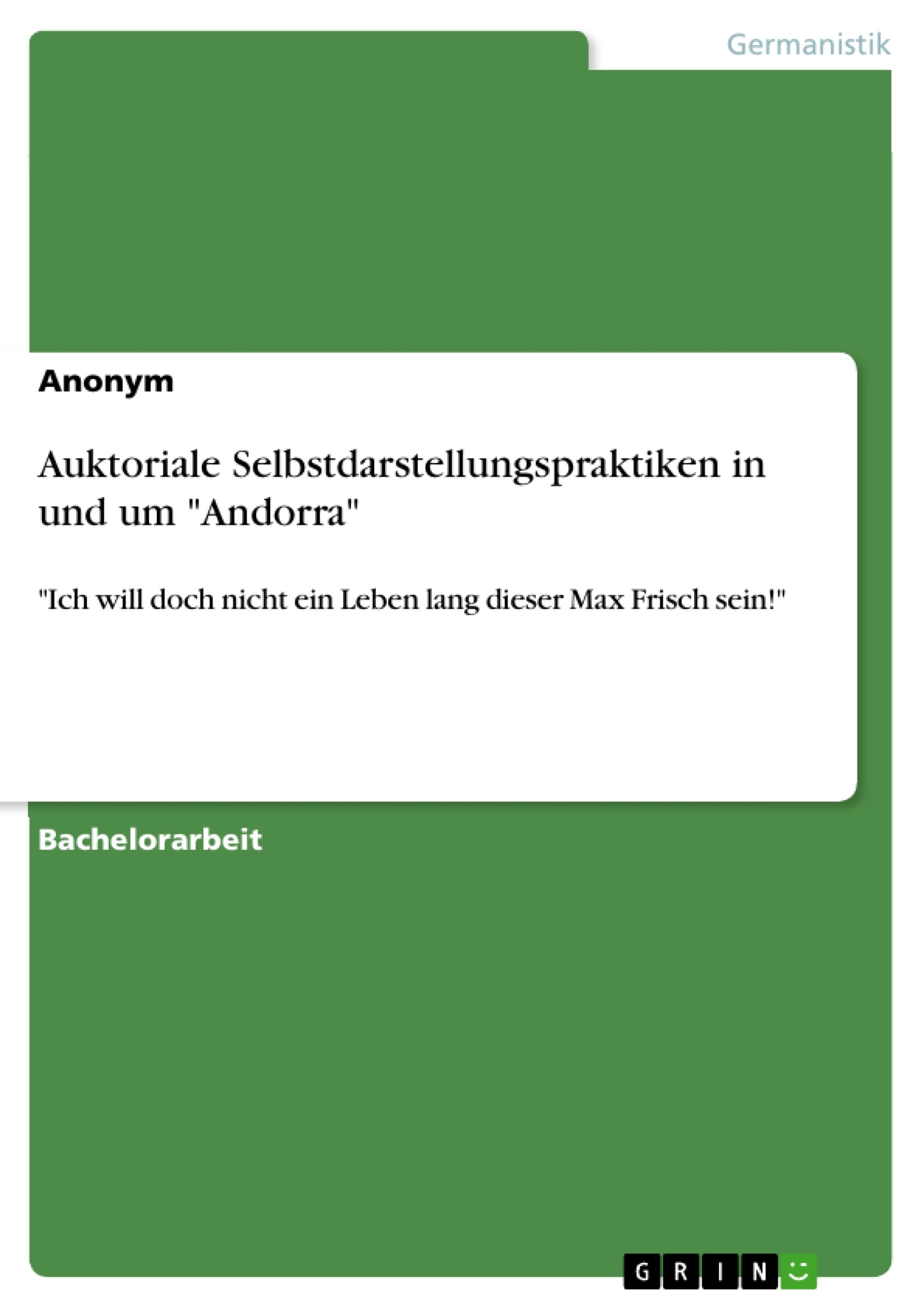Die folgende Arbeit stellt dar, mit welchen Praktiken auktorialer Selbstdarstellung Frisch sich als Autor in der Öffentlichkeit präsentierte. Ob intentional oder nicht - wie trugen seine Literatur, hier das Drama Andorra, und seine öffentlichen Auftritte um die Publikation dessen zu den Bildnissen bei, die sich die Öffentlichkeit von ihm machte? In diesem Zusammenhang findet eine Bemerkung des Frisch-Biographen Volker Hage Beachtung, der bei ihm "keine strikte Trennung zwischen Werk und öffentlichem Auftritt" feststellt. Die Schweizer Literaturkritikerin Bea von Matt unterstützt diese These; die Stellungnahmen des Autors kämen aus demselben "schöpferische[n] Zentrum, aus dem auch die Figuren seiner Erfindung entstehen."
Die Selbstinszenierung von Schriftstellern ist kein neuartiges Phänomen, "sie ist so alt wie der Berufsstand selbst."
Es verwundert deshalb nicht, dass es, intensiviert seit der Jahrtausendwende, reichlich Forschungsliteratur zum Thema gibt - wobei Publikationen zur Problematik bei Frisch bisher ausgeblieben sind. (Lediglich in vereinzelten Randbemerkungen wurden Charakteristika seiner öffentlichen Auftritte aufgeführt.) Die für diese Ausarbeitung infrage kommenden Forschungsdesigns werden im folgenden Punkt dargestellt, wobei die Wahl auf die heuristische Typologie der Inszenierungspraktiken nach Christoph Jürgensen und Gerhard Kaiser fällt. Diese definieren Selbstdarstellungspraktiken als "jene textuellen, paratextuellen und habituellen Techniken und Aktivitäten von SchriftstellerInnen, in oder mit denen sie öffentlichkeitsbezogen für ihre eigene Person, für ihre Tätigkeit und/oder für ihre Produkte Aufmerksamkeit erzeugen." Für die Literaturwissenschaft sind diese deshalb interessant, weil sie als Bestandteile der "biographischen Legende" über den Autor den "wahrnehmbare[n] Hintergrund des literarischen Werks" bilden.
Diese Legende um die "Autorfigur"unterscheidet sich damit von der Biographie der empirischen "Autorperson", die in dieser Arbeit weitestgehend vernachlässigt wird. Für den Autor hingegen sind Selbstdarstellungspraktiken unerlässlich, um sich auf dem literarischen Feld zu behaupten. Um diese Aussage zu begründen, schließt sich an die Darstellung des Forschungsstandes eine knappe Ausführung zur Literatursoziologie Pierre Bourdieus an. Im Laufe der Arbeit werden Elemente der Paratexttheorie von Genette die theoretischen Grundlagen Bourdieus und Jürgensen und Kaisers ergänzen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Theoretische Grundlagen
- Das literarische Feld und seine Bedingungen nach Bourdieu
- Heuristische Typologie der Inszenierungspraktiken nach Jürgensen und Kaiser
- Auktoriale Selbstdarstellungspraktiken in und um die Publikation von Andorra
- Textuelle Selbstdarstellungspraktiken
- Die Bildnisproblematik und das Leben in Geschichten
- Max Frisch als politischer Schriftsteller und Intellektueller
- Das „Gewissen der Schweiz“
- Epitextuelle Selbstdarstellungspraktiken
- Der private Epitext - Briefe
- Brief an den Verlag
- Brief an Regisseur Kortner
- Der öffentliche Epitext - Vermittlungen
- Werkstattgespräch mit Horst Bienek
- ZEIT-Feuilletonartikel von Curt Riess
- SWR TV-Portrait: „Autoren erzählen“
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit analysiert die Praktiken auktorialer Selbstdarstellung, die Max Frisch als Autor in der Öffentlichkeit einsetzte. Insbesondere wird untersucht, wie seine Literatur, speziell das Drama Andorra, und seine öffentlichen Auftritte um die Publikation des Stückes zu den Bildnissen beitrugen, die die Öffentlichkeit von ihm hatte. Die Arbeit beleuchtet, wie Frisch mit seiner Rolle in der Öffentlichkeit haderte und sich gleichzeitig dieser bedienen musste, um als Autor erfolgreich zu sein.
- Die Rolle von auktorialer Selbstdarstellung im literarischen Feld
- Die Darstellung von Max Frisch als „Autor der Identitätsproblematik“
- Die Verbindung von Werk und öffentlichem Auftritt bei Max Frisch
- Die Nutzung von textuellen und epitextuellen Praktiken zur Selbstdarstellung
- Der Einfluss von öffentlicher Wahrnehmung auf die Bildnisbildung eines Autors
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt den Ausgangspunkt der Arbeit dar und erläutert die Problematik der auktorialen Selbstdarstellung am Beispiel Max Frischs. Sie führt die zentrale Frage ein, wie Frisch sich als Autor in der Öffentlichkeit positionierte und welche Praktiken er dabei einsetzte.
Das Kapitel "Theoretische Grundlagen" behandelt die für die Analyse relevanten Ansätze von Pierre Bourdieu, Christoph Jürgensen und Gerhard Kaiser. Bourdieus Soziologie des literarischen Feldes liefert den Rahmen für die Betrachtung der Praktiken der Selbstdarstellung. Jürgensen und Kaiser entwickeln eine heuristische Typologie der Inszenierungspraktiken, die die textuellen, paratextuellen und habituellen Techniken von Schriftstellern umfasst.
Das Kapitel "Auktoriale Selbstdarstellungspraktiken in und um die Publikation von Andorra" analysiert, wie Frisch sich in Bezug auf sein Stück Andorra, insbesondere durch die Publikation, in der Öffentlichkeit präsentierte. Es werden textuelle Selbstdarstellungspraktiken, wie die Inszenierung von Frischs Bildnis in seinen Werken, sowie epitextuelle Selbstdarstellungspraktiken, z.B. in Briefen und Interviews, untersucht.
Schlüsselwörter
Die Arbeit behandelt Themen wie auktoriale Selbstdarstellung, literarisches Feld, Inszenierungspraktiken, Textualität, Epitext, Max Frisch, Andorra, Identität, Öffentlichkeit, Bildnisbildung, politischer Schriftsteller, Intellektueller, Schweizer Literatur. Die Arbeit verknüpft soziologische Ansätze von Bourdieu, Jürgensen und Kaiser mit der Analyse von Texten und Sekundärliteratur, um Frischs Selbstinszenierung zu analysieren.
Häufig gestellte Fragen zu Max Frisch und „Andorra“
Wie inszenierte sich Max Frisch in der Öffentlichkeit?
Frisch nutzte textuelle und paratextuelle Praktiken, um sein Bild als politischer Schriftsteller und Intellektueller zu formen, wobei Werk und öffentlicher Auftritt oft verschmolzen.
Was ist die „Bildnisproblematik“ bei Frisch?
Es ist das zentrale Thema, dass sich Menschen (und die Öffentlichkeit) starre Bilder von anderen machen, was Frisch in seinem Drama „Andorra“ meisterhaft thematisiert.
Was sind epitextuelle Selbstdarstellungspraktiken?
Dazu gehören Äußerungen außerhalb des eigentlichen Werks, wie Briefe an Verlage, Werkstattgespräche, Interviews oder TV-Porträts, die das Autorenimage prägen.
Gilt Max Frisch als das „Gewissen der Schweiz“?
Durch seine kritischen Auseinandersetzungen mit der Schweizer Identität und Politik wurde ihm dieses Bild von der Öffentlichkeit oft zugeschrieben, mit dem er selbst teils haderte.
Welche Rolle spielt die Literatursoziologie von Pierre Bourdieu hier?
Bourdieus Theorie des „literarischen Feldes“ erklärt, warum Autoren Selbstdarstellungspraktiken benötigen, um sich im Wettbewerb um Aufmerksamkeit und Anerkennung zu behaupten.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2020, Auktoriale Selbstdarstellungspraktiken in und um "Andorra", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/921090