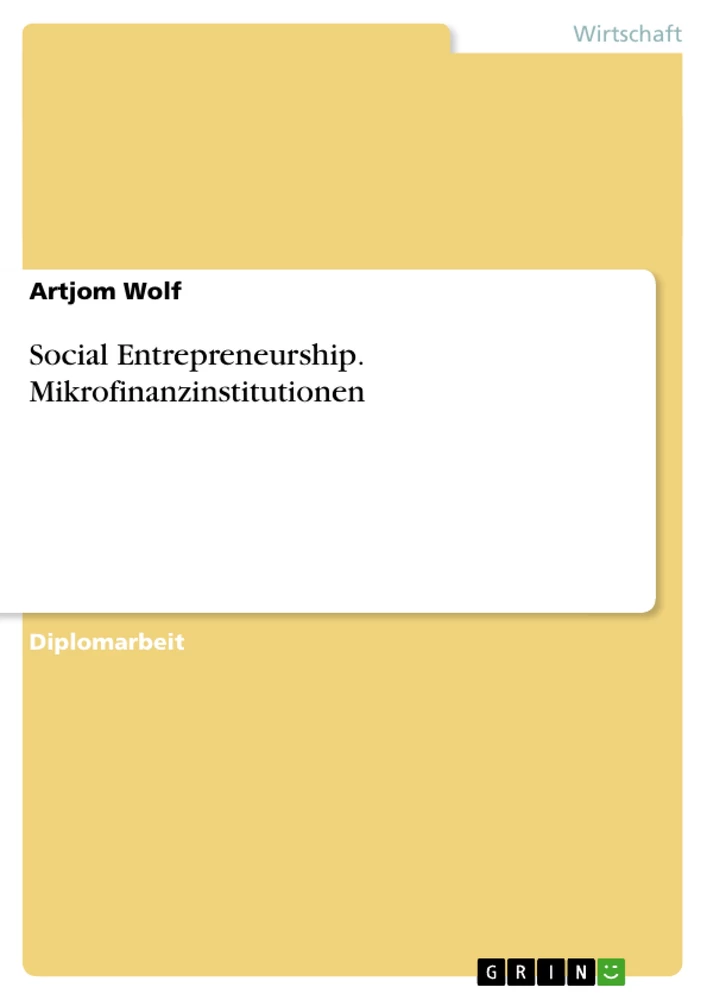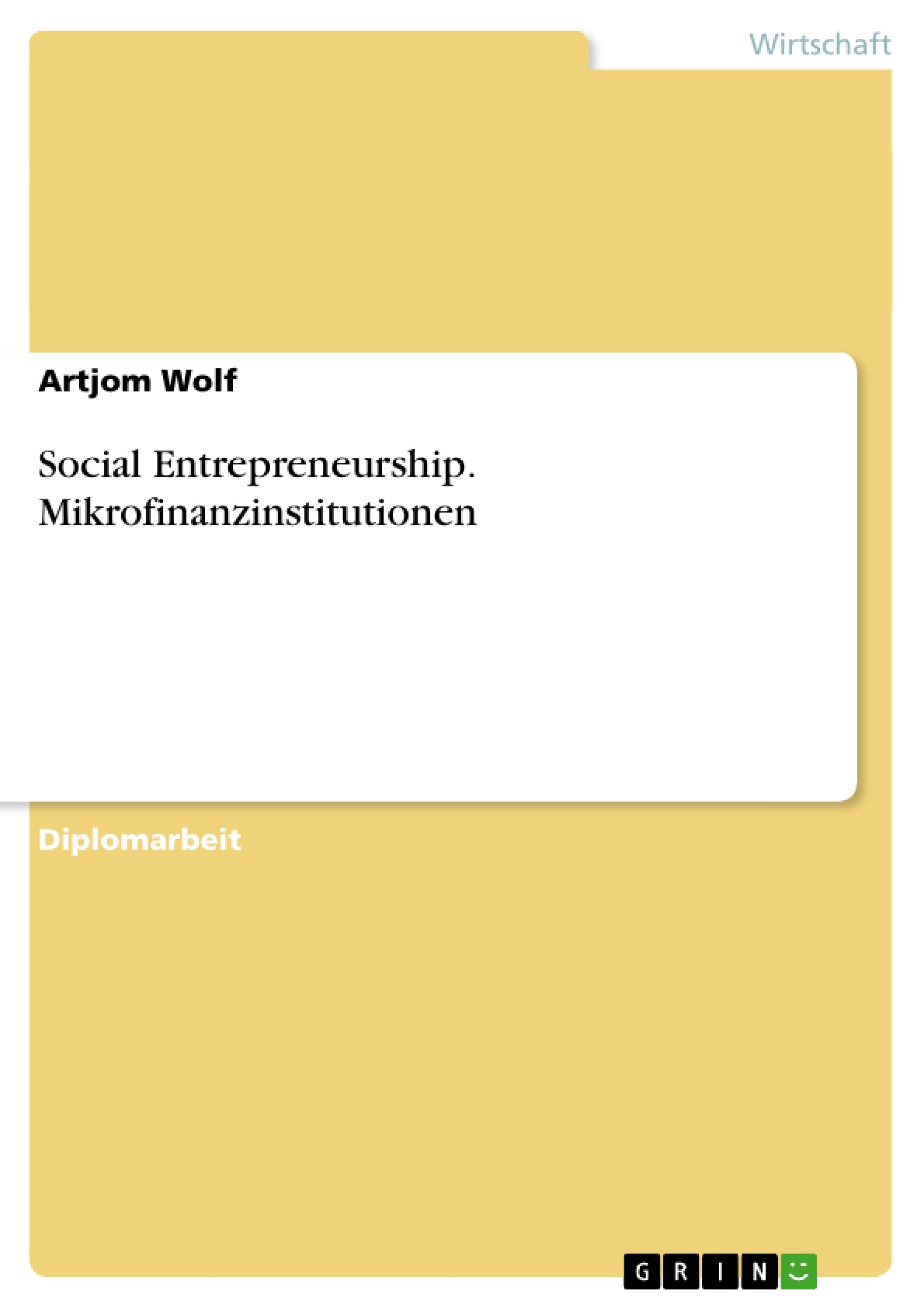Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit zwei Pionierunternehmen im Mikrofinanzsektor. Neben der Grameen Bank aus Bangladesh wird die Banco Solidario aus Bolivien betrachtet. So genannte Mikrofinanzinstitutionen haben eine klare soziale Mission, arme Bevölkerungsschichten zu bedienen, gleichzeitig streben sie aber auch Rentabilität an. Damit stellen sie ein Beispiel für Social Entrepreneurship dar. Muhammad Yunus, der Gründer der Grameen Bank, gilt als Vorbild für innovative profitorientiert denkende Unternehmer mit sozialer Mission. Jedoch ist Social Entrepreneurship kein Phänomen des 21. Jahrhunderts, wie die aktuell geführte Diskussion in der Öffentlichkeit vermuten lässt. Schon im 19. und frühen 20. Jahrhundert gab es unternehmerisch denkende „Wohltäter“. Doch was bedeutet es genau, wenn ein Unternehmen neben der Rendite einen positiven sozialen Effekt erzielen möchte? Kann jemand als Social Entrepreneur bezeichnet werden, weil er Arbeitsplätze schafft, Gewinne für Anteilseigner erwirtschaftet und damit einen positiven Einfluss auf einen Teil der Gesellschaft hat? Eine wissenschaftliche Auseinandersetzung mit Social Entrepreneurship als alleiniges Forschungsfeld gibt es erst seit den 1990er Jahren. Ein Grund dafür, dass es keinen Konsens über Bedeutung, Wirkung und Rolle des Social Entrepreneurship für die Gesellschaft gibt. Oft werden die Social Entrepreneurs als „neue Helden“ überschwänglich gefeiert, doch eine empirische Evidenz über Erfolg und Misserfolg liegt nicht vor.
Die Arbeit hat in den ersten Kapiteln eine theoretische Herangehensweise. Abschließend werden die beiden untersuchten Unternehmen in ein herausgearbeitetes Social-Entrepreneurship-Schema eingeordnet, bevor ein Fazit gezogen und ein Ausblick in die Zukunft geworfen wird.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Problemstellung und Relevanz
- Aufbau der Arbeit
- Konzeptionelle Grundlagen
- Social Entrepreneurship
- Stand der Forschung
- Begriffsdefinitionen
- Theoretische Einordnung der Begriffe Unternehmer/Unternehmertum
- Wie kann Unternehmertum „sozial“ sein?
- Systematisierung
- Priorität sozialer Ziele für das Unternehmen
- Wirtschaftlichkeit / Rentabilität
- Positionierungsmatrix
- Merkmale von Social Entrepreneurship
- Handlungsfelder für Social Entrepreneurs
- Mikrofinanzierung und Mikrofinanzinstitutionen
- Begriffsdefinitionen
- Entwicklung der Mikrokreditidee und Stand der Forschung
- Exkurs 1: Entstehung der Mikrofinanzierung in Europa
- Methoden von MFI bei der Kreditvergabe
- Gruppenkredite und Selbsthilfegruppen
- Village banking
- Individualkredite
- Vergleich der Methoden
- Entstehung von MFI
- Downscaling und Upgrading
- Greenfield-Ansatz und Linkage
- Effizienz und Effektivität von MFI
- Soziale Auswirkungen und Effekte
- Erreichung finanzieller Nachhaltigkeit
- Auswirkungen auf das Finanzsystem und die Gesamtwirtschaft
- Die Rolle von Stakeholdern
- Ausblick: Zukünftige Entwicklung des Mikrofinanzsektors
- Zwischenfazit: Sind alle MFI,,Social Enterprises“?
- Definition und Abgrenzung von Social Entrepreneurship
- Entwicklung und Funktionsweise von Mikrofinanzinstitutionen
- Soziale und wirtschaftliche Auswirkungen von Mikrofinanz
- Die Rolle von Stakeholdern im Mikrofinanzsektor
- Zukünftige Entwicklung des Mikrofinanzsektors
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Diplomarbeit befasst sich mit dem Thema Social Entrepreneurship anhand des Beispiels von Mikrofinanzinstitutionen. Sie analysiert die konzeptionellen Grundlagen von Social Entrepreneurship, die Entwicklung und Funktionsweise von Mikrofinanzinstitutionen sowie deren soziale und wirtschaftliche Auswirkungen. Ziel der Arbeit ist es, die Rolle von Mikrofinanzinstitutionen im Kontext von Social Entrepreneurship zu beleuchten und deren Beitrag zur Armutsbekämpfung und zur Förderung von nachhaltiger Entwicklung zu untersuchen.
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik von Social Entrepreneurship und Mikrofinanzinstitutionen ein und erläutert die Relevanz der Arbeit. Kapitel 3 befasst sich mit den konzeptionellen Grundlagen von Social Entrepreneurship, wobei die Begriffsdefinitionen, Systematisierung und Merkmale dieses Konzepts im Detail betrachtet werden. Kapitel 4 widmet sich der Mikrofinanzierung und analysiert die Entwicklung, Methoden, Effizienz und Effektivität von Mikrofinanzinstitutionen. Die Kapitel 6 und 7 stellen zwei erfolgreiche Beispiele von Mikrofinanzinstitutionen – die Grameen Bank in Bangladesch und Banco Solidario in Bolivien – vor und beleuchten deren Organisationsfaktoren, Umweltfaktoren, soziale Wirkung und finanzielle Nachhaltigkeit.
Schlüsselwörter
Social Entrepreneurship, Mikrofinanzinstitutionen, Mikrokredite, Armutsbekämpfung, nachhaltige Entwicklung, soziale Wirkung, finanzielle Nachhaltigkeit, Grameen Bank, Banco Solidario, Stakeholder, Entwicklungsländer.
Häufig gestellte Fragen
Was ist Social Entrepreneurship?
Social Entrepreneurship bezeichnet unternehmerisches Handeln, das primär auf die Lösung gesellschaftlicher Probleme abzielt, während es gleichzeitig wirtschaftliche Rentabilität anstrebt.
Wie funktionieren Mikrofinanzinstitutionen (MFI)?
MFI vergeben Kleinkredite an arme Bevölkerungsschichten, oft ohne klassische Sicherheiten. Methoden sind Gruppenkredite, Village Banking oder Individualkredite.
Wer ist Muhammad Yunus?
Muhammad Yunus ist der Gründer der Grameen Bank in Bangladesch und gilt als Pionier der modernen Mikrofinanzierung und Vorbild für Social Entrepreneurs weltweit.
Sind Mikrofinanzkredite effektiv bei der Armutsbekämpfung?
Die Arbeit untersucht die Effizienz von MFI im Hinblick auf soziale Auswirkungen und finanzielle Nachhaltigkeit, wobei sie auch Beispiele wie die Banco Solidario in Bolivien analysiert.
Gibt es Social Entrepreneurship erst seit kurzem?
Nein, unternehmerisch denkende "Wohltäter" gab es bereits im 19. Jahrhundert. Die wissenschaftliche Forschung als eigenständiges Feld etablierte sich jedoch erst in den 1990er Jahren.
- Citar trabajo
- Artjom Wolf (Autor), 2007, Social Entrepreneurship. Mikrofinanzinstitutionen, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/92114