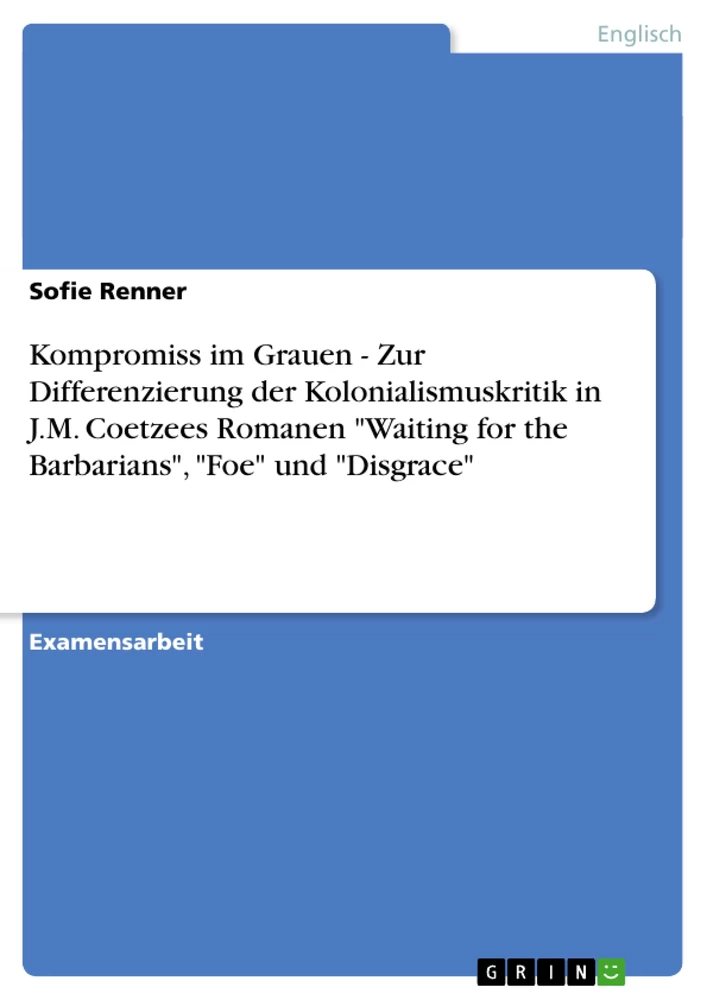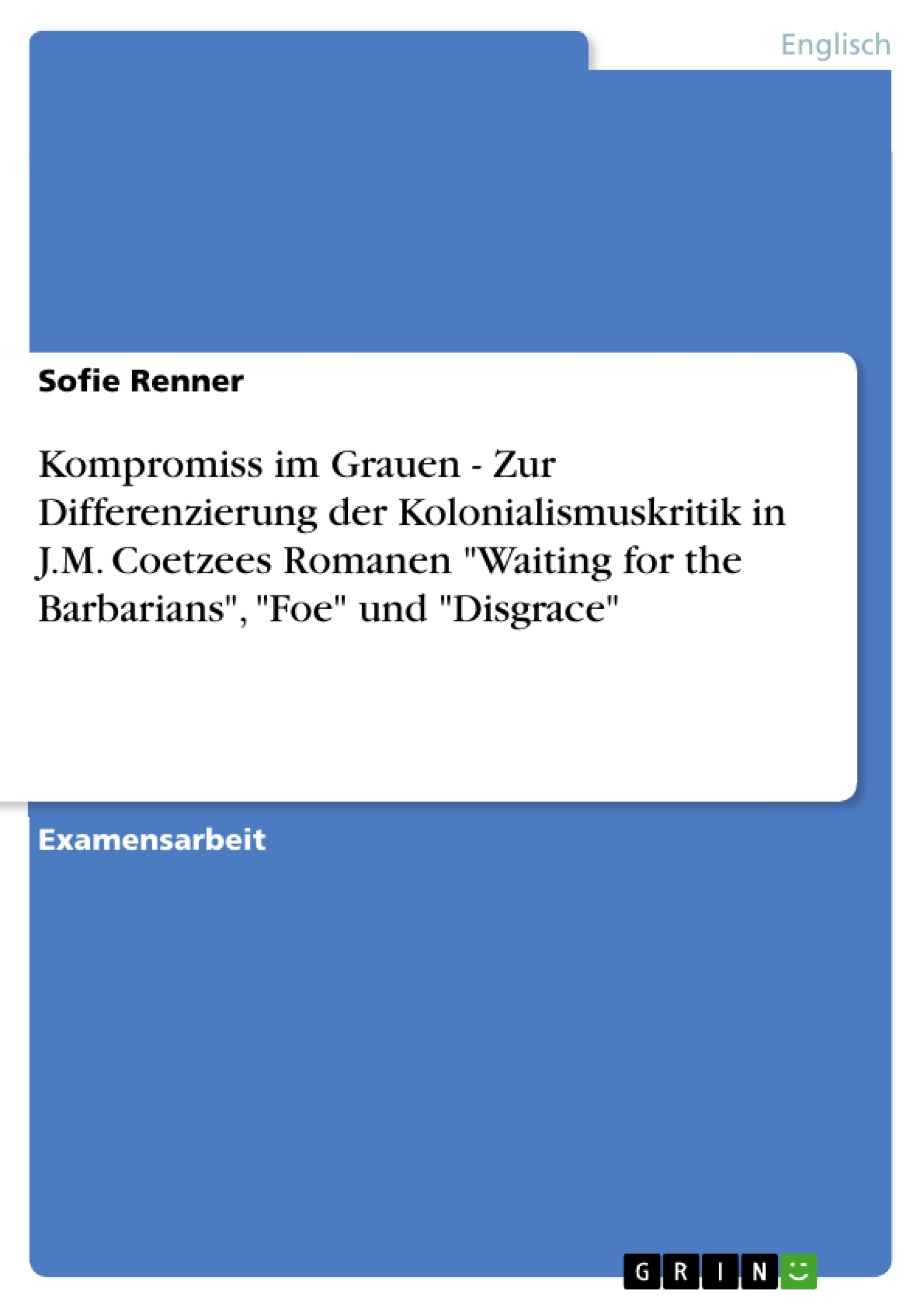The notion that the colonial experiences at the Heart of Africa a void which would seem to penetrate every level of existence, from the biological to the metaphysical, is hardly foreign to him [Coetzee]. (Watson 1986: 371)
Um diese koloniale Erfahrung, die den Kolonisatoren und den Kolonisierten durch und durch durchdringen, sowohl psychisch als auch physisch, geht es in J.M. Coetzees Romanen. In den drei zu besprechenden Romanen Coetzees Waiting for the Barbarians, Foe und Disgrace zeigt sich, dass sich die Kolonialismuspolitik und die damit einhergehende, implizite Kritik sich gleich einem roten Faden durch seine Fiktion zieht. Coetzee ist “a white South African writer engaged with the legacy of colonialism” (Head 1997: iii). In seinen Romanen bezieht Coetzee zwar keine explizite Stellung zur südafrikanischen Situation oder zur weltweiten postkolonialen Situation, aber trotz seiner apolitischen Haltung können die Texte als Deutungen des Kolonialismus gelesen werden, die dadurch weitreichender sind als die herkömmlichen Stellungnahmen politisch engagierter Schriftsteller. So ist bei Coetzee “the actual critique of colonialism […] hardly conventional” (Watson 1986: 371).
Ziel der Arbeit ist, den Kompromiss im Grauen und die Differenzierung der Kolonialismus-kritik in J.M. Coetzees Romanen Waiting for the Barbarians (1980), Foe (1986) und Disgrace (1999) aufzuzeigen. Hierbei soll wie folgt vorgegangen werden. I. bis IV. bilden den theoretischen Teil als thematischen Kontext der Romane. (...)
Inhaltsverzeichnis
- 0. Einleitung
- I. Postkolonialismus und Literatur
- II. Begriffsbestimmung: Was ist Imperialismus, Kolonialismus und Postkolonialismus?
- II.1 Südafrikas spezielle Situation
- III. Schlüsselkonzepte der postkolonialen Literaturtheorie
- III.1 Subversion: Entkolonialisierung (Frantz Fanon)
- III.2 Das koloniale „Andere“ (Edward Said)
- III.3 Hybridität (Homi Bhabha)
- IV. Mannons psychoanalytische Kolonialismus Theorie
- V. J.M. Coetzees Waiting for the Barbarians (1980)
- V.1 Einleitung
- V.2 Kurzbiographie von J. M. Coetzee
- V.3 Inhalt von Waiting for the Barbarians
- V.4 Handlungsort von Waiting for the Barbarians
- V.5 Figurenkonstellation in Waiting for the Barbarians
- V.5.1 Der Magistrat und Oberst Joll
- V.5.2 Der Magistrat und die „Barbarin“
- V.5.3 Der Magistrat und die „Barbaren“
- V.6 Die Position des Magistrats im kolonialen Gefüge: seine scheinbar liberale Stellung und sein Bewusstsein zwischen Transzendenz und Materialismus
- V.7 Die Darstellung des kolonialen „Anderen“ in Waiting for the Barbarians
- V.8 Palimpsest: Rückkehr zur vorkolonialen Identität (Entkolonialisierung)
- V.9 Die „Grauzone“: Die Auseinandersetzung des Magistrats mit seiner Stellung zwischen Täter und Opfer in Waiting for the Barbarians (Hybridität)
- V.9.1 Das Problem der Darstellung von Folter in der Literatur am Beispiel von Waiting for the Barbarians
- VI. J.M. Coetzees Foe (1986)
- VI.1 Inhalt von Foe
- VI.2 Handlungsort von Foe
- VI.3 Figurenkonstellation in Foe
- VI.3.1 Die fünf „Mysterien“: Cruso und Freitag
- VI.3.2 Susan Barton und Freitag
- VI.4 Die Darstellung des kolonialen „Anderen“ in Foe: Susan Barton und Freitag
- VI.5 Subversion und Entkolonialisierung in Foe
- VI.6 Hybridität in Foe
- VI.7 Kompromiss im Grauen: Das Labyrinth des Zweifels in Foe
- VII. J.M. Coetzees Disgrace (1999)
- VII.1 Inhalt von Disgrace
- VII.2 Handlungsort von Disgrace
- VII.3 Figurenkonstellation in Disgrace
- VII.3.1 David Lurie und Soraya
- VII.3.2 David Lurie und Melanie Isaacs
- VII.3.3 David Lurie und Mr. Isaacs
- VII.3.4 David Lurie/Lucy und Petrus
- VII.4 Die Darstellung des (post)kolonialen „Anderen“ in Disgrace
- VII.5 Subversion und Entkolonialisierung in Disgrace
- VII.5.1 Das Ende der Apartheid: nichts ist so wie vorher
- VII.5.2 Die Grauzone: Die Frage nach Schuld, Vergeltung und Aussöhnung im Südafrika nach der Apartheid in Disgrace
- VII.6 Hybridität in Disgrace
- VIII. Schlusswort
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die differenzierte Kolonialismuskritik in drei Romanen von J.M. Coetzee: Waiting for the Barbarians, Foe und Disgrace. Ziel ist es, den „Kompromiss im Grauen“, die Ambivalenz und die moralischen Grauzonen in Coetzees Darstellung des Kolonialismus und seiner Nachwirkungen aufzuzeigen. Die Arbeit analysiert, wie Coetzee die koloniale Erfahrung sowohl bei den Kolonisatoren als auch den Kolonisierten darstellt, ohne explizite politische Stellungnahmen abzugeben.
- Die Darstellung des kolonialen „Anderen“ in Coetzees Romanen
- Konzepte der Subversion und Entkolonialisierung
- Das Konzept der Hybridität und seine Ausprägung in den Romanen
- Die moralische Ambivalenz und der „Kompromiss im Grauen“ in Coetzees Kolonialismuskritik
- Südafrikas spezifischer Kontext als zweimal kolonisierter, postkolonialer Staat
Zusammenfassung der Kapitel
0. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der Arbeit ein und beschreibt den Fokus auf die differenzierte Kolonialismuskritik in drei Romanen von J.M. Coetzee. Sie hebt Coetzees besondere Herangehensweise hervor, die sich durch eine implizite, anstatt expliziter politischer Stellungnahme auszeichnet. Die Einleitung beschreibt das Ziel der Arbeit, den "Kompromiss im Grauen" und die Differenzierung der Kolonialismuskritik aufzuzeigen.
I. Postkolonialismus und Literatur: Dieses Kapitel untersucht die komplexe Beziehung zwischen Postkolonialismus und Literatur. Es legt den theoretischen Grundstein für die spätere Analyse der Romane, indem es den Kontext und die relevanten literaturtheoretischen Ansätze beleuchtet. Die Ausführungen dieses Kapitels bereiten den Leser auf die spezifischen analytischen Konzepte vor, die in den folgenden Kapiteln zur Anwendung kommen.
II. Begriffsbestimmung: Was ist Imperialismus, Kolonialismus und Postkolonialismus?: Dieses Kapitel liefert präzise Definitionen der zentralen Begriffe Imperialismus, Kolonialismus und Postkolonialismus. Es wird besonders auf Südafrikas einzigartige Situation als zweimal kolonisierter Staat eingegangen, der während der Apartheid weiterhin koloniale Strukturen aufwies. Die differenzierte Betrachtung Südafrikas dient als wichtiger Kontext für die anschließende Analyse von Coetzees Romanen.
III. Schlüsselkonzepte der postkolonialen Literaturtheorie: Dieses Kapitel befasst sich mit zentralen Konzepten der postkolonialen Literaturtheorie, die für das Verständnis von Coetzees Romanen unabdingbar sind. Es analysiert Subversion und Entkolonialisierung nach Fanon, das koloniale „Andere“ nach Said und Hybridität nach Bhabha. Die detaillierte Erläuterung dieser Konzepte ermöglicht eine fundierte Interpretation der Romane in den folgenden Kapiteln.
IV. Mannons psychoanalytische Kolonialismus Theorie: Dieses Kapitel erörtert die psychoanalytische Kolonialismus-Theorie von Mannons und deren Relevanz für die Interpretation von Coetzees Romanen. Die psychoanalytische Perspektive wird als eine wichtige Methode der Kontextualisierung und Analyse der in den Werken dargestellten psychischen und emotionalen Auswirkungen des Kolonialismus erarbeitet.
V. J.M. Coetzees Waiting for the Barbarians (1980): Dieses Kapitel analysiert Coetzees Roman Waiting for the Barbarians. Es untersucht die zentralen Figuren, den Handlungsort und die Darstellung des kolonialen „Anderen“. Besonderes Augenmerk wird auf die Ambivalenz des Magistrats gelegt und sein Ringen zwischen Täter und Opfer im kolonialen System. Der Roman wird im Kontext der Schlüsselkonzepte aus Kapitel III analysiert, um die subtilen Mechanismen der kolonialen Machtverhältnisse aufzudecken.
VI. J.M. Coetzees Foe (1986): Das Kapitel widmet sich Coetzees Roman Foe. Es analysiert die komplexe Figurenkonstellation, insbesondere die Beziehung zwischen Susan Barton, Cruso und Freitag. Die Darstellung des kolonialen „Anderen“ und die Anwendung der Konzepte der Subversion, Entkolonialisierung und Hybridität werden untersucht. Das Kapitel erörtert, wie Coetzee das Labyrinth des Zweifels und die moralischen Grauzonen der Kolonialgeschichte darstellt.
VII. J.M. Coetzees Disgrace (1999): Dieses Kapitel konzentriert sich auf Coetzees Roman Disgrace. Es analysiert die Darstellung des (post)kolonialen „Anderen“ im Kontext des post-Apartheid-Südafrikas. Die Konzepte der Subversion, Entkolonialisierung und Hybridität werden im Hinblick auf die komplexe Thematik von Schuld, Vergeltung und Aussöhnung untersucht. Das Kapitel beleuchtet den „Kompromiss im Grauen“ in einem Südafrika nach dem Ende der Apartheid.
Schlüsselwörter
Postkolonialismus, Kolonialismus, J.M. Coetzee, Waiting for the Barbarians, Foe, Disgrace, Südafrika, Apartheid, „Anderes“, Hybridität, Subversion, Entkolonialisierung, Moralische Ambivalenz, Grauzonen, Kompromiss.
Häufig gestellte Fragen zu: Analyse der Kolonialismuskritik in J.M. Coetzees Romanen
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese akademische Arbeit analysiert die differenzierte Kolonialismuskritik in drei Romanen von J.M. Coetzee: Waiting for the Barbarians, Foe und Disgrace. Der Fokus liegt auf der Darstellung moralischer Grauzonen und Ambivalenzen in Coetzees Darstellung des Kolonialismus und seiner Nachwirkungen, sowohl bei den Kolonisatoren als auch den Kolonisierten. Die Arbeit vermeidet explizite politische Stellungnahmen und konzentriert sich auf die implizite Kritik in den Romanen.
Welche Schlüsselkonzepte der postkolonialen Literaturtheorie werden verwendet?
Die Analyse stützt sich auf zentrale Konzepte der postkolonialen Literaturtheorie, darunter Subversion und Entkolonialisierung (Frantz Fanon), das koloniale „Andere“ (Edward Said) und Hybridität (Homi Bhabha). Diese Konzepte werden detailliert erläutert und auf die Romane angewendet.
Welche Rolle spielt Südafrika in der Analyse?
Südafrikas einzigartige Geschichte als zweimal kolonisierter Staat mit anhaltenden kolonialen Strukturen während der Apartheid bildet einen wichtigen Kontext für die Analyse von Coetzees Romanen. Die Arbeit berücksichtigt die spezifische südafrikanische Situation in der Interpretation der Romane.
Wie werden die drei Romane von J.M. Coetzee analysiert?
Jeder Roman (Waiting for the Barbarians, Foe und Disgrace) wird in einem separaten Kapitel eingehend analysiert. Die Analyse umfasst die Untersuchung der zentralen Figuren, des Handlungsorts, der Darstellung des kolonialen „Anderen“, sowie die Anwendung der Schlüsselkonzepte der postkolonialen Literaturtheorie. Besonderes Augenmerk liegt auf der moralischen Ambivalenz und den „Grauzonen“ in der Darstellung des Kolonialismus.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themen: die Darstellung des kolonialen „Anderen“, Subversion und Entkolonialisierung, Hybridität, moralische Ambivalenz und der „Kompromiss im Grauen“, sowie Südafrikas spezifischer Kontext als postkolonialer Staat.
Welche Ziele verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, den „Kompromiss im Grauen“, die Ambivalenz und die moralischen Grauzonen in Coetzees Darstellung des Kolonialismus aufzuzeigen. Sie analysiert, wie Coetzee die koloniale Erfahrung differenziert darstellt, ohne explizit politische Positionen einzunehmen.
Welche zusätzlichen theoretischen Perspektiven werden einbezogen?
Neben den genannten Konzepten der postkolonialen Literaturtheorie wird auch die psychoanalytische Kolonialismus-Theorie von Mannons herangezogen, um die psychischen und emotionalen Auswirkungen des Kolonialismus zu beleuchten.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit ist strukturiert in Einleitung, Kapitel zur Begriffsbestimmung und Theorie, Kapitel zur Analyse der drei Romane und Schlussfolgerung. Jedes Kapitel enthält eine Zusammenfassung der wesentlichen Erkenntnisse.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Postkolonialismus, Kolonialismus, J.M. Coetzee, Waiting for the Barbarians, Foe, Disgrace, Südafrika, Apartheid, „Anderes“, Hybridität, Subversion, Entkolonialisierung, Moralische Ambivalenz, Grauzonen, Kompromiss.
- Citation du texte
- Sofie Renner (Auteur), 2005, Kompromiss im Grauen - Zur Differenzierung der Kolonialismuskritik in J.M. Coetzees Romanen "Waiting for the Barbarians", "Foe" und "Disgrace", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/92119