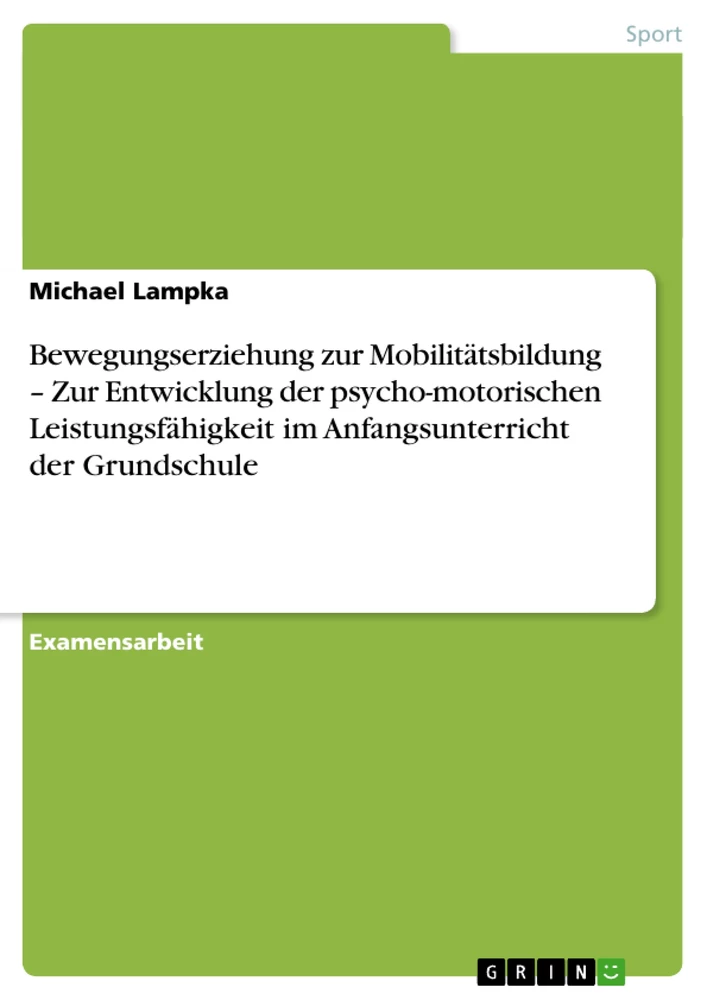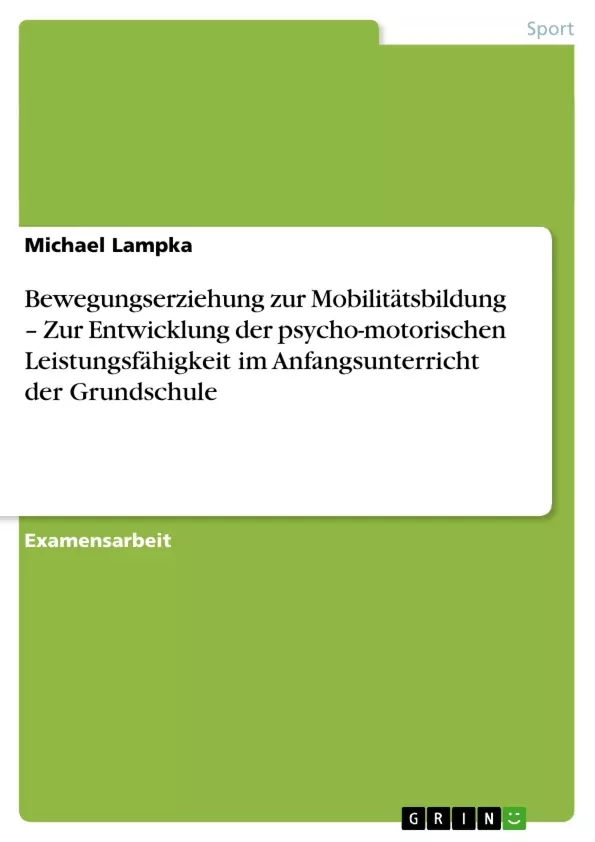Die motorischen Defizite der heutigen Kindergeneration standen in den letzten Jahren immer wieder im Mittelpunkt medizinischer-, pädagogischer- und sogar politischer Dikussionen. Auch in den verkehrspädagogischen Debatten fand diese Thematik häufiger Aufmerksamkeit. Die Verkehrs- und Mobilitätserziehung versucht Kinder über die vielfältigen Gefahren im Straßenverkehr aufzuklären und richtiges Verhalten einzuüben. Das beginnt im Elternhaus, gefolgt vom Kindergarten und setzt sich in der Schule fort. Ein wesentlicher Teil der Verkehrs- und Mobilitätserziehung in allen genannten „Institutionen“ war und ist das Üben von verkehrsrelevanten Sicherheitsaspekten wie beispielsweise Verkehrsregeln und Schilder- oder Ampelbedeutungen. Im Anfangsunterricht der Grund-schule ist Verkehrserziehung im „herkömmlichen“ Sinne oft nicht Mobilitätserziehung, sondern traditionelle Sicherheitserziehung und auf Anpassung an die gegebene Verkehrsstruktur orientierte Sozialerziehung. Für zusätzliche Aspekte bleibt kaum Zeit. Die meisten Lehrerinnen und Lehrer sind froh, wenn sie nach der Radfahrausbildung in der Grundschule wieder zum eigentlichen Unterricht zurückkommen können. Denn im vierten Schuljahr findet die Auslese in die weiterführenden Schulen statt, wobei die Kernfächer Deutsch, Mathematik und neuerdings Englisch wichtig sind, aber nicht Verkehrserziehung oder Mobilitätsbildung.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- So sind Kinder
- Kindheit heute
- Entwicklungen und Leistungsvoraussetzungen im Kindesalter
- Psychische Entwicklungen und Leistungsvoraussetzungen im Kindesalter
- Motorische Entwicklungen und Leistungsvoraussetzungen im Kindesalter
- Bewegungserziehung und Psychomotorik
- Bewegungserziehung im Anfangsunterricht
- Psychomotorik im Anfangsunterricht
- Zusammenhänge von Sport und Verkehrspädagogik
- Kinder als Teilnehmer im Verkehr
- Typische kindliche Erlebens- und Verhaltensweisen im Verkehr
- Die Leistungsvoraussetzungen von Kindern im Verkehr
- Radfahren mit sechs und sieben Jahren
- Psychomotorische Handlungskompetenz von Kindern im Verkehr
- Empirie
- Hypothesen
- Datenerhebung
- Untersuchungsvorgehen (Stichprobe)
- Untersuchungsmaterial (Messinstrument)
- Ergebnisse
- Diskussion der Ergebnisse
- Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Masterarbeit untersucht die Bedeutung von Bewegungserziehung für die Mobilitätsbildung im Anfangsunterricht der Grundschule. Sie zielt darauf ab, die motorischen Defizite der heutigen Kindergeneration im Kontext der Verkehrserziehung zu beleuchten und die Bedeutung von psychomotorischen Fähigkeiten für die Entwicklung von Mobilitätskompetenz zu verdeutlichen.
- Motorische Defizite bei Kindern und ihre Auswirkungen auf die Verkehrssicherheit
- Die Rolle der Bewegungserziehung und Psychomotorik in der Mobilitätsbildung
- Zusammenhänge zwischen körperlichen Fähigkeiten und dem sicheren Verhalten im Straßenverkehr
- Die Bedeutung von koordinativen Fähigkeiten für das Radfahren und die Mobilitätsteilnahme
- Entwicklung eines psycho-motorischen Übungsangebots zur Förderung von Mobilitätskompetenz
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung befasst sich mit dem aktuellen Stand der Debatte über die motorischen Defizite von Kindern und deren Bedeutung im Kontext von Verkehrserziehung. Sie beleuchtet die Herausforderungen, die traditionelle Verkehrserziehung im Anfangsunterricht der Grundschule mit sich bringt und die Notwendigkeit einer stärker auf Bewegung fokussierten Mobilitätsbildung.
Das zweite Kapitel beschäftigt sich mit der kindlichen Entwicklung und den spezifischen Bedürfnissen von Kindern im Kindesalter. Es beleuchtet sowohl die psychische als auch die motorische Entwicklung und deren Bedeutung für die Verkehrsteilnahme.
Das dritte Kapitel widmet sich dem Thema Bewegungserziehung und Psychomotorik im Anfangsunterricht. Es geht auf die Bedeutung von Bewegungserziehung für die allgemeine Entwicklung von Kindern sowie die spezifischen Möglichkeiten und Herausforderungen der Psychomotorik im schulischen Kontext ein.
Das vierte Kapitel untersucht die komplexen Zusammenhänge zwischen Sport und Verkehrspädagogik. Es betrachtet die Rolle von Bewegung und Bewegungserfahrungen im Hinblick auf die Entwicklung von Verkehrssicherheit und Mobilitätskompetenz.
Das fünfte Kapitel analysiert das Verhalten von Kindern als Verkehrsteilnehmer. Es beleuchtet typische Erlebens- und Verhaltensweisen, die Leistungsvoraussetzungen von Kindern im Verkehr und die besonderen Herausforderungen beim Radfahren lernen.
Das sechste Kapitel beschreibt die empirische Untersuchung der Arbeit, die in zwei ersten Klassen durchgeführt wurde. Es stellt die Forschungsfrage, die Hypothesen, das Untersuchungsdesign und die eingesetzten Messinstrumente vor.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit zentralen Themen der Mobilitätsbildung, der Verkehrserziehung und der psychomotorischen Entwicklung von Kindern. Zu den wichtigsten Schlüsselbegriffen gehören Bewegungserziehung, Psychomotorik, Mobilitätskompetenz, Verkehrssicherheit, motorische Fähigkeiten, koordinative Fähigkeiten, Radfahren, Kinderunfälle, Grundschule und Anfangsunterricht.
Häufig gestellte Fragen zur Mobilitätsbildung
Was ist der Unterschied zwischen Verkehrserziehung und Mobilitätsbildung?
Traditionelle Verkehrserziehung fokussiert auf Anpassung und Regeln, während Mobilitätsbildung die psychomotorische Handlungsfähigkeit und selbstständige Teilhabe in den Mittelpunkt stellt.
Warum haben heutige Kinder oft motorische Defizite?
Veränderte Lebensbedingungen und mangelnde Bewegungsräume führen zu Defiziten, die sich negativ auf die Sicherheit im Straßenverkehr auswirken können.
Welche Rolle spielt die Psychomotorik im Anfangsunterricht?
Psychomotorik fördert die koordinativen Fähigkeiten, die eine Grundvoraussetzung für sicheres Radfahren und die Einschätzung von Verkehrssituationen sind.
Können Kinder mit sechs Jahren bereits sicher Radfahren?
Die Arbeit untersucht die Leistungsvoraussetzungen und zeigt, dass viele Kinder in diesem Alter psychomotorisch noch stark gefordert sind, was spezielles Training erfordert.
Was ist das Ziel des psycho-motorischen Übungsangebots?
Es soll die motorische Leistungsfähigkeit im Schulsport so steigern, dass Kinder kompetenter und sicherer am Straßenverkehr teilnehmen können.
- Citar trabajo
- Michael Lampka (Autor), 2008, Bewegungserziehung zur Mobilitätsbildung – Zur Entwicklung der psycho-motorischen Leistungsfähigkeit im Anfangsunterricht der Grundschule, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/92140