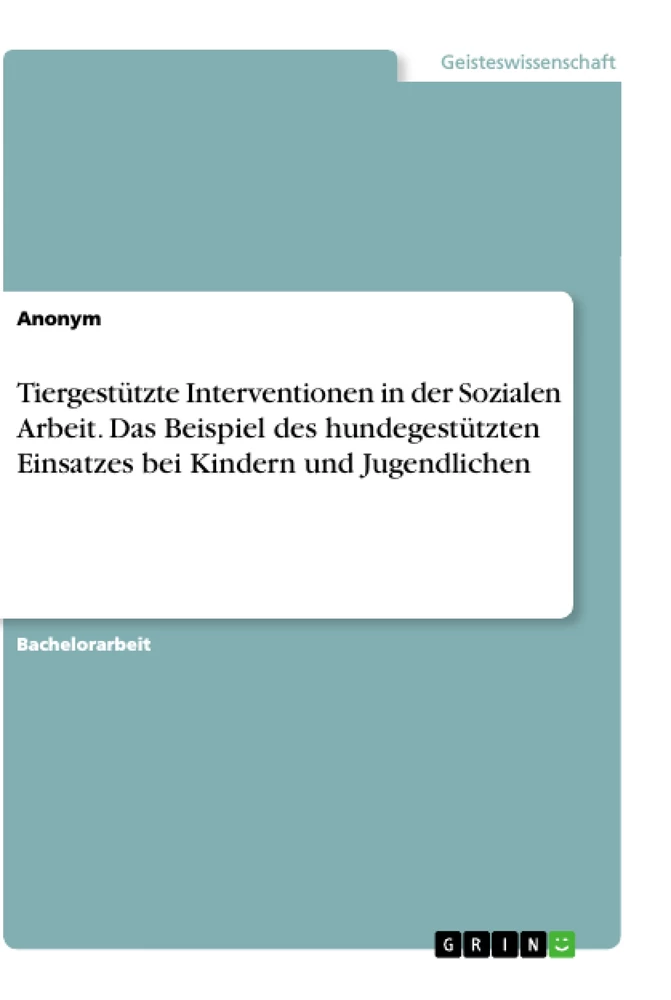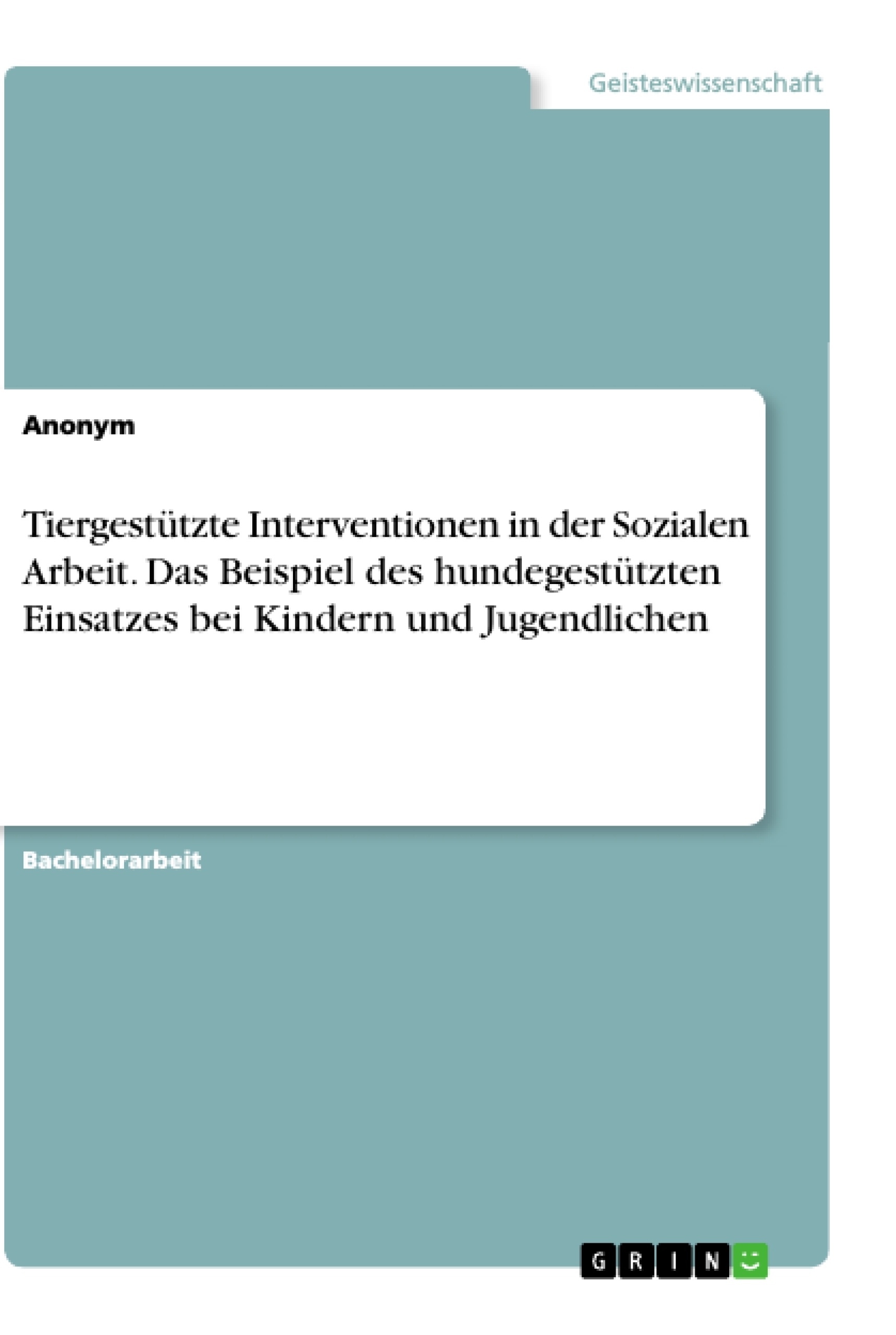In dieser Arbeit werden die Möglichkeiten der tiergestützten Intervention im Arbeitsfeld der Kinder- und Jugendarbeit dargestellt. Der Fokus wird vor allem auf die Besonderheit des Hundes in der tiergestützten Arbeit mit Kindern und Jugendlichen gelegt, da er dort mittlerweile sehr vielseitig eingesetzt wird. Zudem soll hier auch die Frage beantwortet werden, welche Wirksamkeit und Bedeutung die tiergestützte Intervention mit Hunden auf Kinder und Jugendliche hat.
Die Arbeit ist in drei Teile gegliedert. Zu Beginn wird die Grundlage der Mensch-Tier-Beziehung dargestellt, nachfolgend die tiergestützten Interventionen und zum Schluss wird spezieller auf die hundegestützten Interventionen eingegangen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Grundlagen der Mensch-Tier-Beziehung
- 2.1 Erklärungsansätze
- 2.1.1 Biophilie-Hypothese
- 2.1.2 Du-Evidenz und Anthropomorphismus
- 2.1.3 Bindungstheoretische Überlegungen
- 2.2 Kommunikation zwischen Mensch und Tier
- 2.1 Erklärungsansätze
- 3. Tiergestützte Interventionen
- 3.1 Geschichtliche Entwicklung
- 3.2 Definition von tiergestützten Interventionen
- 3.3 Psychische Effekte
- 3.4 Therapeutische und pädagogische Implikationen
- 3.5 Warum Kinder Tiere brauchen
- 3.6 Green Chimneys
- 4. Hundegestützte Interventionen
- 4.1 Abstammung und Domestikation
- 4.2 Kommunikation Mensch Hund
- 4.3 (soziale) Dienstleistungsfunktionen
- 4.4 Voraussetzungen/Grenzen
- 4.4.1 Mensch
- 4.4.2 Hund
- 4.4.3 Einrichtung
- 4.5 Die fünf Grundmethoden
- 4.6 Praxiskonzepte für verschiedene Arbeitsfelder
- 4.6.1 Offene Kinder und Jugendarbeit (OKJA)
- 4.6.2 Aufsuchende Jugendarbeit (AuJa)
- 4.6.3 Jugendsozialarbeit an Schulen (JaS)
- 4.6.4 Kindertagesbetreuung
- 4.6.5 Einrichtungen der Jugendhilfe
- 5. Fazit
- 6. Resümee
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Bachelorarbeit befasst sich mit der Bedeutung und Wirksamkeit von tiergestützten Interventionen in der Kinder- und Jugendarbeit, insbesondere mit dem Einsatz von Hunden. Die Arbeit untersucht die grundlegenden Prinzipien der Mensch-Tier-Beziehung und die historischen, theoretischen und praktischen Aspekte tiergestützter Interventionen. Besonderes Augenmerk liegt dabei auf der Untersuchung der Vorteile und Grenzen von hundegestützten Interventionen in verschiedenen Arbeitsfeldern der Kinder- und Jugendarbeit.
- Die Rolle von Tieren in der Entwicklung von Kindern und Jugendlichen
- Die theoretischen Grundlagen der Mensch-Tier-Beziehung
- Die Geschichte und Definition von tiergestützten Interventionen
- Die psychischen und sozialen Effekte tiergestützter Interventionen
- Die spezifischen Möglichkeiten und Herausforderungen von hundegestützten Interventionen
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel befasst sich mit der Grundlage der Mensch-Tier-Beziehung, indem es die geschichtliche Entwicklung, die Erklärungsansätze und die Kommunikation zwischen Mensch und Tier beleuchtet. Das zweite Kapitel konzentriert sich auf tiergestützte Interventionen, wobei die Geschichte, Definitionen, psychischen Effekte und pädagogischen Implikationen sowie die Bedeutung von Tieren für Kinder im Mittelpunkt stehen. Das dritte Kapitel widmet sich den hundegestützten Interventionen, indem es die Abstammung und Domestikation des Hundes, die Mensch-Hund-Kommunikation, die Einsatzbereiche des Hundes sowie die Voraussetzungen und Grenzen des Einsatzes in der Sozialen Arbeit erläutert. Darüber hinaus werden fünf Grundmethoden und verschiedene Praxiskonzepte für die Arbeit mit Hunden in der Kinder- und Jugendarbeit vorgestellt.
Schlüsselwörter
Tiergestützte Interventionen, Hundegestützte Interventionen, Mensch-Tier-Beziehung, Kinder- und Jugendarbeit, soziale Arbeit, psychische Effekte, therapeutische und pädagogische Implikationen, Green Chimneys, Kommunikation Mensch Hund, Dienstleistungsfunktionen, Voraussetzungen, Grenzen.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2019, Tiergestützte Interventionen in der Sozialen Arbeit. Das Beispiel des hundegestützten Einsatzes bei Kindern und Jugendlichen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/922268