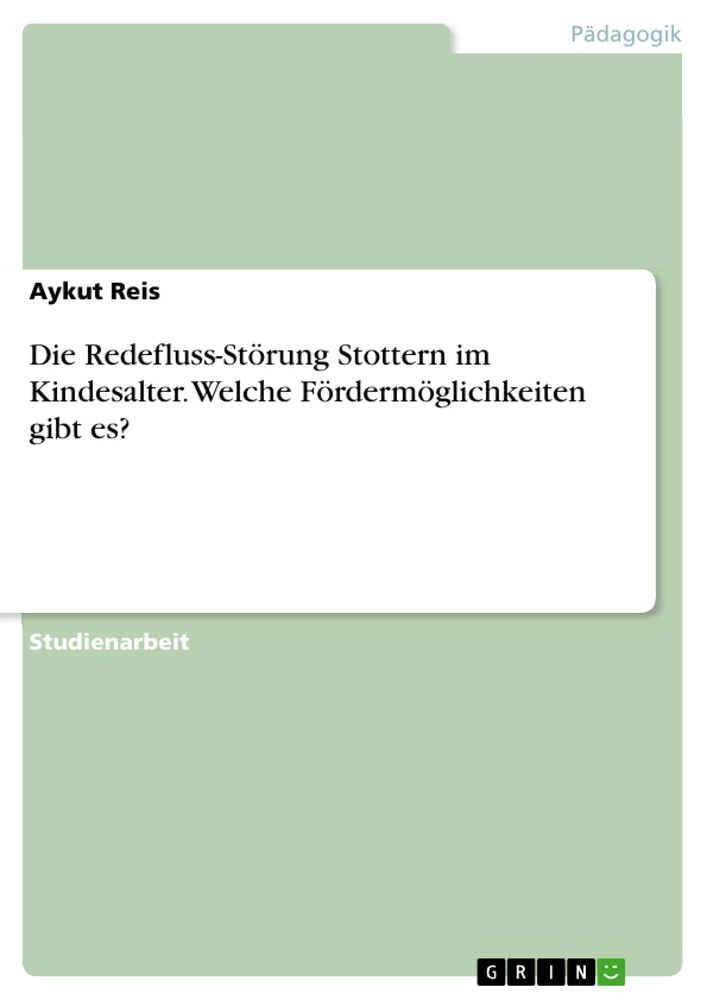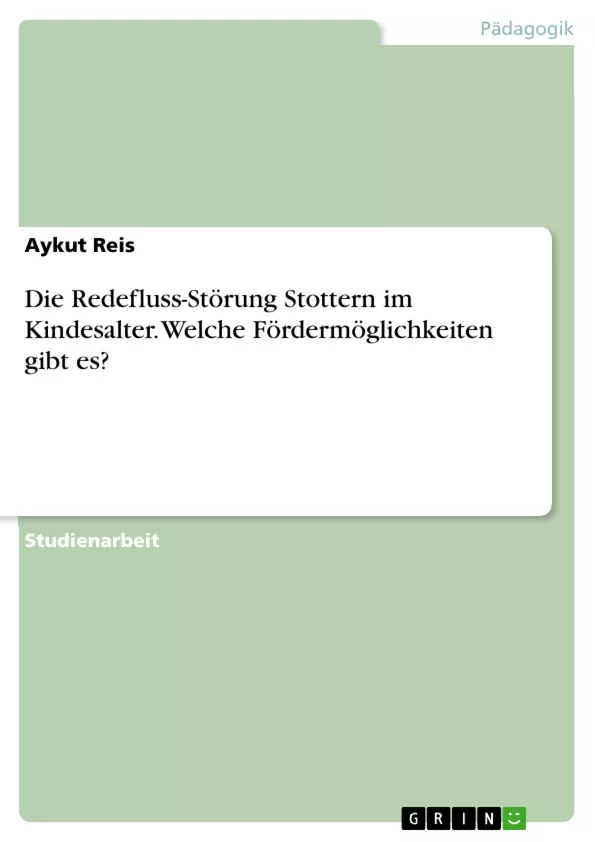Mit dieser wissenschaftlichen Hausarbeit soll ein Überblick über das breitgefächerte Spektrum der Redeflussstörung Stottern im Kindesalter gegeben werden. Ebenso sollen Fördermöglichkeiten seitens der Fachkräfte erläutert werden.
Als das fundamental bedeutsamste Medium der Menschen bedient sich Sprache ebenfalls als Türöffner für Aspekte des Erkennens, der Verstandestätigkeit, der Interaktion sowie Integration hinsichtlich Bildung und Wissenserwerb. Gesellschaftlich betrachtet hat eine gut entwickelte Kompetenz der Sprache und des Sprechens einen recht hohen Stellenwert, denn sie ermöglicht zwischenmenschliche Bindungen und Beziehungen aufzubauen, diese zu intensivieren und bestehen zu lassen. Sobald also eine Verzögerung der sprachlichen Entwicklung präsent wird oder die Redeflussstörung des Stotterns bei Kindern ansetzt, so kann dies zu unangenehmen Effekten für das Kind und dessen Familienkreis führen. Demnach ist es sowohl für Eltern als auch für pädagogische Fachkräfte von großer Bedeutung, diese Kinder so weit es geht dabei zu unterstützen, mit der Problematik der Redeflussstörung umzugehen. Denn schließlich sollten Eltern die Erwartung an pädagogischen Fachkräften pflegen dürfen, dass ihre Kinder hinsichtlich der Störung kompetent und einfühlsam begleitet werden.
In den ersten Kapiteln werden zunächst die Elemente der Redeflussstörung Stottern hinsichtlich ihrer Kern- und Begleitsymptome dargestellt. Dabei wird das Stottern definiert und zeitgleich ein Einblick in entwicklungsbedingte und chronische Unflüssigkeiten des Sprechens gewährleistet. Darüber hinaus werden grundlegende Informationen bezüglich der Entstehung und Entwicklung bereitgestellt, sodass ein Zusammenhang zu stotternden Kindern in Kindertagesstätten aufgebaut werden kann. Abschließend folgen Optionen der Förderung für betroffene Kinder durch a) pädagogische Fachkräfte und b) die Zusammenarbeit mit den Familienkreisen der Kinder.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Definition „Redefluss-Störung: Stottern“
- Entwicklungsbedingtes Stottern
- Chronisches Stottern
- Symptomatik
- Grundlegende Informationen
- Entstehung des Stotterns
- Wie entwickelt sich das Stottern?
- Stotternde Kinder in Kitas
- Fördermöglichkeiten für stotternde Kinder
- Förderung im pädagogischen Alltag
- Zusammenspiel von pädagogischen Fachkräften und Eltern
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit gibt einen Überblick über Stottern im Kindesalter und zeigt Fördermöglichkeiten für pädagogische Fachkräfte auf. Das Ziel ist es, das Verständnis für diese Redeflussstörung zu verbessern und Handlungsempfehlungen für den Umgang mit stotternden Kindern zu liefern.
- Definition und Unterscheidung von entwicklungsbedingtem und chronischem Stottern
- Entstehung und Entwicklung von Stottern
- Herausforderungen für stotternde Kinder im Kita-Alltag
- Förderansätze im pädagogischen Alltag
- Zusammenarbeit zwischen pädagogischen Fachkräften und Eltern
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Diese wissenschaftliche Hausarbeit bietet einen umfassenden Überblick über die Redeflussstörung Stottern bei Kindern. Sie betont die gesellschaftliche Bedeutung flüssigen Sprechens und die Herausforderungen, die Stottern für Kinder und deren Familien mit sich bringt. Die Arbeit legt den Fokus auf die Unterstützungsmöglichkeiten für diese Kinder durch pädagogische Fachkräfte und beleuchtet die Notwendigkeit einer einfühlsamen und kompetenten Begleitung.
Definition „Redefluss-Störung: Stottern“: Das Kapitel definiert Stottern als ungewollte und unfreiwillige Unterbrechungen des Redeflusses, die von Laut- und Silbenwiederholungen, Dehnungen und Pausen begleitet werden können. Es wird zwischen entwicklungsbedingtem und chronischem Stottern unterschieden. Während entwicklungsbedingtes Stottern oft eine vorübergehende Phase darstellt, kann chronisches Stottern langfristige negative Auswirkungen auf die psychosoziale Entwicklung haben.
Grundlegende Informationen: Dieses Kapitel befasst sich mit der Entstehung und Entwicklung von Stottern. Es erklärt den Zusammenhang zwischen der Fähigkeit zu denken und der Fähigkeit zu sprechen und wie Diskrepanzen zwischen diesen beiden Fähigkeiten zu Redeflussstörungen führen können. Es wird darauf hingewiesen, dass der genaue Zusammenhang zwischen der Entwicklung normaler Unflüssigkeiten im Sprechen und dem Auftreten von Stottern noch nicht vollständig geklärt ist.
Stotternde Kinder in Kitas: Dieses Kapitel beleuchtet die besonderen Herausforderungen, denen stotternde Kinder in der Kita-Umgebung begegnen. Es werden die Auswirkungen von Stottern auf die soziale Interaktion und den Bildungsprozess thematisiert. (Note: The provided text does not contain substantial content for this chapter, hence this brief summary).
Fördermöglichkeiten für stotternde Kinder: Dieses Kapitel beschreibt verschiedene Fördermöglichkeiten für stotternde Kinder, sowohl im pädagogischen Alltag als auch durch die Zusammenarbeit zwischen pädagogischen Fachkräften und Eltern. Es betont die Wichtigkeit einer positiven und unterstützenden Umgebung, die das Selbstbewusstsein der Kinder stärkt und ihnen hilft, ihre Sprechfähigkeiten zu verbessern. Die Bedeutung der gemeinsamen Anstrengung von Pädagogen und Eltern wird hervorgehoben.
Schlüsselwörter
Stottern, Redeflussstörung, kindliche Entwicklung, Sprachentwicklung, Fördermöglichkeiten, Pädagogik, Kita, Elternarbeit, Entwicklungsbedingtes Stottern, Chronisches Stottern, Kommunikation.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Redeflussstörung: Stottern im Kindesalter
Was ist der Inhalt dieser Arbeit?
Diese wissenschaftliche Arbeit bietet einen umfassenden Überblick über Stottern im Kindesalter. Sie beinhaltet eine Definition von Stottern, unterscheidet zwischen entwicklungsbedingtem und chronischem Stottern, beleuchtet die Entstehung und Entwicklung der Störung, betrachtet die Herausforderungen für betroffene Kinder im Kita-Alltag und präsentiert schließlich Fördermöglichkeiten für pädagogische Fachkräfte und die Zusammenarbeit mit Eltern.
Was wird unter "Stottern" verstanden?
Stottern wird als ungewollte und unfreiwillige Unterbrechung des Redeflusses definiert, die sich durch Laut- und Silbenwiederholungen, Dehnungen und Pausen äußert. Die Arbeit unterscheidet zwischen entwicklungsbedingtem Stottern (oft vorübergehend) und chronischem Stottern (mit potenziell langfristigen Auswirkungen).
Wie entsteht Stottern?
Die Arbeit erklärt den Zusammenhang zwischen Denk- und Sprechfähigkeit und wie Diskrepanzen zwischen diesen zu Redeflussstörungen führen können. Der genaue Zusammenhang zwischen normalen Sprechunflüssigkeiten und dem Auftreten von Stottern ist jedoch noch nicht vollständig geklärt.
Welche Herausforderungen begegnen stotternden Kindern in der Kita?
Die Arbeit thematisiert die Auswirkungen von Stottern auf die soziale Interaktion und den Bildungsprozess im Kita-Alltag. Konkrete Beispiele werden jedoch im bereitgestellten Text nicht detailliert genannt.
Welche Fördermöglichkeiten gibt es für stotternde Kinder?
Die Arbeit beschreibt Fördermöglichkeiten im pädagogischen Alltag und betont die Wichtigkeit der Zusammenarbeit zwischen pädagogischen Fachkräften und Eltern. Eine positive und unterstützende Umgebung, die das Selbstbewusstsein stärkt und die Sprechfähigkeiten verbessert, steht im Mittelpunkt.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, das Verständnis für Stottern im Kindesalter zu verbessern und Handlungsempfehlungen für den Umgang mit stotternden Kindern zu liefern. Sie möchte pädagogischen Fachkräften einen Überblick über Fördermöglichkeiten geben.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt?
Die wichtigsten Schlüsselwörter sind: Stottern, Redeflussstörung, kindliche Entwicklung, Sprachentwicklung, Fördermöglichkeiten, Pädagogik, Kita, Elternarbeit, entwicklungsbedingtes Stottern, chronisches Stottern, Kommunikation.
- Citation du texte
- Aykut Reis (Auteur), 2020, Die Redefluss-Störung Stottern im Kindesalter. Welche Fördermöglichkeiten gibt es?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/922315