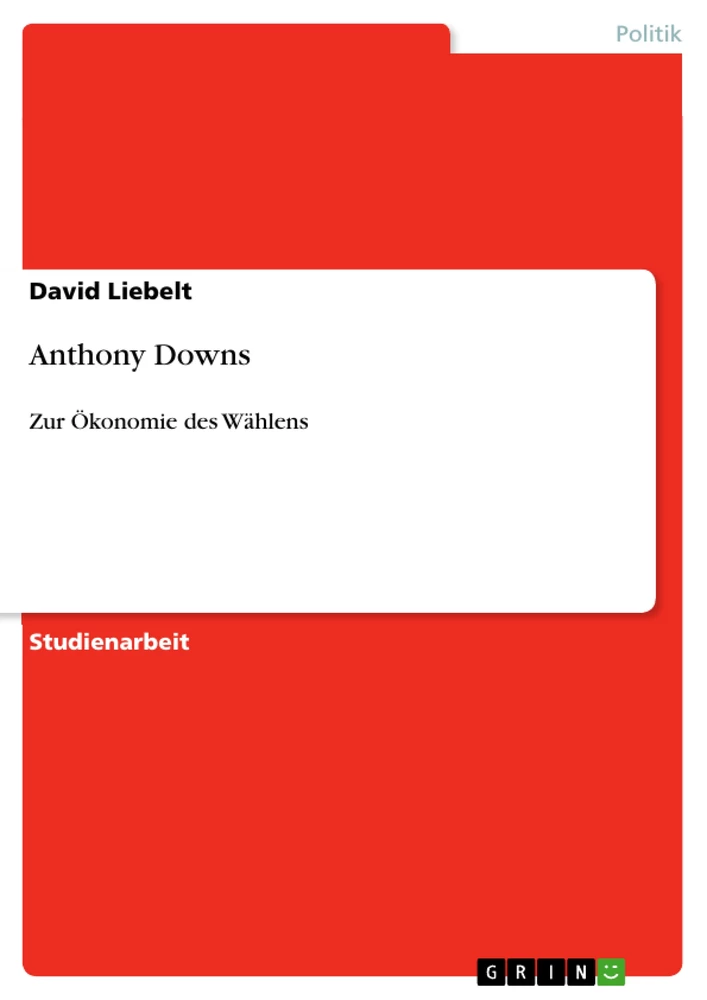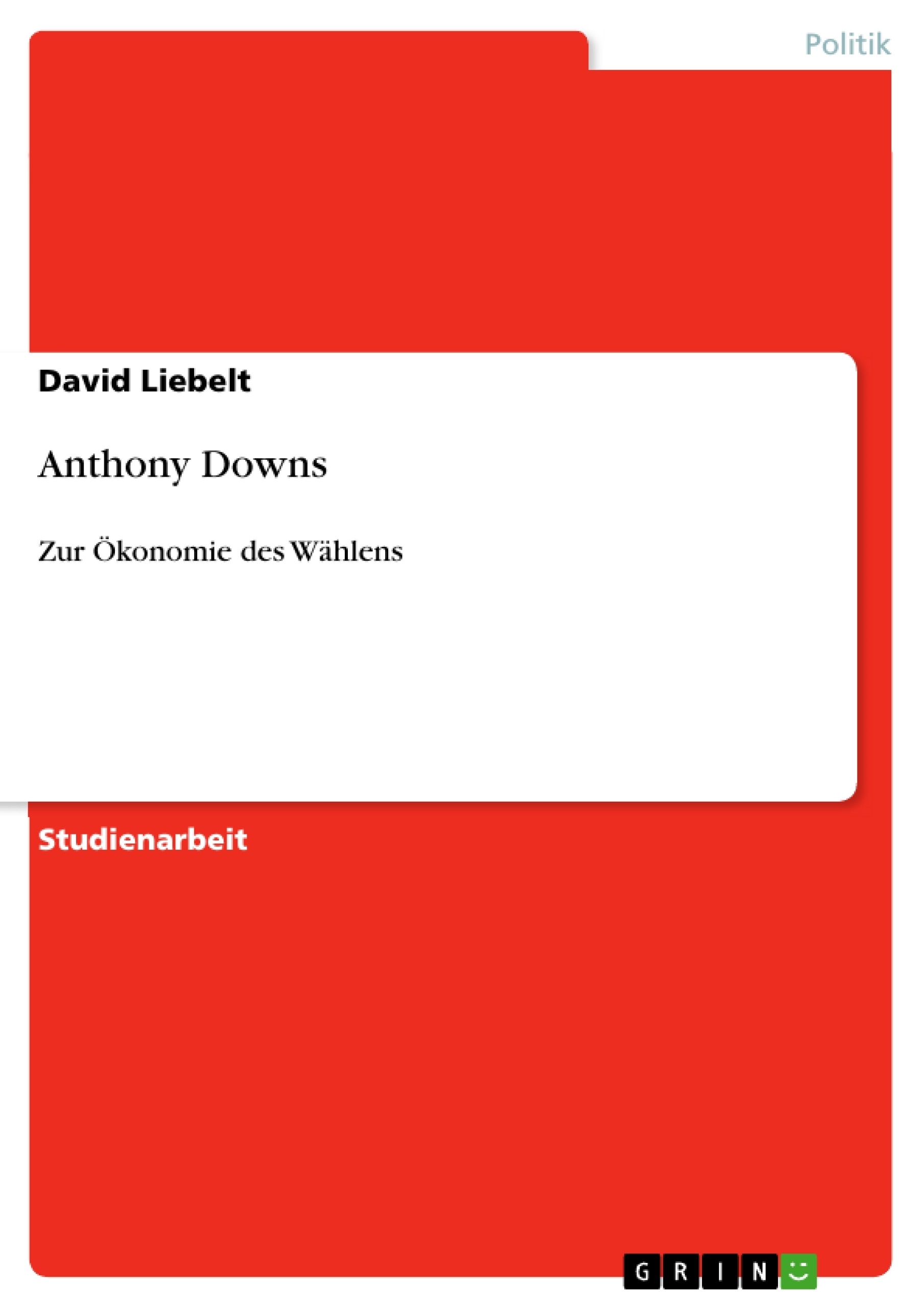Die Empörung war groß, als Richard von Weizäcker in seiner Eigenschaft als deutscher Bundespräsident 1992 den Parteien und Politkern vorwarf, „(…) machtversessen auf den Wahlsieg und machtvergessen bei der Wahrnehmung der inhaltlichen und konzeptionellen politischen Führungsaufgabe“ zu sein. Und spätestens seit der CDU-Spendenaffäre dürfte deutlich sein, dass das auch stimmt. Liest man Anthony Downs „An Economic Theory of Democracy” wird schnell deutlich, dass es sich hier nicht um eine anachronistische These aus den Anfängen moderner Politikwissenschaft handelt, sondern diese Schrift einen funda-mentalen staatsrechtlichen Grundsatz falsifiziert: „Die durch das Amt definierte und disziplinierte Staatsgewalt richtet sich ausschließlich aus auf das Wohl des staatlich verfaßten Volkes (...). Sie ist resistent gegen den Eigennutz der Amtsinhaber wie gegen Gruppen-interessen (...).“ Eine Aussage, die ins Zentrum der Überlegungen des amerikanische Wirtschafts- und Politikwissenschaftler Downs geht, der mit seinem Modell rationales Verhalten in der Politik - freilich von einem ökonomischen Standpunkt aus - zu erklären versucht.
Um jedoch Downs Argumentation folgen zu können und seine Schlüsse zu verstehen, ist es nötig, sich zunächst mit den Annahmen zu befassen, die seinen Modellen zu Grunde liegen. So gilt seine 1957 publizierte Schrift “An Economic Theory of Democracy” als eine der grundlegenden Beiträge in der Rational-Choice-Forschung. In seinem Buch untersucht er, wie sich Wähler und Parteien verhalten, wenn man sie als Anbieter und Nachfrager betrachtet. Downs selbst schreibt in der Einleitung zu seinem Text, er wolle „Verhaltensregeln für eine demokratische Regierung“ aufstellen, da bis zu dem Zeitpunkt der Niederschrift seiner Arbeit noch niemand derartige Regeln verfasst habe, sich jedoch schon viele mit dem Verhalten von Konsumenten und Produzenten beschäftigt hätten. Hier sieht Downs ein Defizit, welches er beheben möchte, jedoch ohne vorzugeben alle Probleme lösen zu können. Bereits zu Beginn der „Ökonomischen Theorie der Demokratie“ legt Downs das Ziel seiner Untersuchung eindeutig fest: „Die vorliegende Arbeit ist ein Versuch, derartige [Anm.: generalisierte und doch realistische] Verhaltensregeln für eine demokratische Regierung aufzustellen und die durch sie implizierten Schlussfolgerungen zu entwickeln.“
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- II. Rational-Choice-Theorie
- III. Die ökonomische Theorie der Demokratie
- IV. Die Grenzen der Rational-Choice-Theorie
- V. Das Paradox des Nichtwählens
- VI. Lösungsansätze des Wahlparadoxons
- VI.I. Anthony Downs
- VI.II. William Riker und Peter Ordeshook
- VI.III. Thomas R. Palfrey und Howard Rosenthal
- VI.IV. Alexander Schuessler, Geoffrey Brennan und Loren Lomasky
- VII. Resümee
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit Anthony Downs' „An Economic Theory of Democracy" und analysiert die zentrale These der Falsifizierung des staatsrechtlichen Grundsatzes, dass die Staatsgewalt ausschließlich dem Wohl des Volkes dienen soll. Downs argumentiert, dass in der demokratischen Politik Akteure aus ökonomischer Sicht rational handeln, d.h. ihren eigenen Nutzen maximieren.
- Die Grundannahmen der Rational-Choice-Theorie und ihre Anwendung auf das Wahlverhalten von Wählern und Parteien
- Die Kernpunkte der „Ökonomischen Theorie der Demokratie“ und ihre Implikationen für das Verständnis von politischem Verhalten
- Die Grenzen der Rational-Choice-Theorie und die Kritik am Modell von Downs
- Das Paradox des Nichtwählens und verschiedene Lösungsansätze
- Die Relevanz der Downschen Theorie für die heutige politische Diskussion
Zusammenfassung der Kapitel
- I. Einleitung: Die Einleitung stellt die Forschungsfrage und das zentrale Argument der Arbeit vor: die Falsifizierung des staatsrechtlichen Grundsatzes der Staatsgewalt durch Downs' ökonomische Theorie der Demokratie.
- II. Rational-Choice-Theorie: Dieses Kapitel erläutert die Grundannahmen der Rational-Choice-Theorie, die dem Modell von Downs zugrunde liegt. Die Theorie geht von einem rational handelnden homo oeconomicus aus, der seine Entscheidungen immer unter dem Aspekt der eigenen Nützlichkeit trifft.
- III. Die ökonomische Theorie der Demokratie: Dieses Kapitel stellt Downs' Theorie vor und analysiert, wie Wähler und Parteien als Anbieter und Nachfrager in einem Marktmodell agieren. Downs argumentiert, dass Wähler ihre Stimme als Preis für politische Leistungen sehen und Parteien diese Leistungen anbieten, um Wählerstimmen zu gewinnen.
- IV. Die Grenzen der Rational-Choice-Theorie: Dieses Kapitel diskutiert die Grenzen der Rational-Choice-Theorie und zeigt Schwächen und Kritikpunkte am Modell von Downs auf.
- V. Das Paradox des Nichtwählens: Das Paradox des Nichtwählens stellt die Frage, warum Menschen wählen gehen, obwohl ihr individueller Einfluss auf das Wahlergebnis gering ist. Downs argumentiert, dass es verschiedene Faktoren gibt, die den Wahlgang motivieren.
- VI. Lösungsansätze des Wahlparadoxons: In diesem Kapitel werden verschiedene Lösungsansätze zum Paradox des Nichtwählens vorgestellt, die auf Downs' Theorie aufbauen. Die Lösungsansätze betrachten verschiedene Aspekte, wie z.B. die Rolle von politischem Engagement, der Einfluss von Medien und sozialen Normen auf das Wahlverhalten.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit zentralen Themen der Politischen Theorie, wie dem Rational-Choice-Ansatz, der ökonomischen Theorie der Demokratie und dem Paradox des Nichtwählens. Zu den zentralen Begriffen gehören: homo oeconomicus, Nutzenmaximierung, Wahlverhalten, politische Partizipation, Macht und Einfluss, politische Ökonomie, Demokratie, Wahlparadoxon, Rationalität.
Häufig gestellte Fragen
Was ist die Kernaussage von Anthony Downs' ökonomischer Theorie?
Downs betrachtet Politik als einen Markt. Parteien handeln wie Unternehmer, die politische Programme anbieten, um Wählerstimmen zu maximieren, während Wähler ihren Nutzen maximieren wollen, indem sie die Partei wählen, die ihnen die meisten Vorteile verspricht.
Was versteht Downs unter dem „homo oeconomicus“ in der Politik?
Dies ist das Modell eines rational handelnden Akteurs, der Entscheidungen basierend auf einer Kosten-Nutzen-Analyse trifft. In der Demokratie bedeutet dies, dass politische Akteure primär ihren eigenen Vorteil (Macht, Einfluss) suchen.
Was ist das Paradox des Nichtwählens?
Es beschreibt die Frage, warum rationale Wähler überhaupt wählen gehen, da die Kosten (Zeit, Aufwand) oft höher sind als der minimale Einfluss der einzelnen Stimme auf das Gesamtergebnis.
Falsifiziert Downs das Ideal des Gemeinwohls?
Ja, Downs argumentiert, dass politische Entscheidungen nicht primär aus Sorge um das Gemeinwohl getroffen werden, sondern um Wählerstimmen zu gewinnen und die eigene Macht zu sichern.
Welche Rolle spielt die Rational-Choice-Theorie bei Downs?
Die Rational-Choice-Theorie bildet das fundamentale Gerüst. Sie geht davon aus, dass individuelles Verhalten durch rationale Wahlmöglichkeiten erklärt werden kann, was Downs konsequent auf das Verhalten von Wählern und Parteien überträgt.
- Citar trabajo
- David Liebelt (Autor), 2007, Anthony Downs, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/92299