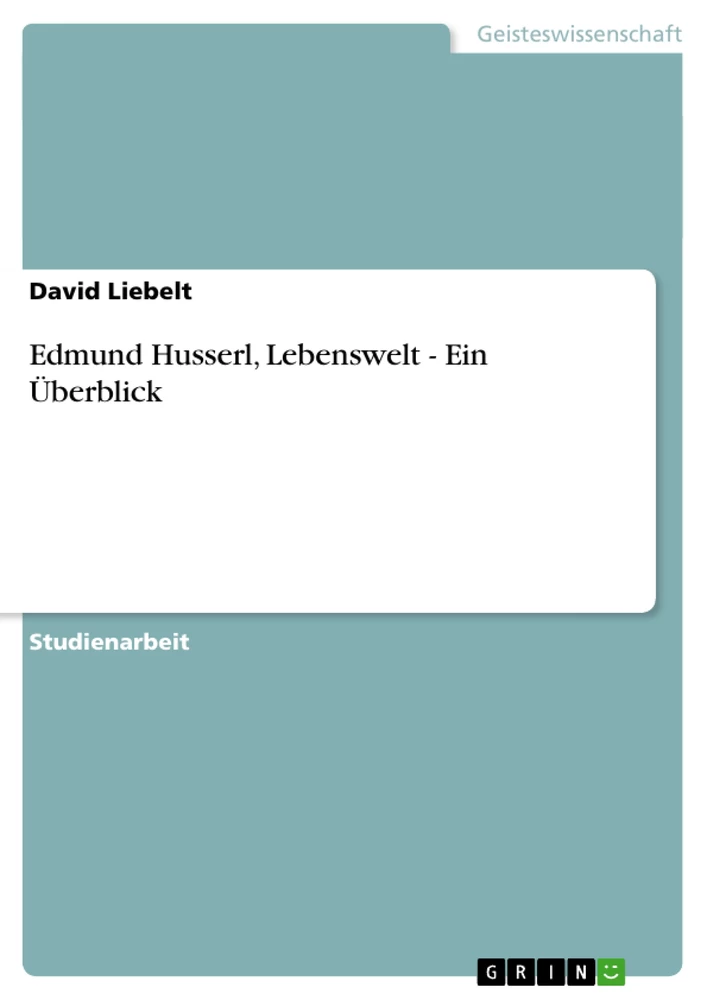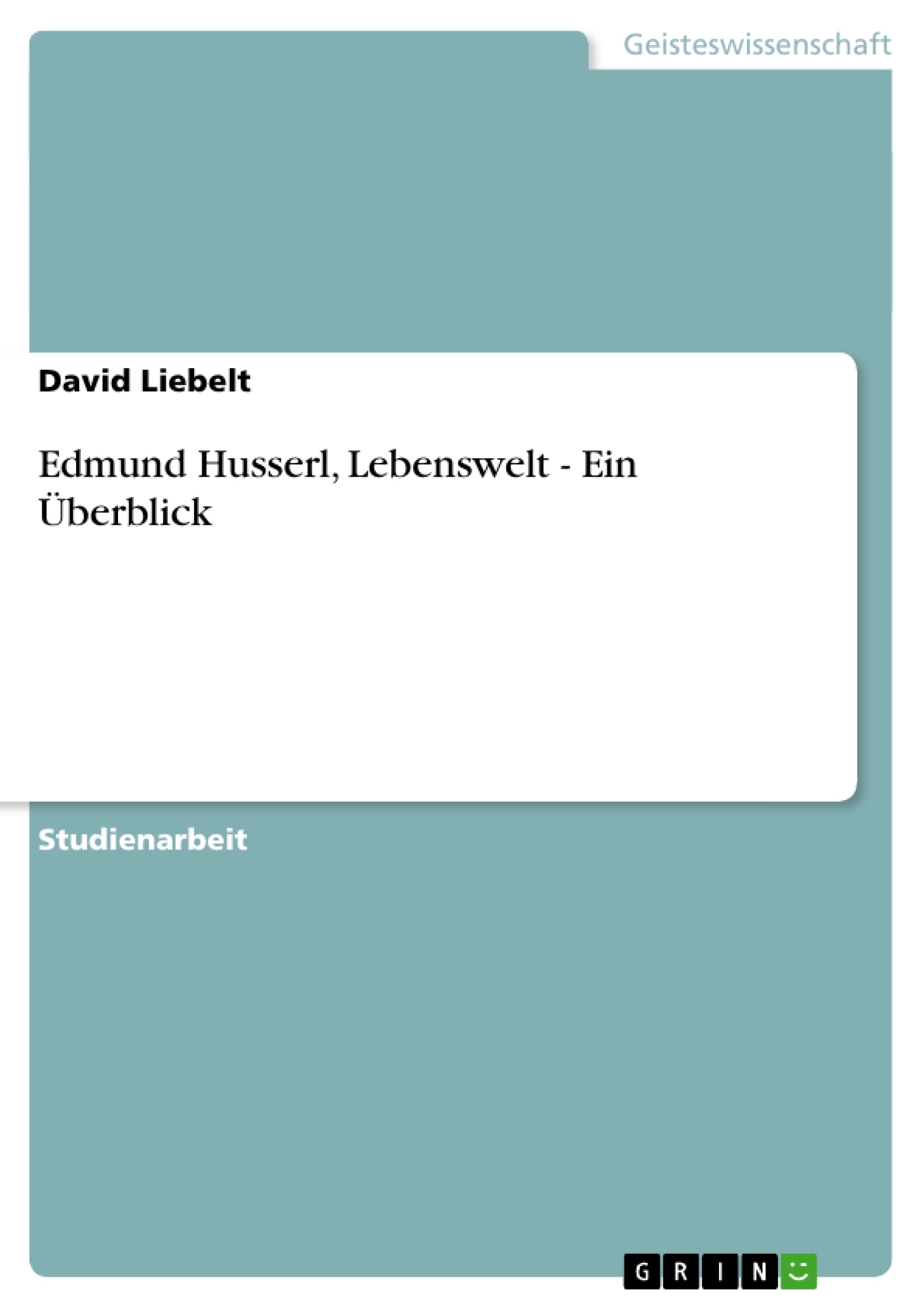Die Philosophie ist nach Husserl Anfangs- und Endpunkt der abendländischen Geschichte im Sinne einer Teleologie. Dazu aber musste – nach all den Urstiftungen seit Griechenland eine weitere und in ihrem Sinne nach endgültige Entwicklungsstufe als eine feste theoretische Grundlage weiterer Forschungen gefunden werden: und zwar die Phänomenologie in ihrer Form als Methodik und Endstiftung. Bis dato nämlich war der Forschungstrieb geradezu spiralförmig in eine sich ständig vertiefende Krise geraten, da sich die neuzeitliche Wissenschaft ihre methodische Reinheit als eine konsequente mathematische Idealisierung der Objektivität zum Preis der Subjektvergessenheit erkaufte. Die Folgen waren Skeptizismus und Psychologismus, die Husserl leidenschaftlich bekämpfte und seinem Programm einer universalen und reinen Geisteswissenschaft entgegensetzte – ein Vorhaben, das die Kluft zwischen den Natur- und Geisteswissenschaften überbrücken und das Fundament für eine endgültige wissenschaftliche Seins-Erklärung legen sollte. Husserl zeigt hierin auf, dass das Wesen der Naturwissenschaft, d.h. das Wesen des forschenden Geistes eine Wissenschaft vom Geist bedingt, und dass nur der Geist in seiner Emanzipation wahrhaft methodisch-wissenschaftlich und rational erforscht werden kann. Nach diesem Beginnen erfüllt sich die ursprüngliche Intention der theoretischen Einstellung als deren Ausgangspunkt zur Überwindung der gegenwärtigen Krise in der Thematisierung der Lebenswelt als des unabdingbaren Rahmens aller objektivierenden Aktivitäten der Naturwissenschaftler. Diesem Ansinnen soll nun auch in der Seminararbeit Folge geleistet werden – insofern sich durch die Analyse und Besprechung des Husserlschen Lebenswelt-Themas und der ihm inne seienden eigenen Rationalitätsformen das Schaffen Husserls in seinen Schwerpunkten in einem ersten Ausblick wenigstens skizzenhaft zu zeigen vermag. Denn die Lebenswelt-Theorie hat in der Krisis' derart die Funktion, dass „Husserl von der Lebenswelt aus das Hauptanliegen seines Philosophierens, die Durchführung der transzendentalen Reduktion, als aus der Geschichte des Denkens gefordert und als durch die (durch die Wissenschaft geprägte) Gegebenheitsweise der modernen Erfahrungswelt motiviert, vollenden (kann).
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- II. Begriffsunklarheit
- III. Der Ausgangspunkt: Die natürliche Einstellung
- IV. Das Problem: Lebenswelt und Krisis
- V. Die Lösung: Aufhebung der Lebenswelt-Vergessenheit
- VI. Vorgehensweise: Nachvollzug der neuzeitlichen Naturwissenschaft
- VII. Vorgehensweise: phänomenologische Epoché
- VIII. Resümee
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit befasst sich mit Edmund Husserls Konzept der Lebenswelt. Ziel ist es, Husserls Verständnis der Lebenswelt zu analysieren und dessen Relevanz, insbesondere für den Schulunterricht, aufzuzeigen. Die Arbeit untersucht die Entstehung und Bedeutung des Lebenswelt-Begriffes im Kontext der Krise der neuzeitlichen Wissenschaft und zeigt, wie Husserl die Lebenswelt als Grundlage für eine transzendentale Phänomenologie versteht.
- Der Begriff der Lebenswelt bei Husserl und seine begriffliche Unklarheit
- Die natürliche Einstellung und ihr Verhältnis zur Lebenswelt
- Die Krise der neuzeitlichen Wissenschaft und die Rolle der Lebenswelt in ihrer Überwindung
- Die phänomenologische Epoché als Methode zur Erforschung der Lebenswelt
- Die Relevanz der Lebenswelt-Theorie für die Philosophie und den Schulunterricht
Zusammenfassung der Kapitel
I. Einleitung: Die Einleitung stellt Husserls Phänomenologie als Antwort auf eine Krise der neuzeitlichen Wissenschaft dar, die durch Subjektvergessenheit und Idealisierung gekennzeichnet ist. Husserls Projekt zielt auf die Entwicklung einer universellen Geisteswissenschaft, die die Kluft zwischen Natur- und Geisteswissenschaften überbrücken soll. Die Lebenswelt wird als Ausgangspunkt für die Überwindung dieser Krise und als unabdingbarer Rahmen aller wissenschaftlichen Aktivitäten vorgestellt. Die Arbeit skizziert die Analyse des Husserlschen Lebenswelt-Themas und seine Relevanz für den Schulunterricht.
II. Begriffsunklarheit: Dieses Kapitel thematisiert die begriffliche Unklarheit des Terminus „Lebenswelt“, da Husserl den Begriff nicht neu prägte und auch in seinem eigenen Werk keine konsistente Verwendung des Begriffs feststellbar ist. Die Vieldeutigkeit des Begriffs wird als ein Faktor für seine Verbreitung in verschiedenen Disziplinen und der Alltagssprache analysiert. Das Kapitel beleuchtet verschiedene Definitionen und Interpretationen der Lebenswelt, um zu einer präziseren Beschreibung des Begriffs zu gelangen. Husserls frühe, unpräzise Definition der Lebenswelt als „natürliche Welt“ wird diskutiert und mit dem Konzept der „natürlichen Einstellung“ in Verbindung gebracht.
III. Der Ausgangspunkt: Die natürliche Einstellung: Dieses Kapitel widerlegt die Fehlinterpretation, die Lebenswelt sei eine späte Kehrtwende in Husserls Denken. Es wird argumentiert, dass die Überlegungen zur Lebenswelt bereits in seinen frühen Werken angelegt sind und eng mit dem Übergang von der natürlichen zur philosophischen Einstellung verbunden sind. Die natürliche Einstellung beschreibt den Umgang mit Objekten im alltäglichen Leben, die als dienlich oder irrelevant für die Lebensgestaltung empfunden werden. Die Welt der natürlichen Einstellung wird als die Lebenswelt des Subjekts definiert, die Husserl auch als „Umwelt“ bezeichnet.
Schlüsselwörter
Lebenswelt, Phänomenologie, Edmund Husserl, natürliche Einstellung, transzendentale Reduktion, Krise der neuzeitlichen Wissenschaft, Geisteswissenschaft, Naturwissenschaft, methodische Reinheit, Subjektvergessenheit.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Husserls Konzept der Lebenswelt
Was ist der Gegenstand dieser Seminararbeit?
Diese Seminararbeit analysiert Edmund Husserls Konzept der Lebenswelt und untersucht dessen Relevanz, insbesondere für den Schulunterricht. Sie beleuchtet die Entstehung und Bedeutung des Lebenswelt-Begriffes im Kontext der Krise der neuzeitlichen Wissenschaft und zeigt, wie Husserl die Lebenswelt als Grundlage für eine transzendentale Phänomenologie versteht.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Schwerpunktthemen: den Begriff der Lebenswelt bei Husserl und seine begriffliche Unklarheit; das Verhältnis zwischen natürlicher Einstellung und Lebenswelt; die Krise der neuzeitlichen Wissenschaft und die Rolle der Lebenswelt in ihrer Überwindung; die phänomenologische Epoché als Methode zur Erforschung der Lebenswelt; und die Relevanz der Lebenswelt-Theorie für die Philosophie und den Schulunterricht.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit ist in acht Kapitel gegliedert: Einleitung, Begriffsunklarheit, Der Ausgangspunkt: Die natürliche Einstellung, Das Problem: Lebenswelt und Krisis, Die Lösung: Aufhebung der Lebenswelt-Vergessenheit, Vorgehensweise: Nachvollzug der neuzeitlichen Naturwissenschaft, Vorgehensweise: phänomenologische Epoché, und Resümee. Jedes Kapitel wird in der Zusammenfassung der Kapitel detailliert beschrieben.
Was ist die Bedeutung der "natürlichen Einstellung" im Kontext von Husserls Lebenswelt?
Die natürliche Einstellung beschreibt den alltäglichen Umgang mit Objekten. Die Welt der natürlichen Einstellung wird als die Lebenswelt des Subjekts definiert, die Husserl auch als „Umwelt“ bezeichnet. Die Arbeit widerlegt die Fehlinterpretation, dass die Lebenswelt eine späte Kehrtwende in Husserls Denken sei, und argumentiert, dass die Überlegungen zur Lebenswelt bereits in seinen frühen Werken angelegt sind und eng mit dem Übergang von der natürlichen zur philosophischen Einstellung verbunden sind.
Wie wird die begriffliche Unklarheit des Terminus "Lebenswelt" behandelt?
Das Kapitel "Begriffsunklarheit" thematisiert die Vieldeutigkeit des Begriffs "Lebenswelt", da Husserl den Begriff nicht neu prägte und auch in seinem eigenen Werk keine konsistente Verwendung des Begriffs feststellbar ist. Die Vieldeutigkeit wird als ein Faktor für seine Verbreitung in verschiedenen Disziplinen und der Alltagssprache analysiert. Verschiedene Definitionen und Interpretationen der Lebenswelt werden beleuchtet, um zu einer präziseren Beschreibung zu gelangen. Husserls frühe, unpräzise Definition der Lebenswelt als „natürliche Welt“ wird diskutiert und mit dem Konzept der „natürlichen Einstellung“ in Verbindung gebracht.
Welche Rolle spielt die Krise der neuzeitlichen Wissenschaft in Husserls Konzept?
Husserls Phänomenologie wird als Antwort auf eine Krise der neuzeitlichen Wissenschaft dargestellt, die durch Subjektvergessenheit und Idealisierung gekennzeichnet ist. Sein Projekt zielt auf die Entwicklung einer universellen Geisteswissenschaft, die die Kluft zwischen Natur- und Geisteswissenschaften überbrücken soll. Die Lebenswelt wird als Ausgangspunkt für die Überwindung dieser Krise und als unabdingbarer Rahmen aller wissenschaftlichen Aktivitäten vorgestellt.
Welche Schlüsselbegriffe sind zentral für das Verständnis der Arbeit?
Zentrale Schlüsselbegriffe sind: Lebenswelt, Phänomenologie, Edmund Husserl, natürliche Einstellung, transzendentale Reduktion, Krise der neuzeitlichen Wissenschaft, Geisteswissenschaft, Naturwissenschaft, methodische Reinheit, Subjektvergessenheit.
Welche Relevanz hat Husserls Lebenswelt-Konzept für den Schulunterricht?
Die Arbeit untersucht die Relevanz von Husserls Lebenswelt-Konzept explizit für den Schulunterricht, ohne jedoch konkrete didaktische Vorschläge zu liefern. Die Relevanz ergibt sich aus der grundlegenden Auseinandersetzung mit der menschlichen Erfahrung und der Weltwahrnehmung, welche für das Verständnis von Bildungsprozessen essentiell sind.
- Quote paper
- David Liebelt (Author), 2007, Edmund Husserl, Lebenswelt - Ein Überblick, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/92323