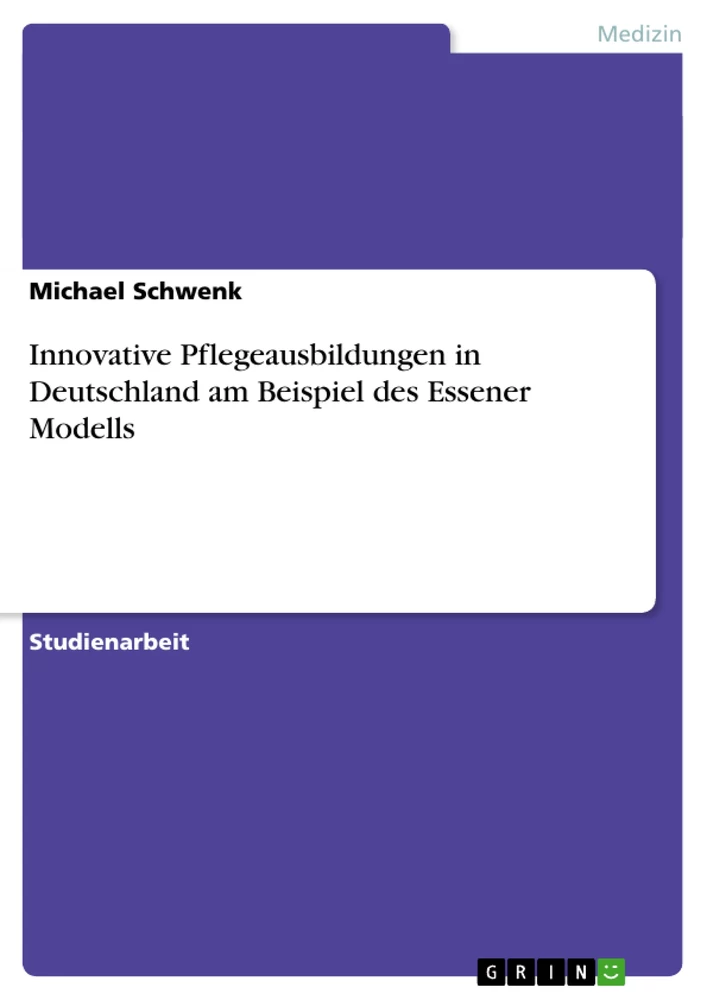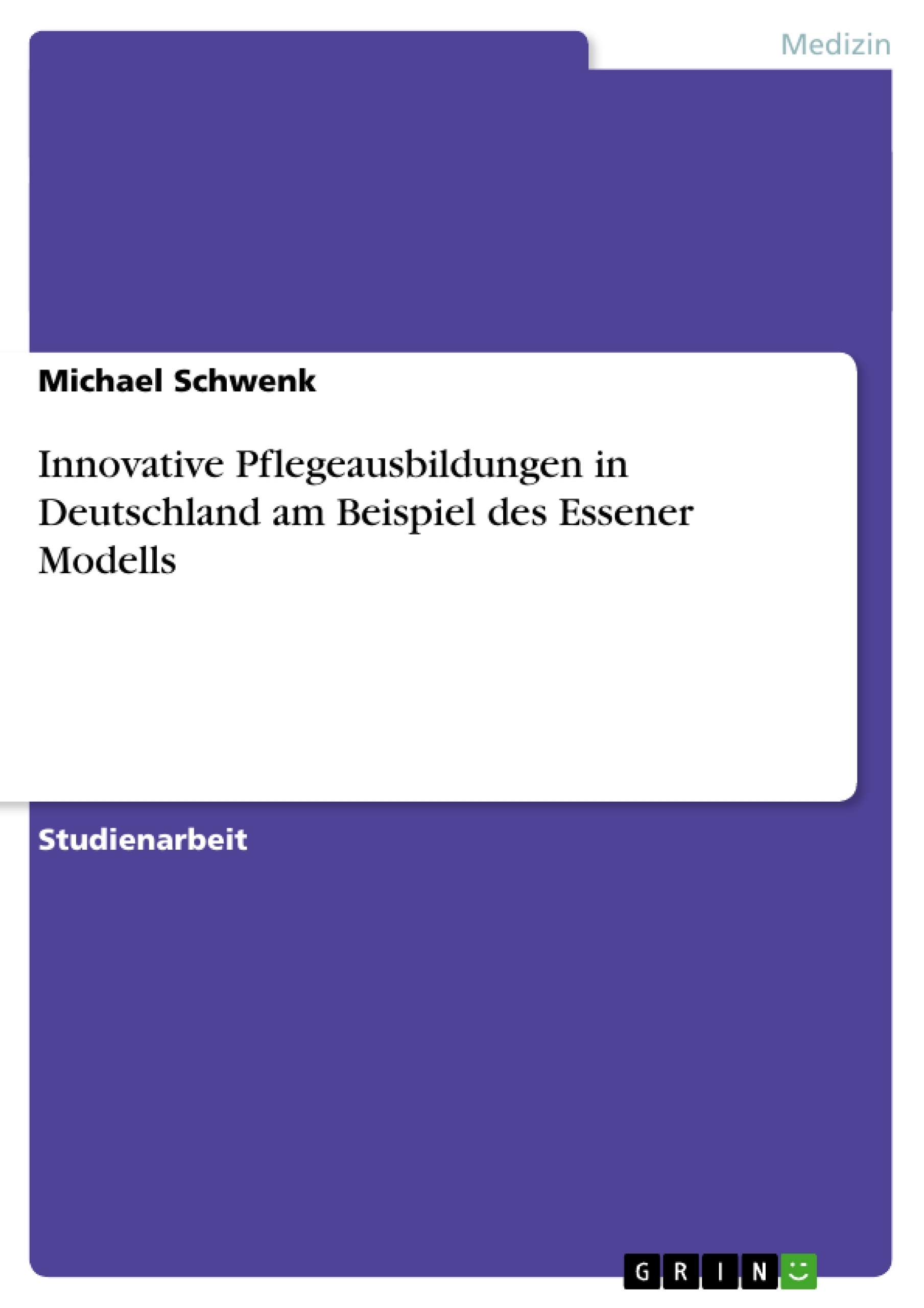Seit etwa Mitte der 80er Jahre gibt es viele unterschiedliche Überlegungen, die Pflegeausbildung in Deutschland weiterzuentwickeln. Diese Bemühungen haben eine Intention gemeinsam, nämlich die klassische Trennung der Ausbildung in Kinderkrankenpflege, Altenpflege und Krankenpflege ganz oder teilweise aufzuheben (vgl. Görres et al. S. 2001).
Ausgangspunkt für diese Weiterentwicklungen sind die veränderten Rahmenbedingungen, unter denen Pflege stattfindet. Hierunter lässt sich der demografische Wandel der Gesellschaft, die gesteigerte Nachfrage nach Pflege, Beratung und Betreuung, die Bedeutungszunahme von Prävention, Rehabilitation und Gesundheitsförderung durch den Wandel des Gesundheitsspektrums sowie die wachsende Zahl verwirrter oder gerontopsychiatrisch beeinträchtigter Menschen aufführen (vgl. Görres et al. S.49). Dies bildet ein neues Anforderungsprofil für Pflegende, an dem die Pflegeausbildung sich neu orientieren muss.
Mit der Reform der Pflegeausbildung soll u.a. Qualifikationsunterschiede beseitigt sowie die horizontale und vertikale Durchlässigkeit für Pflegekräfte erhöht werden.
Um eine vertikale Durchlässigkeit zu schaffen, ist es notwendig, zusätzliche Angebote, in denen ergänzend zum Berufsabschluss die Fachoberschulreife bzw. die fachgebundene Hochschulreife, die man beispielsweise im Rahmen der integrativen Ausbildung in Marburg erwerben kann, zu schaffen. Noch wichtiger für die Pflege ist allerdings die horizontale Durchlässigkeit zwischen Kranken-, Kinderkranken- und Altenpflege und eine damit einhergehende gemeinsame Grundausbildung, die das Überwechseln im Zuge beruflicher Mobilität erleichtern würde und eine „wesentliche Grundlage zur Entwicklung von übergreifenden klientenorientierten Pflegekonzepten in der Praxis, als auch im Rahmen von Forschung und Lehre“ (Uhl 2003, S.6) darstellt.
Dieses Referat soll im ersten Teil einen kurzen Überblick über einige innovative und beispielhafte Ausbildungsmodelle in der Pflege geben. Im Anschluss daran wird der Modellausbildungsgang „Gemeinsame Grundausbildung“ des Caritasverbandes EssenEssen unter Leitung von Frau Prof. Dr. Uta Oelke vorgestellt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Verschiedene Ausbildungsmodelle in Deutschland
- Integrierte Ausbildungen wie z.B. in Essen (1997-2000)
- Integrative Ausbildung, z.B. in Stuttgart.
- Generalistische Ausbildungen z.B. in Berlin (2004-2007)
- Der Modellversuch „Gemeinsame Grundausbildung in der Alten-, Kranken- und Kinderkrankenpflege“
- Beschreibung des Modellversuchs
- Ausbildungsziele
- Stufenaufbau
- Wechselmöglichkeit,
- Praktische Ausbildung
- Leistungsüberprüfung
- Evaluation des Modellversuchs
- Entwicklung des Curriculums
- Erste Phase: Entwicklung eines Testcurriculums
- Dritte Phase: Überarbeitung
- Konstruktion des Curriculums
- Konstruktionsmerkmal Offenheit
- Konstruktionsmerkmal Fächerintegration
- Erfahrungsorientierung
- Umsetzung des Curriculums
- Das Curriculum in seiner Grobstruktur
- Kritikpunkte am Curricum und seiner Evaluation
- Pflegetheoretischer Bezug
- Evaluation
- Schlüsselqualifikationen
- Gemeinsame Inhalte
- Prävention und Gesundheitsförderung
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Das Referat widmet sich der Weiterentwicklung der Pflegeausbildung in Deutschland, insbesondere am Beispiel des Essener Modells. Es soll die Notwendigkeit einer Reform der klassischen Ausbildung in Kinderkrankenpflege, Altenpflege und Krankenpflege beleuchten, welche die traditionellen Trennung überwinden und eine patientenorientierte, generalistische Ausbildung ermöglichen soll. Das Essener Modell, als Beispiel einer integrierten Ausbildung, wird detailliert vorgestellt und analysiert.
- Reform der Pflegeausbildung in Deutschland
- Überwindung der traditionellen Trennung von Ausbildungsgängen
- Integration und Generalisierung von Pflegeberufen
- Das Essener Modell als Beispiel einer innovativen Ausbildung
- Analyse und Evaluation des Essener Modells
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung erläutert die Notwendigkeit einer Reform der Pflegeausbildung in Deutschland, die sich aus dem demografischen Wandel, der steigenden Nachfrage nach Pflege und den veränderten Anforderungen an Pflegende ergibt. Im zweiten Kapitel werden verschiedene Ausbildungsmodelle in Deutschland vorgestellt, darunter integrierte und generalistische Ausbildungen. Es wird die Entwicklung der Ausbildungsmodelle und deren Zusammenhang mit den Empfehlungen der Weltgesundheitsorganisation (WHO) und der europäischen Kommission aufgezeigt.
Das dritte Kapitel beschreibt den Modellversuch „Gemeinsame Grundausbildung in der Alten-, Kranken- und Kinderkrankenpflege“ des Caritasverbandes Essen. Es werden die Ausbildungsziele, der Stufenaufbau, die Wechselmöglichkeiten, die praktische Ausbildung und die Leistungsüberprüfung im Detail dargestellt. Die Evaluation des Modellversuchs und die Entwicklung des Curriculums werden ebenfalls beleuchtet, insbesondere die Konstruktionsmerkmale Offenheit, Fächerintegration und Erfahrungsorientierung.
Das vierte Kapitel analysiert kritisch das Curriculum und seine Evaluation. Es werden Punkte wie der pflege-theoretische Bezug, die Evaluation, die Schlüsselqualifikationen, die gemeinsamen Inhalte und die Aspekte der Prävention und Gesundheitsförderung beleuchtet.
Schlüsselwörter
Pflegeausbildung, Reform, integrierte Ausbildung, generalistische Ausbildung, Essener Modell, Caritasverband, Curriculum, Evaluation, gemeinsame Grundausbildung, Altenpflege, Krankenpflege, Kinderkrankenpflege, pflegerische Kompetenzen, demografischer Wandel, Gesundheitswesen, Prävention, Gesundheitsförderung, Schlüsselqualifikationen, Pflegetheorie, Berufsbild.
Häufig gestellte Fragen zum Essener Modell der Pflege
Was ist das Besondere am „Essener Modell“ in der Pflegeausbildung?
Es handelt sich um einen Modellversuch zur gemeinsamen Grundausbildung in der Alten-, Kranken- und Kinderkrankenpflege, um die traditionelle Trennung der Berufe aufzuheben.
Warum wurde eine Reform der Pflegeausbildung notwendig?
Gründe sind der demografische Wandel, die steigende Nachfrage nach Pflege und veränderte Anforderungen wie die Zunahme gerontopsychiatrischer Erkrankungen.
Was bedeutet „horizontale Durchlässigkeit“?
Damit ist die Möglichkeit gemeint, leichter zwischen den verschiedenen Pflegebereichen (Alten-, Kranken-, Kinderpflege) zu wechseln, basierend auf einer gemeinsamen Basisqualifikation.
Welche Konstruktionsmerkmale hat das Curriculum des Essener Modells?
Das Curriculum zeichnet sich durch Offenheit, Fächerintegration und eine starke Orientierung an der praktischen Erfahrung aus.
Wer leitete den Modellversuch in Essen?
Der Modellversuch des Caritasverbandes Essen wurde unter der Leitung von Frau Prof. Dr. Uta Oelke durchgeführt.
- Arbeit zitieren
- Michael Schwenk (Autor:in), 2005, Innovative Pflegeausbildungen in Deutschland am Beispiel des Essener Modells, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/92346