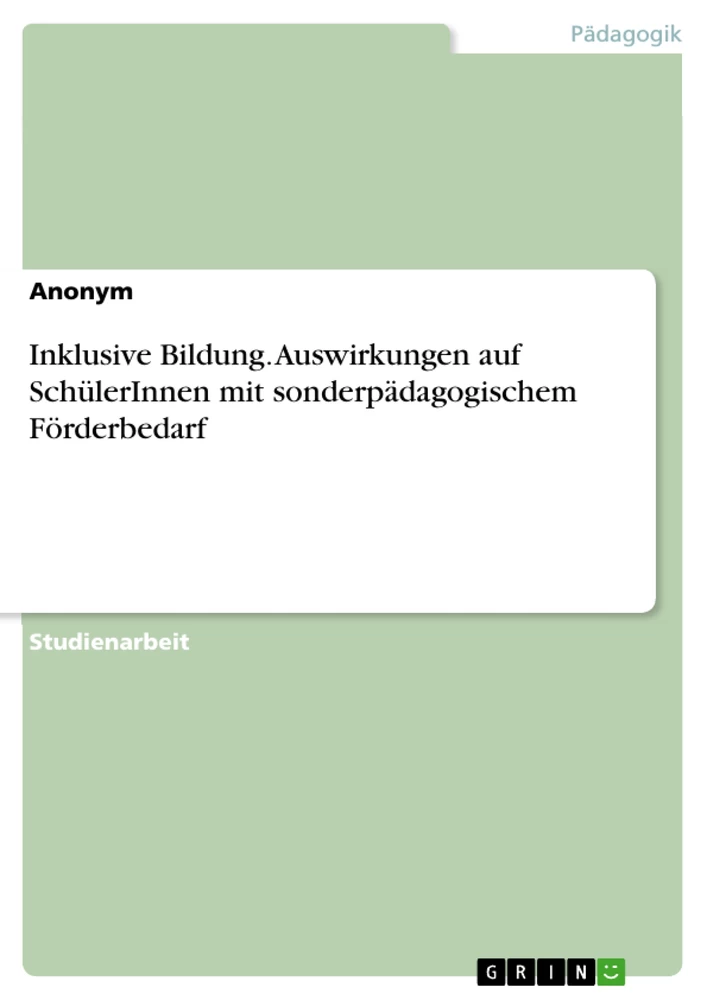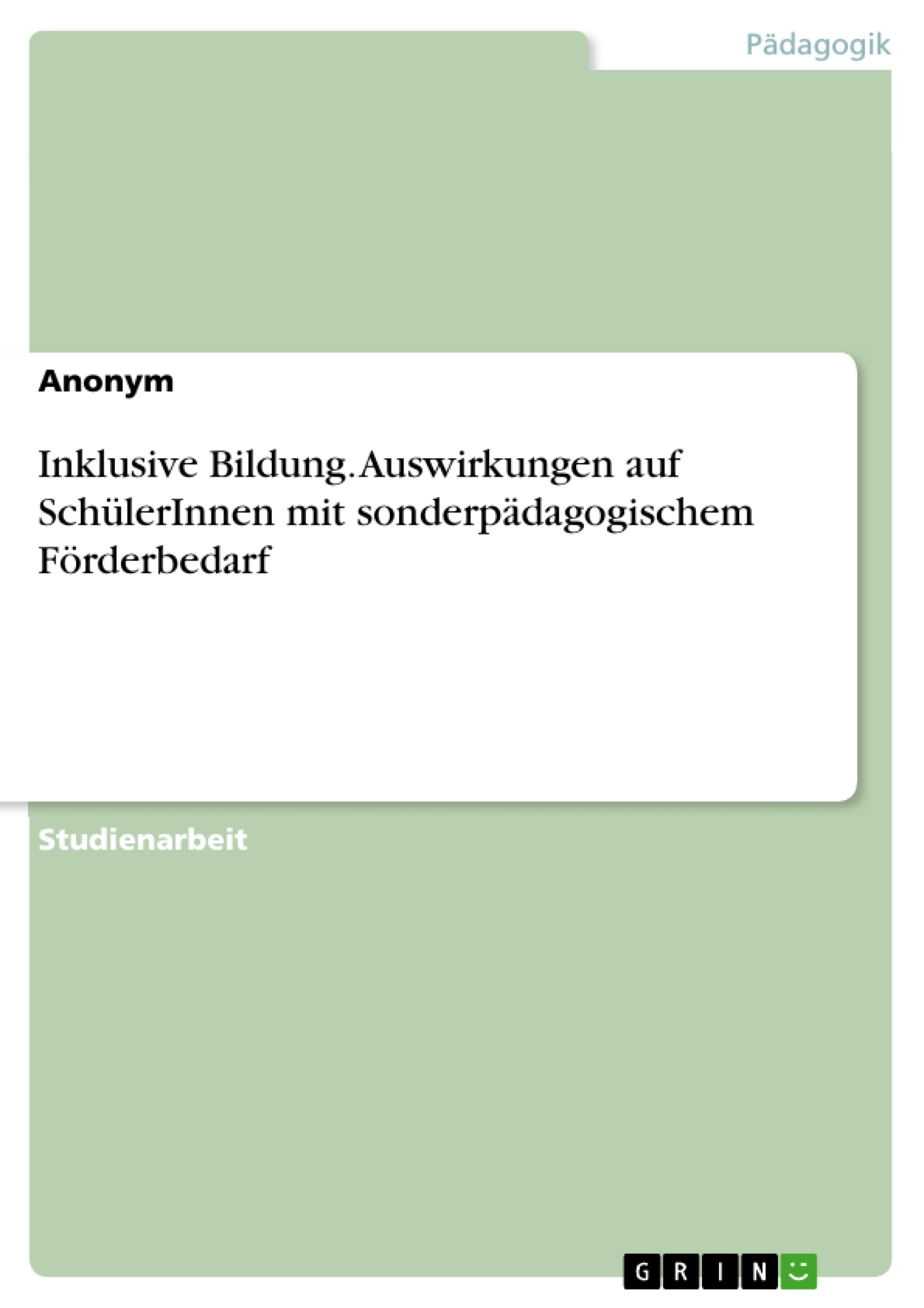In dieser Hausarbeit werden die Auswirkungen inklusiver Bildung auf die schulischen Leistungen, die soziale Partizipation und das Wohlbefinden am Beispiel von Kindern mit Förderschwerpunkt in inklusiven Schulen gehen.
Dazu werden die Ergebnisse der Längsschnittstudie „Bielefelder Längsschnittstudie zum Lernen in inklusiven und exklusiven Förderarrangements“ (BiLieF) betrachten und die Auswirkungen anhand dessen am Beispiel des Förderschwerpunkts Lernen erläutert.
Zuerst wird erklärt, was Inklusion und inklusive Bildung überhaupt bedeuten. Dabei wird es sich um die erziehungswissenschaftliche Perspektive handeln. Danach werden die Unterschiede zwischen Inklusion und Integration verdeutlicht. Im Anschluss daran, werden die Ergebnisse der Längsschnittstudie BiLieF erläutert und anschließend die Grenzen der Studie aufgezeigt. Abschließend werden die Ergebnisse der Arbeit in einem Fazit zusammengefasst.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Was ist Inklusion? Die erziehungswissenschaftliche Perspektive
- Unterschiede zwischen Integration und Inklusion
- Bielefelder Längsschnittstudie zum Lernen in inklusiven und exklusiven Förderarrangements (BiLieF)
- Womit beschäftigt sich die BiLieF?
- Methodisches Vorgehen der BiLieF
- Das akademische Selbstfähigkeitskonzept
- Schulische Leistungen
- Schulische Leistungen im Verhältnis zum FSK
- Schulisches Wohlbefinden
- Soziale Partizipation
- Streuung der Ergebnisse: Proximale Faktoren inklusiver Beschulung
- Konsequenzen für die LehrerInnenbildung
- Auswirkungen von Inklusion auf Kinder ohne Förderschwerpunkt
- Reflexion: Grenzen von BiLieF
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht die Auswirkungen inklusiver Beschulung auf SchülerInnen mit sonderpädagogischem Förderbedarf. Sie beleuchtet insbesondere die Ergebnisse der Bielefelder Längsschnittstudie zum Lernen in inklusiven und exklusiven Förderarrangements (BiLieF) und betrachtet die Entwicklung des Selbstwertgefühls, des schulischen Wohlbefindens und der Lernmotivation von Kindern mit dem Förderschwerpunkt Lernen.
- Die erziehungswissenschaftliche Perspektive auf Inklusion
- Die Unterschiede zwischen Integration und Inklusion
- Die Ergebnisse der BiLieF-Studie
- Die Auswirkungen inklusiver Beschulung auf SchülerInnen mit dem Förderschwerpunkt Lernen
- Die Grenzen der BiLieF-Studie
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt das Thema Inklusion im Kontext der UN-Konvention 2009 über die Rechte behinderter Menschen vor und verdeutlicht die historische Entwicklung des Begriffs von der Integration zur Inklusion. Das zweite Kapitel definiert Inklusion aus erziehungswissenschaftlicher Perspektive und beleuchtet die Unterschiede zwischen Integration und Inklusion.
Kapitel 3 stellt die Bielefelder Längsschnittstudie zum Lernen in inklusiven und exklusiven Förderarrangements (BiLieF) vor und erklärt, mit welchen Aspekten die Studie sich beschäftigt. Dieses Kapitel beleuchtet auch das methodische Vorgehen der Studie. Die Kapitel 4 und 5 fokussieren auf die Ergebnisse der BiLieF-Studie, wobei sie sich auf das akademische Selbstfähigkeitskonzept, schulische Leistungen, schulisches Wohlbefinden, soziale Partizipation und die Streuung der Ergebnisse durch proximale Faktoren inklusiver Beschulung konzentrieren.
Das sechste Kapitel reflektiert die Grenzen der BiLieF-Studie. Abschließend fasst das siebte Kapitel die Ergebnisse der Arbeit in einem Fazit zusammen.
Schlüsselwörter
Inklusion, Integration, Bildung, sonderpädagogischer Förderbedarf, SchülerInnen, BiLieF, Selbstwertgefühl, schulisches Wohlbefinden, Lernmotivation, Förderschwerpunkt Lernen, FSP-L, Lese- und Rechtschreibleistungen, Längsschnittstudie, differenziertes System, Dekategorisierung, Deinstitutionalisierung, Zwei-Gruppen-Theorie, Theorie der Heterogenität, identification dilemma, local dilemma, curriculum dilemma.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Unterschied zwischen Integration und Inklusion?
Integration zielt auf die Eingliederung von Individuen in bestehende Strukturen ab, während Inklusion die Struktur so verändert, dass Heterogenität die Norm ist und niemand ausgeschlossen wird.
Was untersucht die BiLieF-Studie?
Die Bielefelder Längsschnittstudie untersucht das Lernen in inklusiven und exklusiven Förderarrangements, insbesondere bei Schülern mit dem Förderschwerpunkt Lernen.
Wie wirkt sich Inklusion auf das Selbstwertgefühl aus?
Die Studie beleuchtet das akademische Selbstfähigkeitskonzept und wie die Beschulungsform die Wahrnehmung der eigenen Kompetenz bei Schülern beeinflusst.
Welche Auswirkungen hat Inklusion auf schulische Leistungen?
Die Arbeit analysiert Lese- und Rechtschreibleistungen im Verhältnis zum Förderort und zum akademischen Selbstkonzept der Kinder.
Was versteht man unter dem „Identification Dilemma“?
Es beschreibt den Konflikt zwischen der notwendigen Kategorisierung für Förderressourcen und dem Ziel der Inklusion, Stigmatisierung durch Dekategorisierung zu vermeiden.
Was sind proximale Faktoren inklusiver Beschulung?
Dies sind direkte Einflussfaktoren wie die Unterrichtsgestaltung und Lehrerbildung, die maßgeblich über den Erfolg der Inklusion entscheiden.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2020, Inklusive Bildung. Auswirkungen auf SchülerInnen mit sonderpädagogischem Förderbedarf, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/923676