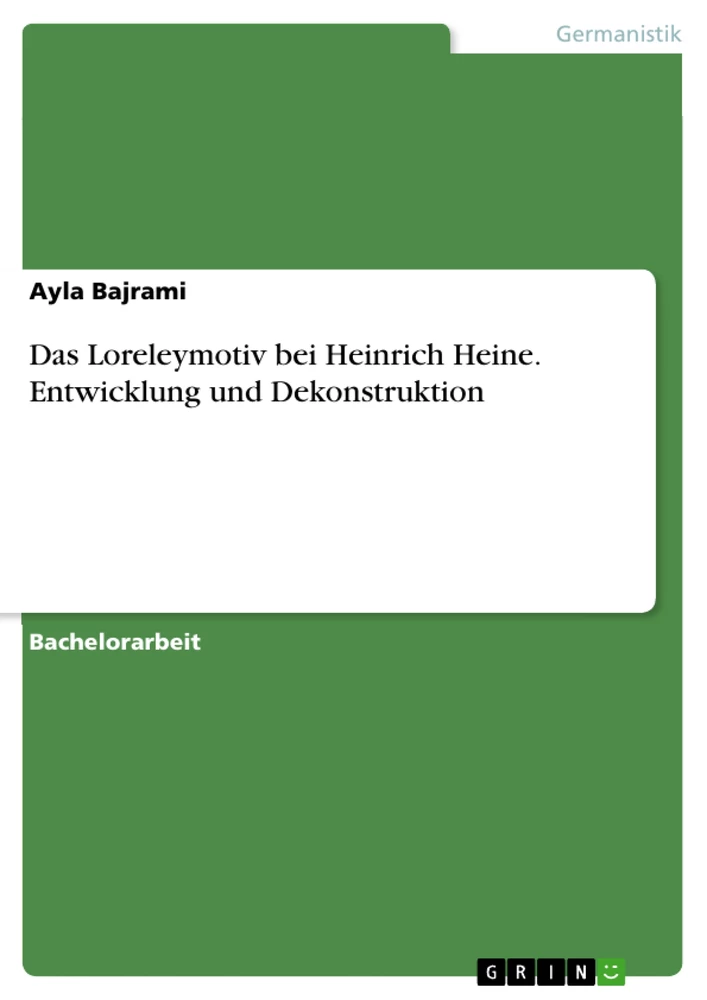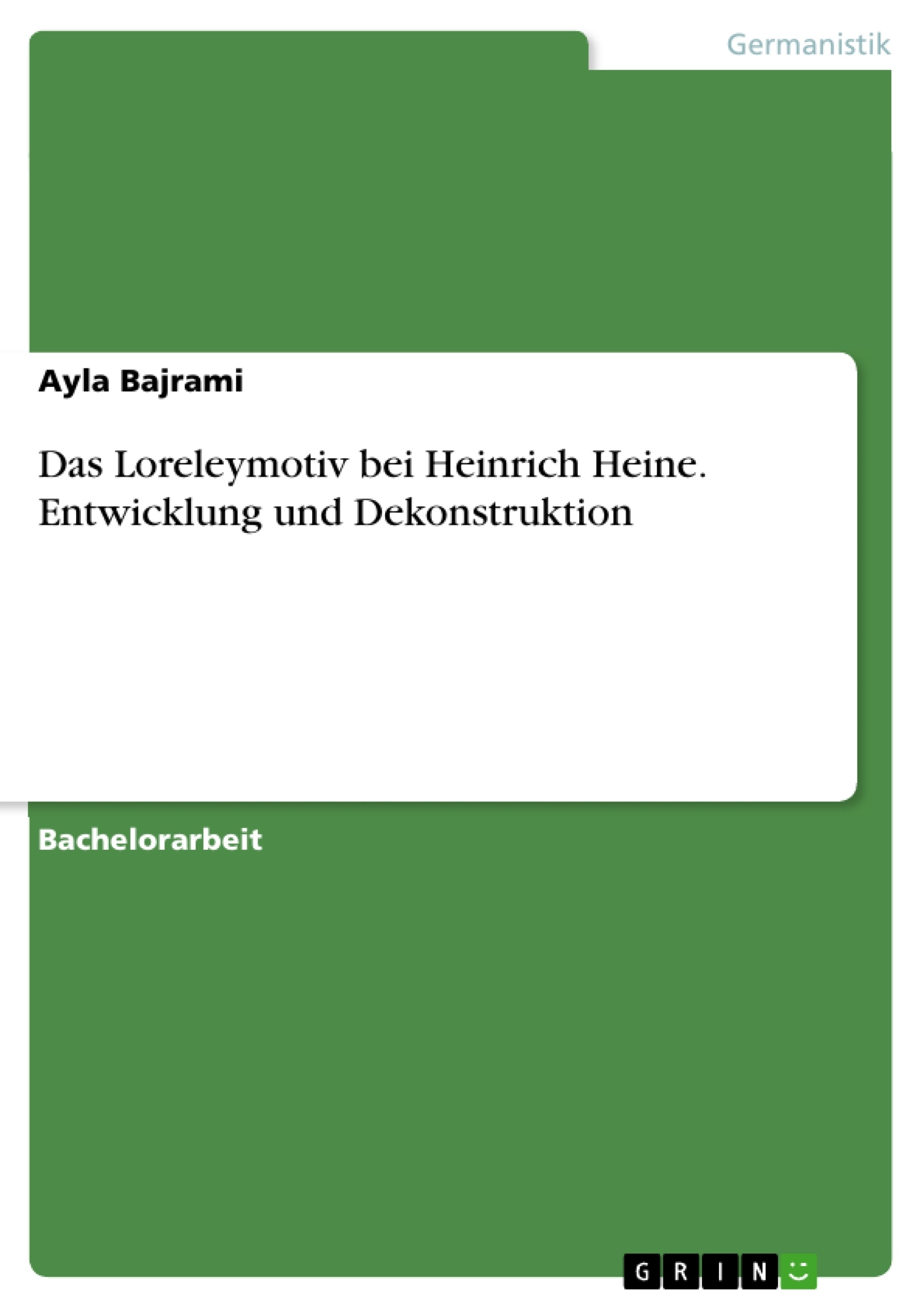Die Arbeit befasst sich mit dem Loreleymotiv in Heinrich Heines Gedichten. Konkret werden in der Arbeit zwei Fragen gestellt: Zum einen wie sich das Motiv entwickelt hat und zum anderen, inwieweit eine Dekonstruktion des Loreleymotivs im Gedicht "ich weiß nicht, was soll es bedeuten" finden lässt.
Im ersten Schritt erfolgt eine Auseinandersetzung mit der Entstehungsgeschichte der Loreleyfigur, um vor dem Hintergrund der Forschungsfrage den Wandel dieser Kunstfigur beispielhaft zu erläutern. Zudem werden epochentypische Merkmale der Loreleyfigur untersucht, um deren ambivalente Bedeutung im Zusammenhang mit der Wirkung der Loreleyfigur zu verstehen. Es ist wichtig, den romantischen Motiven Beachtung zu schenken, da sie in jeder Verarbeitung des Loreleymotivs mehr oder weniger erkennbar sind. Außerdem hilft es, die Frage zu beantworten, welchem Wandel das Loreleymotiv unterliegt und wie es sich bei Heinrich Heine aus ihrer ursprünglichen allegorischen Funktion deformiert. An dieser Stelle gehen wir der Frage nach, welche Bedeutung die epochentypischen Motive für das Auftreten der Loreley hat und welchen Ausdruck sie der Figur dadurch verleihen. Umso interessanter ergibt es sich, zu untersuchen, in welchen unterschiedlichen Verarbeitungen die Loreleyfigur auftaucht.
In dieser Arbeit wird dies durch die Beispiele von Brentanos Loreleygedichten, Eichendorffs "Waldgespräch", Heines "Ich weiß nicht, was soll es bedeuten" und Kästners "Handstand auf der Loreley" veranschaulicht und gleichzeitig wird auf deren Gemeinsamkeiten und Unterschiede hingewiesen.
Im Zentrum der Arbeit steht Heinrich Heine und sein kritisches Verhältnis zur Epoche der Romantik, das unmittelbar in Verbindung mit der Dekonstruktion des Loreleymotivs steht. Im Zuge seiner Werkphasen soll gezeigt werden, warum Heinrich Heine als Überwinder der Romantik eingestuft werden kann und wie sich dieses Phänomen in seinem literarischen Stil wiederfindet. Es wird der Frage nachgegangen, inwiefern Heines kritisches Verhältnis zum romantischen Weltbild mit der Dekonstruktion des Loreleymotivs zusammenhängt. Am Rande dieser Arbeit wird eine weitere Dekonstruktion des Loreleymotivs beispielhaft an Kästners "Handstand auf der Loreley" untersucht, um schließlich zu beantworten, ob durch die Ironisierung und Politisierung des Loreleysujets das ursprünglich klischeehafte Bild der Loreleyfigur verblasst.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einführung - eine Meerjungfrau auf dem Prüfstand
- 1.1 Ziel der Arbeit
- 1.2 Methodisches Vorgehen
- 1.3 Forschungsstand
- 2. Die Loreley – der romantische Mythos
- 2.1 Brentanos Erschaffung
- 2.1.1 Die Loreleygestalt in Zu Bacharach am Rheine
- 2.1.2 Die Loreleygestalt im Rheinmärchen
- 2.2 Ursprungsgeschichte - vom Mythos zur romantischen Kunstfigur
- 3. Die Loreley in der Romantik
- 3.1 Die verführerische Gestalt der Loreley – Attraktivität und Verführung
- 3.2 Wesensmerkmale der Loreleylandschaft - Verschmelzung von Natur und Weiblichkeit
- 3.3 Epochentypische Merkmale der Loreleyfigur
- 3.3.1 Motiv der Liebe - Einheit von Geist und Sinnlichkeit
- 3.3.2 Motiv der Nacht – Zwischenstadium und Übergang in eine andere Welt
- 3.3.3 Motiv des Todes - Auslöschung oder Vereinigung
- 3.4 Verarbeitung des Loreleymotivs in unterschiedlichen Kontexten
- 3.4.1 Eichendorffs Waldgespräch
- 3.4.2 Loreley als Nationalallegorie
- 4. Dekonstruktion des Loreleymotivs bei Heinrich Heine
- 4.1 Dekonstruktion als literarisches Mittel
- 4.2 Heinrich Heine als „entlaufener Romantiker“
- 4.3 Heines Werkphasen - Auf dem Weg zum „romantique défroqué“
- 4.4 „Ich weiß nicht, was soll es bedeuten“ (die Heimkehr, II)
- 4.4.1 Analyse und Interpretation – die Loreley als femme fatale
- 4.4.2 Die Dekonstruktion des Loreley-Motivs und die Heine´sche Ironie
- 5. Weitere Dekonstruktionen des Loreleymotivs
- 5.1 Erich Kästners Verarbeitung – Der Handstand auf der Loreley
- 5.2 Die Loreley als politisches und ironisches Sujet
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Entwicklung des Loreley-Motivs in der deutschen Literatur, insbesondere dessen Wandel vom romantischen Mythos zur dekonstruierten Figur bei Heinrich Heine. Ziel ist es, die Grundmerkmale der Loreleyfigur zu erarbeiten und deren Bedeutung in verschiedenen literarischen Kontexten zu analysieren.
- Die Entstehung und Entwicklung des Loreley-Mythos
- Die Darstellung der Loreley in der Romantik und ihre charakteristischen Merkmale
- Heines Dekonstruktion des Loreley-Motivs als Ausdruck seines kritischen Verhältnisses zur Romantik
- Weitere literarische Verarbeitungen und Interpretationen des Loreley-Motivs
- Die Veränderung der allegorischen Funktion der Loreleyfigur im Laufe der Zeit
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einführung – eine Meerjungfrau auf dem Prüfstand: Die Einleitung stellt die Loreley-Sage als ein rätselhaftes und vielschichtig interpretiertes Motiv der deutschen Literatur vor. Sie hebt die Fülle an Bearbeitungen hervor und problematisiert die Schwierigkeit, den Ursprung der romantischen Kunstfigur zu bestimmen. Heines Gedicht wird als prägend für die heutige Rezeption benannt, obwohl seine Darstellung der Loreley vom traditionellen Bild einer verführerischen Frau abweicht. Die Arbeit untersucht den Wandel der Loreleyfigur und die Bedeutung, die ihr durch unterschiedliche Verarbeitungen verliehen wird, mit dem Fokus auf Heines Dekonstruktion des Mythos.
2. Die Loreley – der romantische Mythos: Dieses Kapitel beleuchtet die Entstehungsgeschichte des Loreley-Mythos. Es konzentriert sich auf Brentanos Beitrag, der als Schöpfer der romantischen Loreleyfigur gilt. Analysiert werden Brentanos Werke "Zu Bacharach am Rheine" und das "Rheinmärchen", um die Anfänge des Mythos und seine Entwicklung zu einer romantischen Kunstfigur zu untersuchen. Es wird der Übergang vom Mythos zur literarischen Figur beleuchtet und der Einfluss Brentanos auf spätere Bearbeitungen herausgestellt.
3. Die Loreley in der Romantik: Dieses Kapitel analysiert die Loreleyfigur im Kontext der Romantik. Es untersucht die verführerische Gestalt der Loreley, die Verschmelzung von Natur und Weiblichkeit in ihrer Darstellung und die epochentypischen Merkmale wie Liebe, Nacht und Tod. Die Arbeit beleuchtet die unterschiedlichen Verarbeitungen des Motivs bei Autoren wie Eichendorff (Waldgespräch) und zeigt die Loreley als Nationalallegorie auf. Das Kapitel legt den Grundstein für das Verständnis der romantischen Interpretationen der Loreley, die später von Heine dekonstruiert werden.
4. Dekonstruktion des Loreleymotivs bei Heinrich Heine: Das Herzstück der Arbeit konzentriert sich auf Heines Gedicht "Ich weiß nicht, was soll es bedeuten". Es wird Heines kritisches Verhältnis zur Romantik und seine Rolle als "entlaufender Romantiker" erläutert. Die Analyse seines Werkes und seiner Werkphasen soll zeigen, wie Heine die romantische Tradition hinterfragt und in seinem literarischen Stil verarbeitet. Im Mittelpunkt steht die Dekonstruktion des Loreley-Motivs und die Verwendung von Ironie als literarisches Mittel.
5. Weitere Dekonstruktionen des Loreleymotivs: Dieses Kapitel erweitert die Analyse auf weitere literarische Bearbeitungen der Loreley, die ebenfalls eine Dekonstruktion oder Umdeutung des romantischen Mythos vornehmen. Es untersucht die Werke von Erich Kästner ("Der Handstand auf der Loreley") als Beispiel für eine Ironisierung und Politisierung des Sujets, wodurch das klischeehafte Bild der Loreleyfigur hinterfragt wird und neue Interpretationen ermöglicht werden. Die unterschiedlichen Ansätze werden verglichen und kontrastiert, um die Entwicklung und Vielschichtigkeit des Loreley-Motivs aufzuzeigen.
Schlüsselwörter
Loreley, Romantischer Mythos, Heinrich Heine, Dekonstruktion, Romantik, Brentano, Eichendorff, Ironie, Nationalallegorie, literarische Verarbeitung, femme fatale, deutsche Literaturgeschichte.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Arbeit: Die Loreley - Vom romantischen Mythos zur dekonstruierten Figur
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese wissenschaftliche Arbeit untersucht die Entwicklung und Wandlung des Loreley-Motivs in der deutschen Literatur. Der Fokus liegt auf dem Übergang vom romantischen Mythos zu einer dekonstruierten Figur, insbesondere in Heinrich Heines Werk. Analysiert werden die Grundmerkmale der Loreleyfigur und ihre Bedeutung in verschiedenen literarischen Kontexten.
Welche Autoren und Werke werden behandelt?
Die Arbeit behandelt zentrale Werke und Autoren, die das Loreley-Motiv verarbeitet haben. Besonders hervorgehoben werden Clemens Brentano (mit "Zu Bacharach am Rheine" und dem "Rheinmärchen"), Joseph von Eichendorff (mit dem "Waldgespräch") und vor allem Heinrich Heine (mit seinem Gedicht "Ich weiß nicht, was soll es bedeuten"). Zusätzlich wird die Bearbeitung des Motivs durch Erich Kästner ("Der Handstand auf der Loreley") betrachtet.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel: Eine Einleitung, die die Zielsetzung und Methodik beschreibt; ein Kapitel zur Entstehung des Loreley-Mythos bei Brentano; ein Kapitel zur Loreley in der Romantik; ein zentrales Kapitel zur Dekonstruktion des Motivs bei Heine, inklusive Analyse seines Gedichts; und abschließend ein Kapitel zu weiteren Dekonstruktionen des Motivs, unter anderem bei Kästner. Die Arbeit enthält zudem ein Inhaltsverzeichnis, eine Zusammenfassung der Kapitel und Schlüsselwörter.
Was ist das zentrale Argument der Arbeit?
Die Arbeit argumentiert, dass die Loreleyfigur im Laufe der Literaturgeschichte eine deutliche Wandlung erfahren hat. Vom romantischen Mythos einer verführerischen, naturverbundenen Frau entwickelt sie sich, insbesondere durch Heines Dekonstruktion, zu einer vielschichtigeren und ironischer interpretierbaren Figur. Heines Gedicht wird als besonders einflussreich für die spätere Rezeption der Loreley dargestellt.
Welche Themen werden im Detail behandelt?
Die Arbeit behandelt verschiedene Facetten des Loreley-Motivs: die Entstehungsgeschichte des Mythos, die Darstellung der Loreley in der Romantik (mit ihren charakteristischen Merkmalen wie Verführung, Naturverbundenheit, Liebe, Nacht und Tod), Heines kritische Auseinandersetzung mit der Romantik und seine Dekonstruktion des Loreley-Mythos mittels Ironie, sowie weitere literarische Verarbeitungen und Interpretationen des Motivs im Laufe der Zeit, inklusive der allegorischen Funktion der Figur.
Welche Methoden werden angewendet?
Die Arbeit verwendet literaturwissenschaftliche Methoden der Textanalyse und Interpretation. Es werden die einzelnen literarischen Werke untersucht, um die Darstellung der Loreleyfigur zu analysieren und deren Bedeutung im jeweiligen Kontext zu ergründen. Die Arbeit vergleicht und kontrastiert verschiedene Interpretationen des Motivs und untersucht die Entwicklung der allegorischen Funktion der Loreleyfigur über die Zeit.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Schlüsselwörter zur Beschreibung des Inhalts sind: Loreley, Romantischer Mythos, Heinrich Heine, Dekonstruktion, Romantik, Brentano, Eichendorff, Ironie, Nationalallegorie, literarische Verarbeitung, femme fatale, deutsche Literaturgeschichte.
- Quote paper
- Ayla Bajrami (Author), 2020, Das Loreleymotiv bei Heinrich Heine. Entwicklung und Dekonstruktion, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/924102