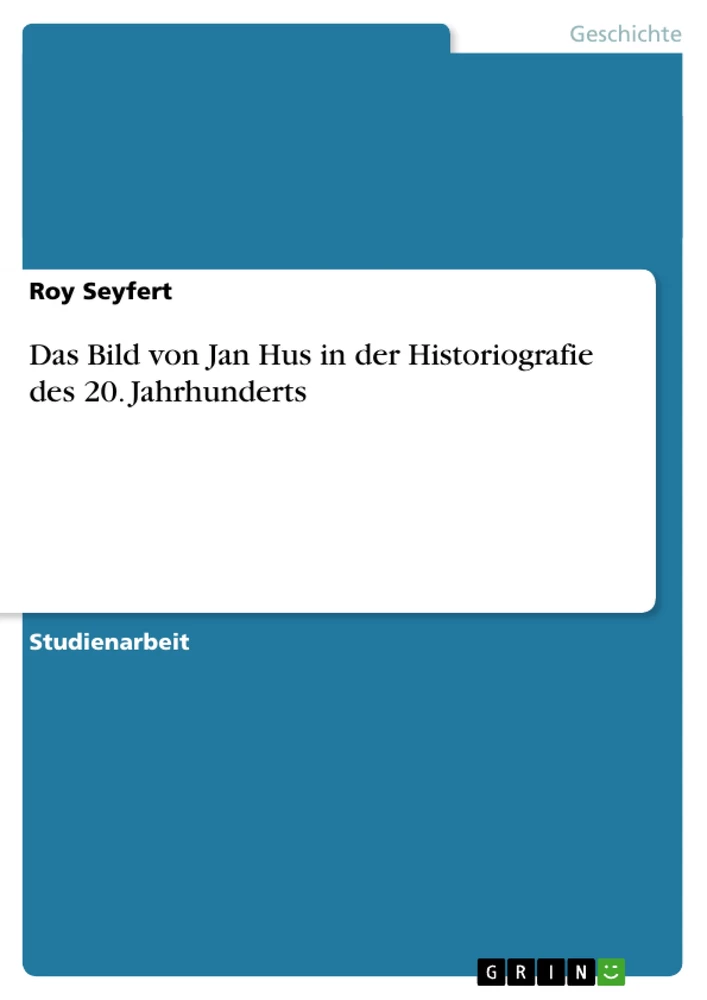Mit dem Begriff der Häresie ging man im Mittelalter sehr leichtfertig um. Dabei war es nicht einmal unbedingt notwendig, kirchlichen Dogmen zu widersprechen. Auch wenn man politische Gegner oder einfach nur Feinde im alltäglichen Leben hatte, konnte man rasch mit diesem Vorwurf konfrontiert werden.
Im Gegensatz zur Antike, wo der Begriff der Häresie überhaupt nicht bekannt war , war die Bezeichnung im Christentum von Beginn an negativ behaftet. Den Kern dieses Umstandes vermeint man, im 2. Paulusbrief zu finden, wo von „Parteiungen des Verderbens“ oder auch „negativen Ideologien“ die Rede ist . Jedoch darf bezweifelt werden, dass Paulus dasselbe Bild eines Ketzers hatte wie spätere Kirchenvertreter. Ihm kam es wohl eher darauf an, Diskussionen über die Glaubensauslegung zu unterbinden. Mit der fortschreitenden Etablierung der Institution Kirche allerdings nahm auch das Motiv des Ketzers als theologischem Gegenpart immer konkretere Formen an. Das Ius Canonicum definierte Häresie als die hartnäckige Leugnung einer Wahrheit, die nach göttlichem und katholischem Glauben anzunehmen ist, unterschied sie aber dennoch eindeutig von der Apostasie, was die völlige Verwerfung des Glaubens darstellte . Im Laufe der Zeit verlor die „Häresie“ aber auch diese Bedeutung wieder, bis sie schließlich im Frühmittelalter nur noch als einfaches Schimpfwort diente. Die eigentliche Bedeutung, nämlich als Bezeichnung für vermeintliche und echte Kirchengegner kam den Menschen erst wieder ins Bewusstsein, als man sich an die aktive Bekämpfung neuer religiöser Strömungen wie den Katharern machte.
Ich werde mich nun mit einer dieser Ketzerströmungen, wie die Kirche sie bezeichnete, beschäftigen. Es handelt sich um die Hussiten, die im 15. Jahrhundert von Böhmen aus das restliche Europa und die Kirche nachhaltig erschütterten. Zunächst werde ich die Ausgangssituation schildern, in welcher sich diese Reformbewegung entwickelte, dann die Lehren des Hus erläutern und abschließend auf seinen Tod und dessen Deutung in der Geschichtsschreibung eingehen. Dabei beschränke ich mich hauptsächlich auf Autoren und Wissenschaftler des 20. Jahrhunderts, aber auch namhafte Historiker des 19. Jahrhunderts sollen nicht gänzlich unerwähnt bleiben. In meiner Zusammenfassung werde ich dann versuchen, ein abschließendes und möglichst umfassendes Bild des Prager Magisters zu zeichnen, der seinen größten Ruhm wohl erst nach seinem Tode erlangt hatte.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Ausgangssituation
- Kirchlich- das Große Schisma
- Weltlich- Böhmen im 14. bzw. 15. Jahrhundert
- Lehre und Leben des Jan Hus
- Der Prozess in Konstanz und die Darstellung Hus' in der Historiografie
- Zusammenfassung.
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit befasst sich mit dem Bild von Jan Hus in der Historiografie des 20. Jahrhunderts. Sie analysiert die Entwicklung des Verständnisses von Hus als Ketzer, Reformer und Nationalheld. Ziel der Arbeit ist es, die verschiedenen Perspektiven auf Hus in der Geschichtsschreibung zu beleuchten und die Faktoren zu analysieren, die diese Perspektiven beeinflusst haben.
- Das Große Schisma der Kirche im 14. Jahrhundert als Kontext für Hus' Lehren
- Die Rolle von Hus als Theologe und Reformer in Böhmen
- Die Darstellung von Hus' Prozess in Konstanz und seiner Hinrichtung
- Die Rezeption von Hus in der Historiografie des 20. Jahrhunderts
- Die Bedeutung von Hus für die nationale Identität Böhmens
Zusammenfassung der Kapitel
- Die Einleitung skizziert den historischen Kontext der Häresie und die Bedeutung des Begriffs „Ketzer“ im Mittelalter. Sie führt den Leser in die Thematik der Arbeit ein und erklärt, warum die Figur des Jan Hus und seine Geschichte im 20. Jahrhundert so stark geprägt wurden.
- Das Kapitel „Die Ausgangssituation“ beschäftigt sich mit dem Großen Schisma der Kirche, das die westliche Welt im 14. und 15. Jahrhundert erschütterte. Es beleuchtet die politischen und religiösen Spannungen, die zu diesem Konflikt führten, und die Auswirkungen auf die Gesellschaft in Böhmen, dem Heimatland von Jan Hus.
- Das Kapitel „Lehre und Leben des Jan Hus“ beleuchtet die theologischen Lehren von Jan Hus und seinen Einfluss auf die religiöse und politische Landschaft Böhmens. Es zeigt die Bedeutung von Hus' Schriften und Predigten für die Entwicklung der hussitischen Bewegung.
- Das Kapitel „Der Prozess in Konstanz und die Darstellung Hus' in der Historiografie“ befasst sich mit dem Prozess gegen Jan Hus in Konstanz und seiner Hinrichtung. Es analysiert die Darstellung dieses Ereignisses in der Historiografie des 20. Jahrhunderts und zeigt, wie die verschiedenen Interpretationen von Hus' Tod die Wahrnehmung seiner Figur beeinflusst haben.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit dem Bild von Jan Hus in der Historiografie des 20. Jahrhunderts. Dabei stehen die Themen Häresie, Reformation, Nationalismus und die Rolle der Kirche im Mittelalter im Vordergrund. Weitere wichtige Schlagwörter sind das Große Schisma, das Konzil von Konstanz, die Hussitenbewegung, die Geschichte Böhmens und die deutsch-böhmischen Beziehungen.
Häufig gestellte Fragen
Wer war Jan Hus und warum wurde er als Ketzer verurteilt?
Jan Hus war ein böhmischer Reformer und Theologe. Er wurde 1415 auf dem Konzil von Konstanz hingerichtet, weil er kirchliche Dogmen kritisierte und seine Lehren nicht widerrief.
Was war das "Große Schisma" der Kirche?
Es war eine Spaltung innerhalb der katholischen Kirche im 14. und 15. Jahrhundert, bei der mehrere Päpste gleichzeitig den Thron beanspruchten, was den Ruf nach Reformen wie durch Hus verstärkte.
Wie wird Jan Hus in der Geschichtsschreibung des 20. Jahrhunderts dargestellt?
Die Historiografie betrachtet ihn differenziert als theologischen Reformer, Vorläufer der Reformation und als Symbolfigur der nationalen Identität Böhmens.
Welche Rolle spielten die Hussiten im 15. Jahrhundert?
Die Anhänger von Hus erschütterten durch ihre Reformbewegung und die darauffolgenden Kriege die Kirche und die politische Ordnung in ganz Europa nachhaltig.
Was ist der Unterschied zwischen Häresie und Apostasie?
Häresie ist die hartnäckige Leugnung einzelner Glaubenswahrheiten, während Apostasie die völlige Abkehr vom christlichen Glauben bezeichnet.
- Citar trabajo
- Roy Seyfert (Autor), 2007, Das Bild von Jan Hus in der Historiografie des 20. Jahrhunderts, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/92479