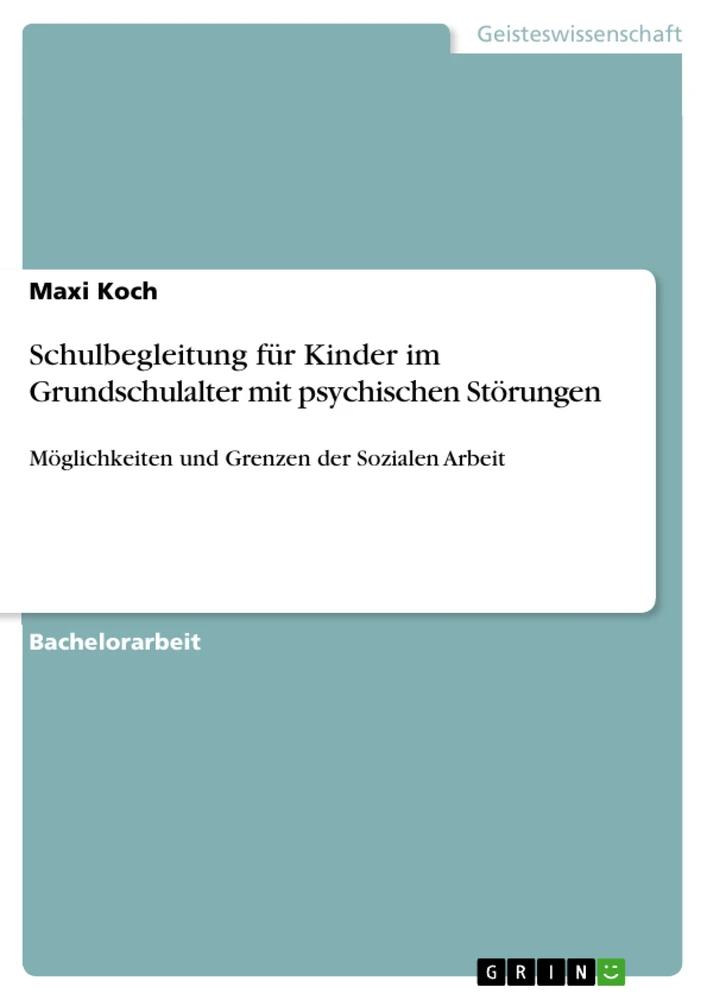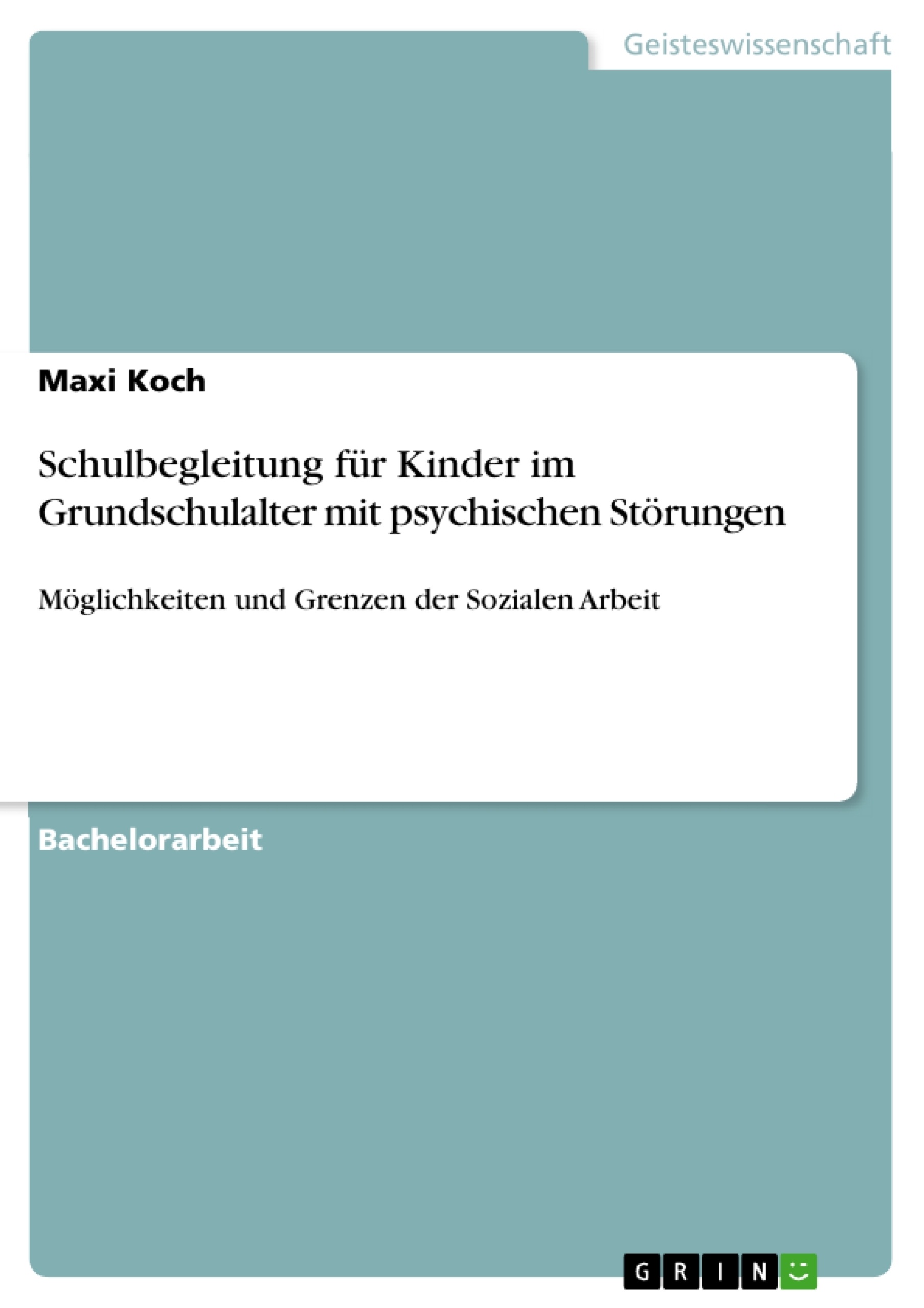Die Arbeit behandelt die Thematik der Schulbegleitung und erarbeitet, inwiefern dieses Berufsfeld Möglichkeiten und Grenzen bezüglich Grundschulkinder mit psychischen Störungen aufweist
Das Ziel der Arbeit ist es mithilfe vorliegender Literatur einen theoretischen Einblick in das Berufsfeld zu gewinnen und herauszuarbeiten, vor welchen Herausforderungen Schulbegleiter in ihrer Arbeit mit psychisch erkrankten Kindern stehen und wie sich das Konzept des Arbeitsfelds in der Zukunft entwickeln könnte.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Schulwesen und Schulpflicht in Deutschland in Vergangenheit und Gegenwart
- Einführung zum Begriff des Schulwesens
- Kindheit im Kontext von Grundschule - Der Übergang zum „Ernst des Lebens“
- Schule als Lern- und Lebenswelt
- Psychische Störungen im Grundschulalter
- Schulbegleitung
- Begriffserklärung
- Schulbegleitung als Berufsfeld der Sozialen Arbeit
- Voraussetzungen für das Beantragen der Schulbegleitung
- Handlungsfelder und Qualifikationen von Schulbegleiter*innen
- Kooperationspartner*innen und Kooperationskonfliktstrukturen der Schulbegleitung
- Fazit: Schulbegleitung im Kooperations- und Handlungskonflikt…
- Ausblick Berufsfeld Schulbegleitung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Bachelorarbeit befasst sich mit dem Berufsfeld der Schulbegleitung, insbesondere im Hinblick auf psychische Störungen bei Kindern im Grundschulalter. Das Ziel der Arbeit ist es, einen theoretischen Einblick in das Berufsfeld zu gewinnen, die Herausforderungen von Schulbegleiter*innen in ihrer Arbeit mit psychisch erkrankten Kindern zu beleuchten und mögliche Entwicklungen des Konzepts des Arbeitsfelds in der Zukunft aufzuzeigen.
- Die Bedeutung des Schulwesens und der Schulpflicht in Deutschland
- Psychische Störungen bei Kindern im Grundschulalter
- Das Berufsfeld der Schulbegleitung als Teil der Sozialen Arbeit
- Kooperation und Konflikte im Kontext der Schulbegleitung
- Zukünftige Herausforderungen und Chancen für das Berufsfeld der Schulbegleitung
Zusammenfassung der Kapitel
Die Bachelorarbeit setzt sich zunächst mit dem Begriff des Schulwesens und der Schulpflicht in Deutschland auseinander. Im ersten Kapitel wird die historische Entwicklung des Schulwesens beleuchtet und die Bedeutung der Schulpflicht im Kontext der gesellschaftlichen Veränderungen hervorgehoben. Dabei wird insbesondere der Übergang zum „Ernst des Lebens“ für Kinder im Grundschulalter beleuchtet.
Das zweite Kapitel beschäftigt sich mit psychischen Störungen im Grundschulalter. Es werden verschiedene psychische Erkrankungen wie Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung, Persönlichkeitsstörung und posttraumatische Belastungsstörung (PTBS) thematisiert. Die Kapitel fokussieren auf die Entstehung und Ursachen dieser Störungen und beleuchten dabei die Schule als potenziellen Risikofaktor.
Im dritten Kapitel wird der Begriff der Schulbegleitung als Feld Sozialer Arbeit vorgestellt. Das Kapitel behandelt die rechtlichen Grundlagen und die Voraussetzungen für das Beantragen einer Schulbegleitung. Zudem werden die Handlungsfelder und Qualifikationen von Schulbegleiter*innen, sowie die Zusammenarbeit mit verschiedenen Kooperationspartner*innen und die Herausforderungen durch Kooperationskonflikte beleuchtet.
Schlüsselwörter
Schlüsselwörter der Arbeit sind: Schulwesen, Schulpflicht, Grundschule, psychische Störungen, Schulbegleitung, Soziale Arbeit, Kooperation, Konflikte, Professionalisierung, Herausforderungen.
Häufig gestellte Fragen
Was ist die Aufgabe einer Schulbegleitung?
Schulbegleiter unterstützen Kinder mit Beeinträchtigungen oder psychischen Störungen im Schulalltag, um ihnen die Teilhabe am Unterricht und das Erreichen von Lernzielen zu ermöglichen.
Welche psychischen Störungen treten bei Grundschülern häufig auf?
Zu den behandelten Störungen zählen ADHS, Persönlichkeitsstörungen und posttraumatische Belastungsstörungen (PTBS).
Wie wird eine Schulbegleitung beantragt?
Die Beantragung erfolgt in der Regel über das Jugendamt (bei seelischen Behinderungen nach SGB VIII) oder das Sozialamt (bei körperlichen/geistigen Behinderungen nach SGB XII).
Welche Qualifikationen benötigen Schulbegleiter?
Das Feld ist heterogen; es gibt sowohl Fachkräfte (Sozialpädagogen, Erzieher) als auch ungelernte Kräfte, wobei eine Professionalisierung angestrebt wird.
Welche Konflikte können in der Schulbegleitung entstehen?
Häufige Konflikte entstehen durch unklare Rollenverteilung zwischen Lehrkräften und Begleitern sowie durch unterschiedliche Erwartungen der Eltern und Kooperationspartner.
- Arbeit zitieren
- Maxi Koch (Autor:in), 2020, Schulbegleitung für Kinder im Grundschulalter mit psychischen Störungen, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/925149