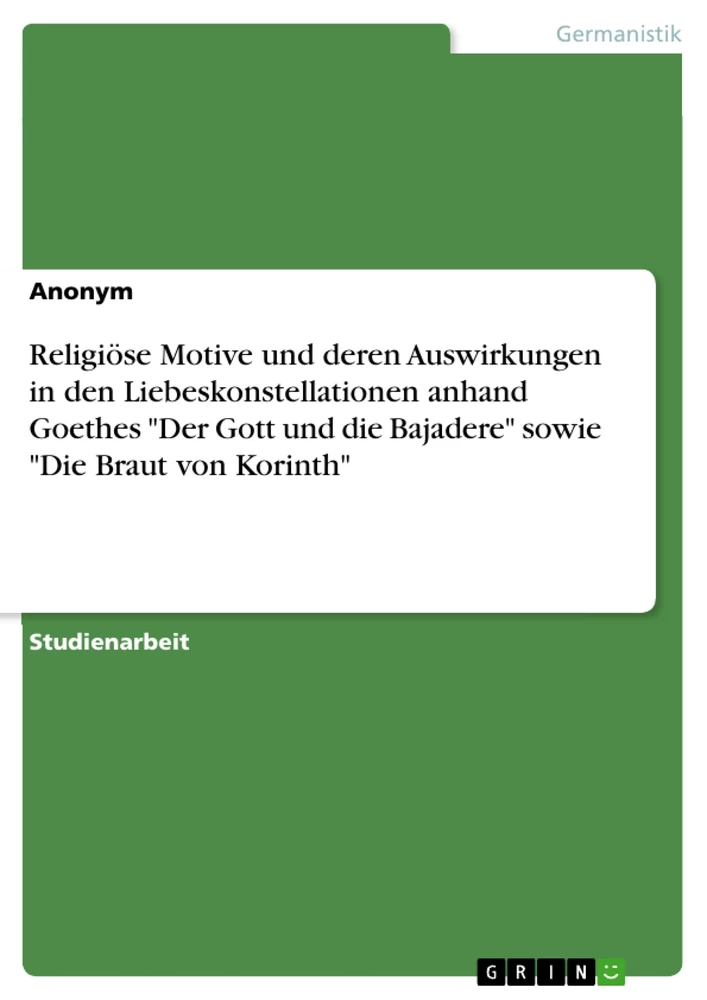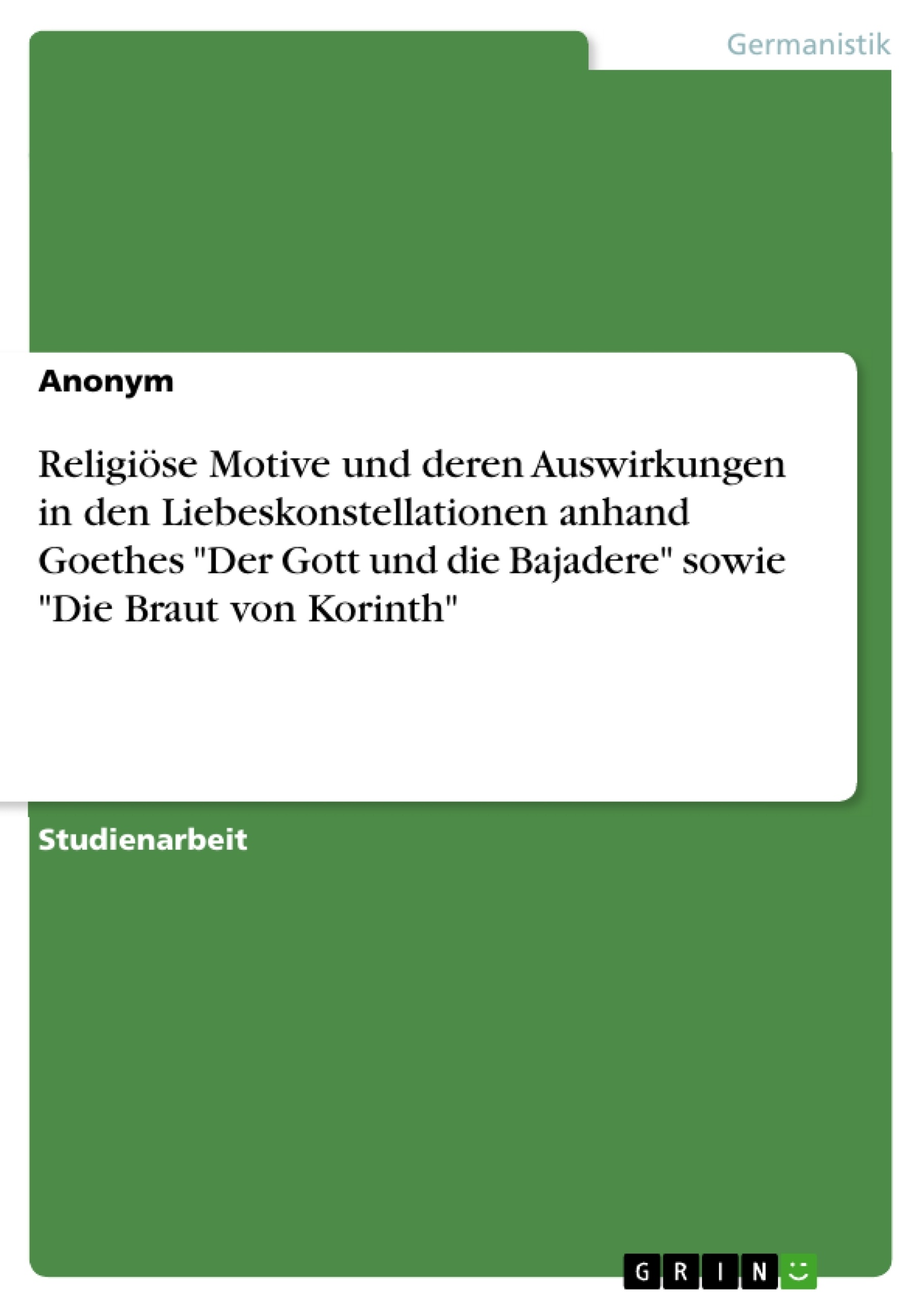Die vorliegende Seminararbeit befasst sich mit religiösen Motiven und deren Auswirkungen in den Liebeskonstellationen, die am Bespiel von „Die Braut von Korinth“ sowie „Der Gott und die Bajadere“ untersucht werden sollen. In diesen ausgewählten Balladen Goethes werden religiöse Motive vielfach thematisiert und behandelt. Es soll der Frage nachgegangen werden, inwiefern sich diese auf die Liebeskonstellationen in den Werken auswirken und welche Rolle die Religionszugehörigkeit der Figuren in den Balladen spielt.
Zunächst soll geklärt werden, in welches Verhältnis sich Religion und Literatur systematisch setzen lassen und in welcher Beziehung Literatur, religiöse Praxis und Wissenschaft stehen.
Der darauffolgende Abschnitt wird sich mit der Analyse der beiden Balladen Goethes beschäftigen, wobei im Falle der Ballade „Der Gott und die Bajadere“ deren Erstfassung aus dem Musenalmanach aus dem Jahre 1798 zur näheren Betrachtung herangezogen wird. Die Analyse der Werke wird sich dabei lediglich auf die textuelle Ebene beziehen, wobei religiöse Motive in den Balladen ausfindig gemacht und interpretiert werden sollen.
Den Abschluss dieser Arbeit bilden die Zusammenfassung und eine Interpretation der Ergebnisse.
Inhaltsverzeichnis
- EINLEITUNG
- RELIGIÖSE MOTIVE IN DER LITERATUR
- KURZE VORSTELLUNG DER BALLADEN
- ,,DIE BRAUT VON KORINTH❝
- ,,DER GOTT UND DIE BAJADERE“
- ANALYSE DER BALLADEN
- ,,DIE BRAUT VON KORINTH“
- ,,DER GOTT UND DIE BAJADERE“
- ZUSAMMENFASSUNG UND INTERPRETATION DER ERGEBNISSE
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit befasst sich mit religiösen Motiven in Goethes Balladen „Die Braut von Korinth“ und „Der Gott und die Bajadere“. Sie untersucht die Auswirkungen dieser Motive auf die Liebeskonstellationen in den Werken und die Rolle der Religionszugehörigkeit der Figuren. Die Arbeit stützt sich auf die Primärliteratur, insbesondere die beiden Balladen, sowie auf relevante Sekundärliteratur.
- Das Verhältnis zwischen Religion und Literatur
- Der Einfluss religiöser Motive auf Liebeskonstellationen
- Die Rolle der Religionszugehörigkeit in den Balladen
- Die Bedeutung der religiösen Motive für die Interpretation der Balladen
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung stellt die Forschungsfrage und den Fokus der Arbeit vor. Sie erklärt, welche Motive und Konstellationen untersucht werden und skizziert die methodische Vorgehensweise.
- Religiöse Motive in der Literatur: Dieses Kapitel beleuchtet den systematischen Zusammenhang von Religion und Literatur. Es erörtert den Einfluss der Religion auf die Literatur und stellt die Relevanz der Thematik für die Literaturwissenschaft heraus.
- Kurze Vorstellung der Balladen: Dieses Kapitel gibt einen kurzen Einblick in die Entstehungsgeschichte und die Gattung der beiden Balladen. Es stellt auch den Bezug zu den jeweiligen literarischen Vorbildern her.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf die religiösen Motive in Goethes Balladen „Die Braut von Korinth“ und „Der Gott und die Bajadere“. Wichtige Themen sind die Auswirkungen dieser Motive auf die Liebeskonstellationen und die Rolle der Religionszugehörigkeit der Figuren. Die Arbeit greift auf Konzepte aus der Literaturwissenschaft und Religionswissenschaft zurück, um die Bedeutung religiöser Motive für die Interpretation der Balladen zu erforschen.
Häufig gestellte Fragen
Welche Balladen Goethes werden in dieser Arbeit analysiert?
Die Arbeit analysiert die Balladen „Die Braut von Korinth“ und „Der Gott und die Bajadere“.
Wie beeinflusst Religion die Liebesbeziehungen in den Balladen?
Die Religionszugehörigkeit der Figuren schafft Spannungsfelder und Konflikte, die den Verlauf und das Schicksal der Liebeskonstellationen maßgeblich bestimmen.
Welche Fassung von „Der Gott und die Bajadere“ wird untersucht?
Es wird die Erstfassung aus dem Musenalmanach des Jahres 1798 herangezogen.
Was ist das Ziel der Untersuchung religiöser Motive?
Ziel ist es zu klären, inwiefern religiöse Motive die literarische Darstellung von Liebe prägen und welche Rolle religiöse Praxis für die Figurenentwicklung spielt.
In welchem Verhältnis stehen Religion und Literatur laut der Arbeit?
Die Arbeit untersucht das systematische Verhältnis zwischen Religion, Literaturwissenschaft und religiöser Praxis auf der textuellen Ebene.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2020, Religiöse Motive und deren Auswirkungen in den Liebeskonstellationen anhand Goethes "Der Gott und die Bajadere" sowie "Die Braut von Korinth", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/925404