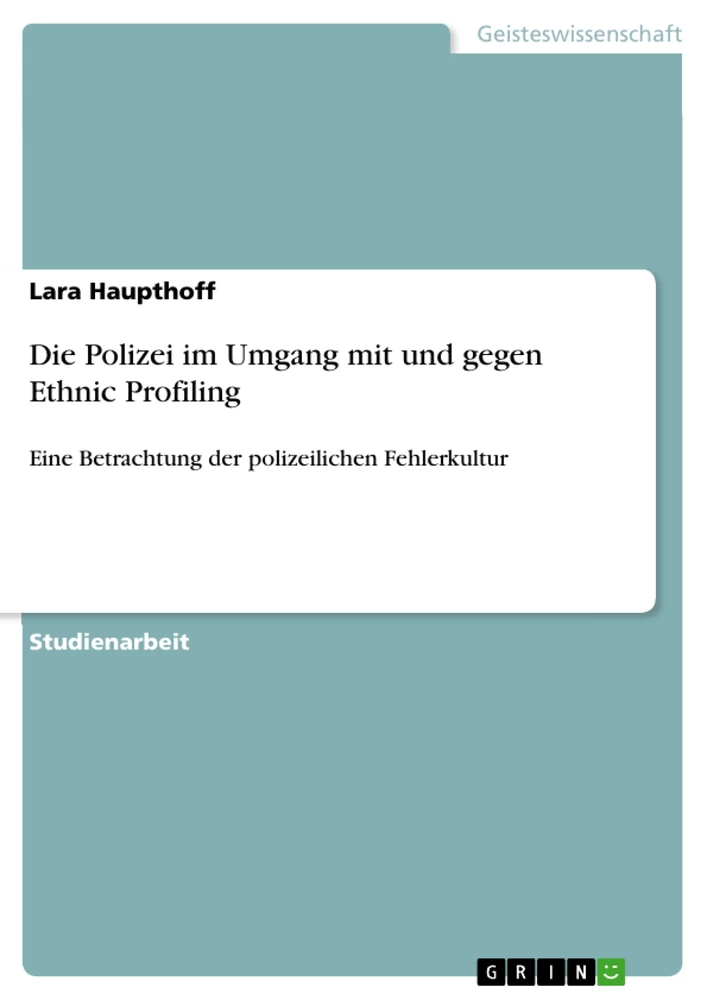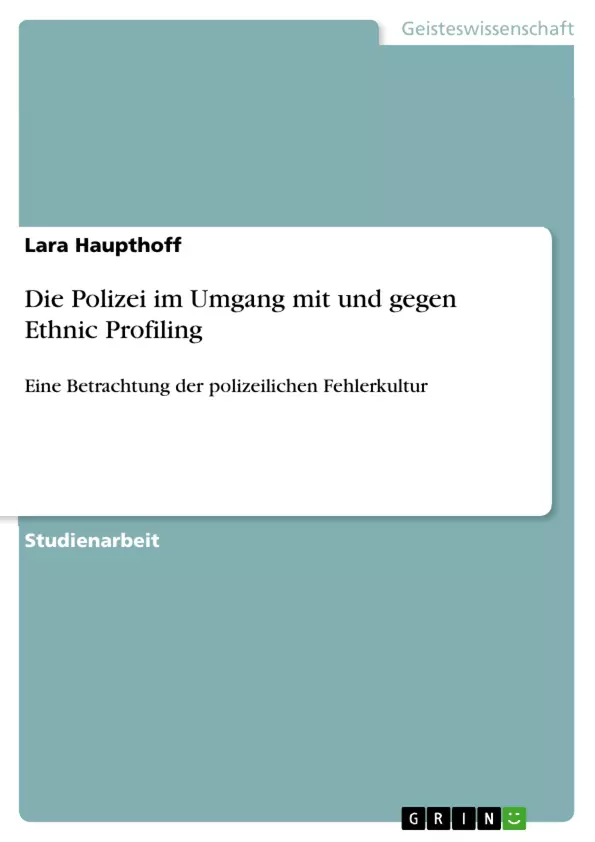Die Arbeit beschäftigt sich mit der Thematik des Ethnic Profiling und dem Umgang der Polizei mit und gegen Ethnic Profiling. Welche präventiven Maßnahmen werden zur Verhütung von rassistischen Vorkommnissen im Polizeialltag getroffen? Wie intensiv fällt die Aufarbeitung und/oder Sanktion von beteiligten Beamten in solchen Fällen, in denen es durch Unachtsamkeit oder Torheit zu Ethnic Profiling kommen konnte, in der Praxis wirklich aus?
Das Thema Rassismus ist spätestens seit dem Höhepunkt der Flüchtlingskrise vor ein paar Jahren (wieder) aktueller denn je. Verstärkt durch diese wachsende Sensibilität melden sich immer mehr der People of Color zu Wort und berichten von übermäßigen Kontrollen und Andersbehandlung durch die Polizei. Ein solches Fehlverhalten ist im fachlichen Sprachgebrauch als Racial- oder auch Ethnic Profiling bekannt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Polizeiliche Fehlerkultur
- Fehlerbegriff
- Polizeikultur
- Fehlerkultur
- Ethnic Profiling
- Begriffsbestimmungen
- Rechtliche Einordnung
- Auswirkungen
- Umgang mit Ethnic Profiling
- Erklärungsansätze
- Präventionsarbeit
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit befasst sich mit der polizeilichen Fehlerkultur im Kontext von Ethnic Profiling. Sie untersucht, wie die Polizei Situationen handhabt, in denen es zu rassistischen Vorfällen kommen kann, welche präventiven Maßnahmen zur Verhinderung von Ethnic Profiling getroffen werden und wie intensiv die Aufarbeitung und/oder Sanktion von beteiligten Beamt/innen solcher Fälle in der Praxis wirklich ausfällt.
- Definition des Fehlerbegriffs im polizeilichen Kontext
- Analyse der Polizeikultur und Cop Culture
- Begriffsbestimmung und rechtliche Einordnung von Ethnic Profiling
- Erklärungsansätze und Präventionsarbeit im Umgang mit Ethnic Profiling
- Bewertung der polizeilichen Fehlerkultur im Hinblick auf Ethnic Profiling
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik des Rassismus und Ethnic Profiling in der polizeilichen Praxis ein. Sie beleuchtet die aktuelle Relevanz des Themas und zeigt auf, wie Ethnic Profiling im fachlichen Sprachgebrauch definiert wird. Das zweite Kapitel beschäftigt sich mit der polizeilichen Fehlerkultur. Es analysiert den Fehlerbegriff im Kontext der polizeilichen Tätigkeit und beleuchtet die Polizeikultur und die damit verbundene Cop Culture. Das dritte Kapitel beschäftigt sich mit Ethnic Profiling. Es gibt eine Begriffsbestimmung, beleuchtet die rechtliche Einordnung und zeigt die Auswirkungen von Ethnic Profiling auf. Das vierte Kapitel befasst sich mit dem Umgang der Polizei mit Ethnic Profiling. Es beleuchtet verschiedene Erklärungsansätze und Präventionsarbeit zur Verhinderung von rassistischen Vorfällen im Polizeialltag.
Schlüsselwörter
Polizeiliche Fehlerkultur, Ethnic Profiling, Rassismus, Cop Culture, Rechtliche Einordnung, Präventionsarbeit, Erklärungsansätze, Umgang mit Fehlern, Grundrechtseingriffe.
Häufig gestellte Fragen
Was versteht man unter "Ethnic Profiling" bei der Polizei?
Es bezeichnet polizeiliche Maßnahmen wie Kontrollen, die primär aufgrund der ethnischen Zugehörigkeit, Hautfarbe oder Religion ohne konkreten Tatverdacht durchgeführt werden.
Wie sieht die polizeiliche Fehlerkultur in diesem Bereich aus?
Die Arbeit untersucht, wie Fehler erkannt, aufgearbeitet oder sanktioniert werden. Oft steht die sogenannte "Cop Culture" einer offenen Fehlerkultur entgegen.
Welche präventiven Maßnahmen gibt es gegen rassistische Vorfälle?
Dazu gehören Sensibilisierungstrainings in der Ausbildung, klare rechtliche Vorgaben und die Förderung einer reflektierten Polizeikultur.
Warum ist Ethnic Profiling rechtlich problematisch?
Es verstößt gegen das Diskriminierungsverbot und greift massiv in die Grundrechte der Betroffenen ein, was das Vertrauen in den Rechtsstaat schwächen kann.
Welche Auswirkungen hat Ethnic Profiling auf die Betroffenen?
People of Color berichten von Ausgrenzung, psychischer Belastung und einem Gefühl der ständigen Verdächtigung durch staatliche Organe.
- Quote paper
- Lara Haupthoff (Author), 2020, Die Polizei im Umgang mit und gegen Ethnic Profiling, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/925664