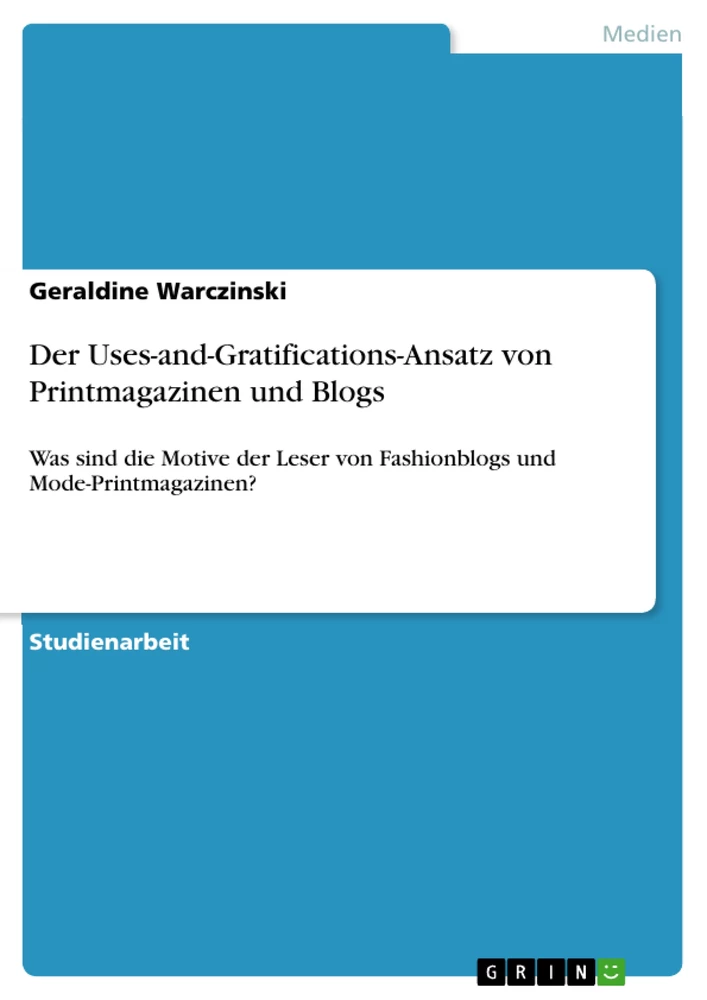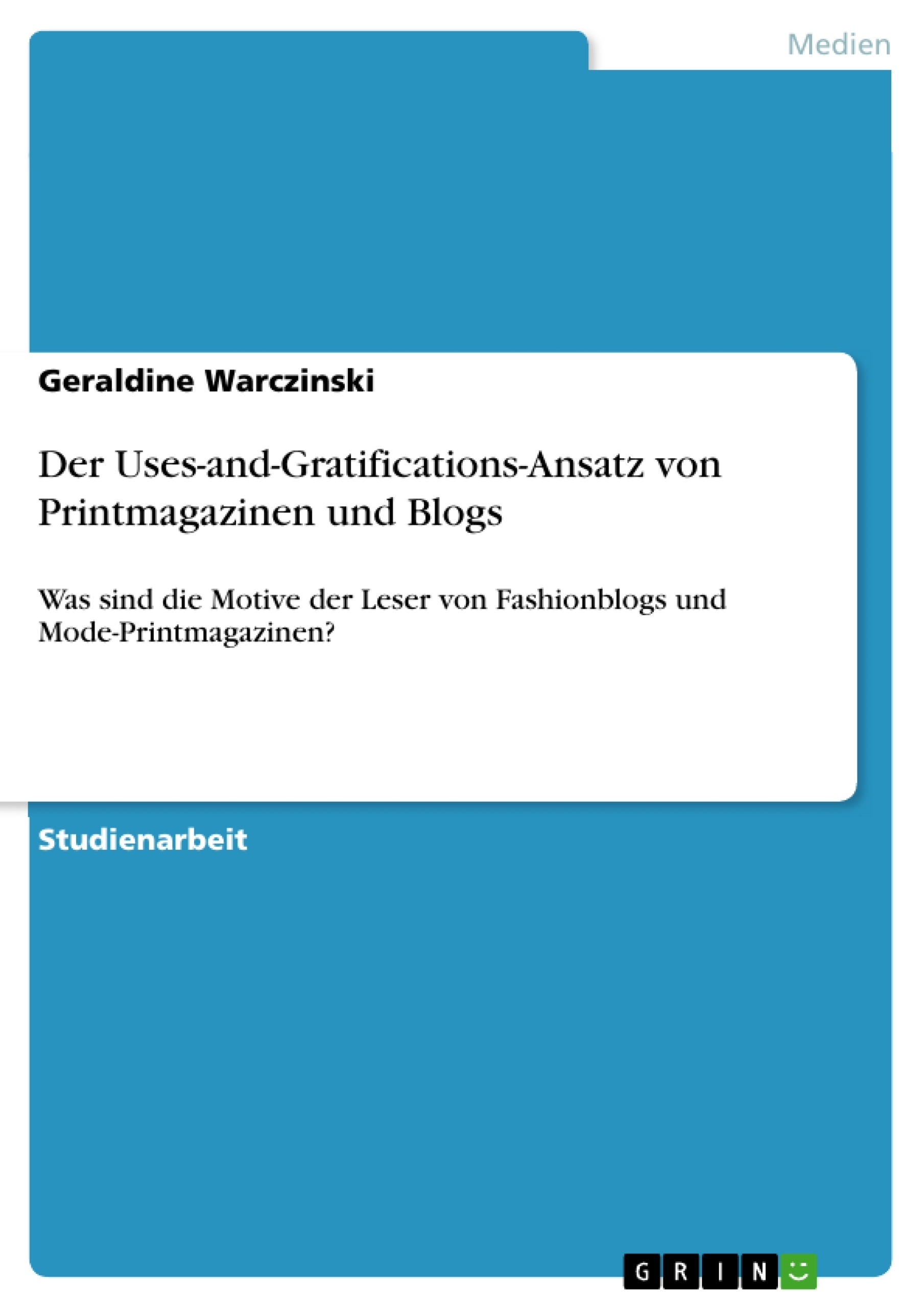In dieser Arbeit werden anhand des Beispiels von Highsnobiety drei Mediennutzungsmotive untersucht, welche Konsumenten antreiben, Modeinhalte über Modeblogs zu konsumieren. Die Mediennutzungsmotive werden als "Gewohnheit", "Zugang" und "Gewinnen/Speichern von Inhalten" klassifiziert. Diese werden zu einem späteren Zeitpunkt definiert und erklärt.
Das Ziel der Arbeit ist es Gratifikationsmuster von Modeblogs am Beispiel von Highsnobiety.com zu betrachten, um in weiterer Folge den Erfolg von Modeblogs zu verstehen. Dazu sollen mit der Verknüpfung von Literaturquellen, User-Statistiken von Highsnobiety.com die Kaufzahlen von Highsnobiety Magazine und Nutzungsmotive von Modeblog-Rezipienten beleuchtet werden.
Die übergreifende Forschungsfrage lautet: Welche Unterschiede der Gratifikationsmuster der Mediennutzung bestehen zwischen Highsnobiety.com und Highsnobiety Magazine? Daraus entspringen untergeordnet folgende Forschungsfragen: Was sind die Motive der Leser von Fashionblogs und Mode-Printmagazinen? Unterscheiden sich die Motivationsfaktoren zwischen den Medien?
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einführung
- 1.1. Theoretischer Hintergrund und Themenrelevanz
- 1.2. Zielsetzung
- 1.3. Aufbau der Arbeit
- 2. Forschungsdesign
- 2.1. Begriffsabgrenzung
- 2.2. Grundannahmen
- 2.3. Gratifikationen der Mediennutzung
- 2.3.1. Inhaltliche Gratifikationen
- 2.3.2. Mediale Gratifikationen
- 2.3.3. Soziale Gratifikationen
- 2.4. UG-Ansatz und das Internet
- 2.5. Gratifikationsprofil von Modeblogs
- 3. Hypothesen
- 4. Methodik
- 5. Case Study: Highsnobiety.com und Highsnobiety Magazine
- 5.1. Auswertung & Analyse der Umfrage
- 6. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit setzt sich zum Ziel, Gratifikationsmuster von Modeblogs am Beispiel von Highsnobiety.com zu betrachten, um den Erfolg von Modeblogs zu verstehen. Durch die Verknüpfung von Literaturquellen, User-Statistiken von Highsnobiety.com und Kaufzahlen von Highsnobiety Magazine sollen Nutzungsmotive von Modeblog-RezipientInnen beleuchtet werden.
- Untersuchung der Gratifikationsmuster von Modeblogs im Vergleich zu traditionellen Print-Magazinen.
- Analyse der Motive von Leserinnen von Fashionblogs und Mode-Print-Magazinen.
- Identifizierung von Unterschieden in den Motivationsfaktoren zwischen den beiden Medien.
- Erläuterung der Funktion und Rolle von Modeblogs im Verhältnis zu traditionellen Print-Magazinen.
- Beurteilung der Erfolgsfaktoren von Modeblogs im Vergleich zu Print-Magazinen.
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1: Einführung
- Kapitel 2: Forschungsdesign
- Kapitel 3: Hypothesen
- Kapitel 4: Methodik
- Kapitel 5: Case Study: Highsnobiety.com und Highsnobiety Magazine
Dieses Kapitel stellt den theoretischen Hintergrund und die Relevanz der Thematik dar. Es beschreibt die Veränderungen in der Medienlandschaft der Modebranche und die steigende Beliebtheit von Modeblogs.
Dieses Kapitel definiert den Uses-and-Gratification Ansatz und seine Anwendung auf Modeblogs. Es beschreibt die verschiedenen Arten von Gratifikationen, die Nutzer von Modeblogs erleben können, sowie die spezifischen Gratifikationen, die durch Modeblogs erfüllt werden.
Dieses Kapitel formuliert Hypothesen, die im weiteren Verlauf der Arbeit untersucht werden. Es stellt Annahmen über die Gratifikationsmuster von Modeblog-Nutzern auf und spezifiziert die Forschungsfragen.
Dieses Kapitel beschreibt die Methoden, die zur Datenerhebung und -analyse verwendet werden. Es erläutert die Vorgehensweise bei der Case Study mit Highsnobiety.com und Highsnobiety Magazine.
Dieses Kapitel präsentiert die Ergebnisse der Analyse von Highsnobiety.com und Highsnobiety Magazine. Es untersucht die Gratifikationsmuster der Nutzer beider Medien und vergleicht sie miteinander.
Schlüsselwörter
Modeblogs, Uses-and-Gratification Ansatz, Gratifikationsmuster, Mediennutzung, Print-Magazine, Highsnobiety, Social Media, Influencer, Fashion, Modeindustrie, Medienlandschaft, User-Statistiken, Kaufzahlen, Nutzungsmotive, Content Consumption.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Uses-and-Gratifications-Ansatz?
Ein medienwissenschaftlicher Ansatz, der fragt, warum Menschen bestimmte Medien nutzen und welche Bedürfnisse (Gratifikationen) sie damit befriedigen.
Warum nutzen Menschen Modeblogs wie Highsnobiety.com?
Motive sind unter anderem Gewohnheit, schneller Zugang zu Informationen sowie das Gewinnen und Speichern von Inhalten.
Wie unterscheiden sich Blogs von Printmagazinen?
Blogs bieten oft schnellere Aktualität und soziale Gratifikationen, während Printmagazine andere mediale und inhaltliche Qualitäten aufweisen.
Welche Rolle spielen Influencer in der Modeindustrie?
Sie verändern die Medienlandschaft, indem sie als Bindeglied zwischen Marken und Konsumenten fungieren und neue Nutzungsmotive bedienen.
Was ist das Ziel der Highsnobiety Case Study?
Die Untersuchung vergleicht die Gratifikationsmuster der Online-Plattform mit denen des Printmagazins, um den Erfolg beider Formate zu verstehen.
- Quote paper
- Geraldine Warczinski (Author), 2020, Der Uses-and-Gratifications-Ansatz von Printmagazinen und Blogs, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/925752