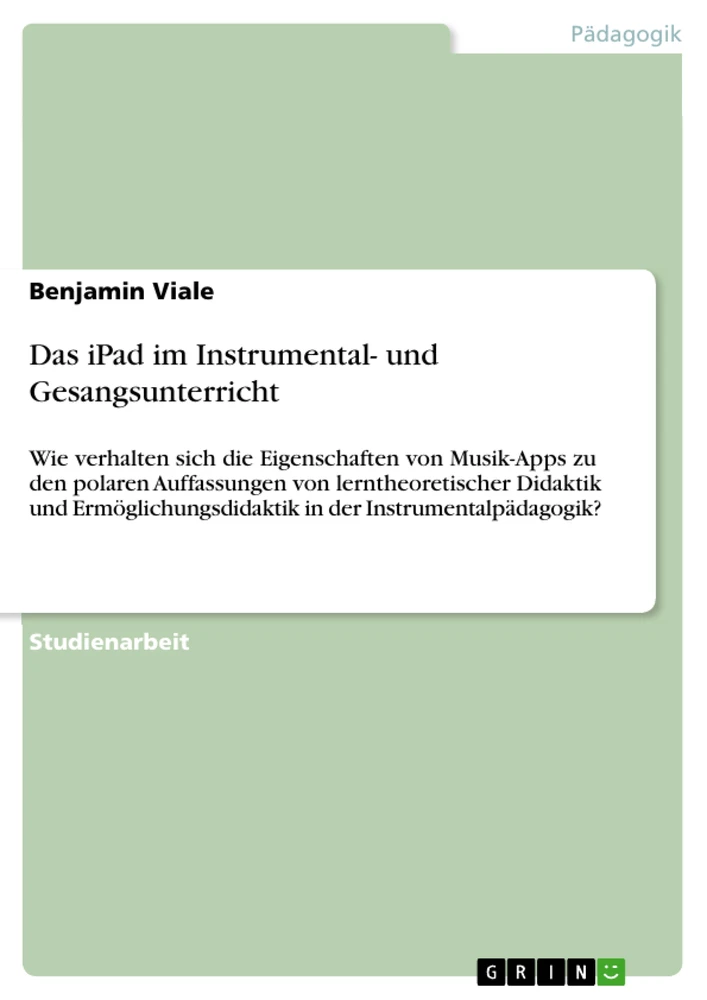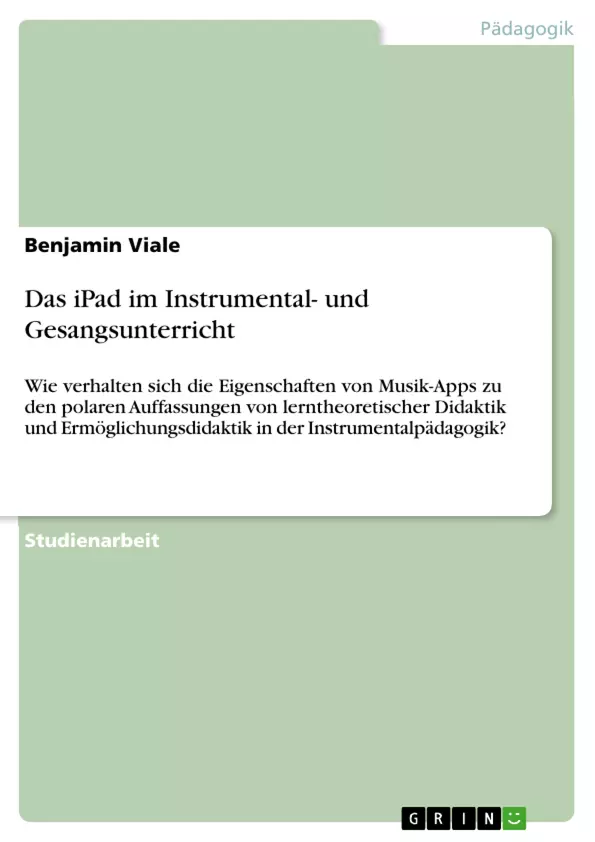Die Forschungsfrage dieser Hausarbeit lautet: Wie verhalten sich die Eigenschaften von Musik-Apps zu den polaren Auffassungen von lerntheoretischer Didaktik und Ermöglichungsdidaktik in der Instrumentalpädagogik?
In den vergangenen Jahren wurden Smartphones und Tablets zum selbstverständlichen Begleiter nicht nur von Erwachsenen, sondern auch vieler Kinder. In der Instrumental- und Gesangspädagogik (IP) geraten damit die Schülerinnen und Schüler ins Blickfeld. Es stellt sich weniger die Frage, ob die Geräte vorhanden sind und genutzt werden, sondern wie dies geschieht.
Eine erste Antwort können Musik-Apps geben. Allerdings ist ihre Vielfalt so groß, dass es nötig erscheint, eine gewisse Systematik sowie Kriterien für den sinnvollen Umgang zu entwickeln. Dazu wird hier ein (wieder) aktueller Diskurs aus der IP zur Hilfe genommen. Dabei geht es – kurz gesagt – um zwei verschiedene instrumentalpädagogische Ansätze, die im Widerspruch zueinander stehen. Diese zwei Ansätze und ein Vorschlag, wie man deren Widerspruch auflösen könnte, werden im ersten Teil der Arbeit vorgestellt. Anschließend werden theoretische Fragen aus den Ansätzen abgeleitet. Diese dienen im nachfolgenden Teil zur Analyse von drei verschiedenen Musik-Apps. Im Fazit werden die Forschungsergebnisse zusammengefasst und eine Antwort auf die Forschungsfrage versucht.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Zur Instrumentalpädagogik
- Polaritäten in der Instrumentalpädagogik nach Silke Kruse-Weber und Cristina Marin
- Ein Modellvorschlag von Elisabeth Aigner-Monarth und Natalia Ardila-Mantilla
- Zusammenfassende hypothetische Aussagen
- Musik-Apps
- Kategorien von Musizierapps
- Musik-Apps im Instrumental- und Gesangsunterricht
- Beschreibung von Apps und Suche nach Eigenschaften im Blick auf lerntheoretische Didaktik und Ermöglichungsdidaktik
- Music Tutor
- Fluxpad
- GeoShred Play
- Zusammenfassung der Untersuchung der Apps
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit befasst sich mit der Frage, wie die Eigenschaften von Musik-Apps zu den polaren Auffassungen von lerntheoretischer Didaktik und Ermöglichungsdidaktik in der Instrumentalpädagogik stehen. Die Arbeit untersucht den Einfluss von Musik-Apps auf den Instrumental- und Gesangsunterricht und analysiert, wie verschiedene App-Funktionen den beiden didaktischen Ansätzen entsprechen.
- Polaritäten in der Instrumentalpädagogik
- Lerntheoretische Didaktik vs. Ermöglichungsdidaktik
- Musik-Apps im Instrumentalunterricht
- Analyse von Musik-Apps in Bezug auf didaktische Ansätze
- Zusammenhang zwischen App-Funktionen und didaktischen Konzepten
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Arbeit stellt die Forschungsfrage und den Kontext des Themas vor. Es wird die Bedeutung von Musik-Apps im Instrumentalunterricht und der aktuelle Diskurs über verschiedene didaktische Ansätze beleuchtet.
- Zur Instrumentalpädagogik: Dieses Kapitel beschreibt die polaren Ansätze in der Instrumentalpädagogik, die von Silke Kruse-Weber und Cristina Marin definiert wurden. Es werden die Begriffspaare "Leib versus Seele" und "Theorie vs. Praxis" erläutert, sowie der Gegensatz zwischen lerntheoretischer Didaktik und Ermöglichungsdidaktik.
- Musik-Apps: Hier werden verschiedene Kategorien von Musik-Apps vorgestellt und deren Einsatzmöglichkeiten im Instrumental- und Gesangsunterricht diskutiert.
- Beschreibung von Apps und Suche nach Eigenschaften im Blick auf lerntheoretische Didaktik und Ermöglichungsdidaktik: Dieses Kapitel analysiert drei verschiedene Musik-Apps (Music Tutor, Fluxpad und GeoShred Play) im Hinblick auf ihre Eigenschaften und deren Bezug zu den polaren didaktischen Ansätzen.
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselwörter dieser Arbeit sind Instrumentalpädagogik, lerntheoretische Didaktik, Ermöglichungsdidaktik, Musik-Apps, Instrumental- und Gesangsunterricht, App-Analyse, didaktische Ansätze und die Verbindung von digitaler Technologie mit musikalischer Praxis.
Häufig gestellte Fragen
Welche Rolle spielt das iPad im heutigen Musikunterricht?
Das iPad ist ein selbstverständlicher Begleiter für Kinder und Jugendliche geworden. In der Instrumentalpädagogik wird es durch Musik-Apps genutzt, um das Üben und Lernen interaktiver zu gestalten.
Was ist der Unterschied zwischen lerntheoretischer Didaktik und Ermöglichungsdidaktik?
Die lerntheoretische Didaktik ist eher instruktionsorientiert (Lehrer gibt vor), während die Ermöglichungsdidaktik den Fokus auf Selbststeuerung und die Schaffung von Lernumgebungen legt, in denen Schüler eigene Entdeckungen machen können.
Welche Musik-Apps werden in der Arbeit analysiert?
Es werden drei Apps untersucht: "Music Tutor" (fokussiert auf Theorie/Notenlesen), "Fluxpad" (kreatives Zeichnen von Klängen) und "GeoShred Play" (ausdrucksstarkes digitales Instrumentenspiel).
Wie unterstützen Apps die Ermöglichungsdidaktik?
Apps wie Fluxpad ermöglichen es Schülern, ohne tiefes theoretisches Vorwissen sofort kreativ tätig zu werden und Musik durch Ausprobieren und Handeln zu erfahren.
Können Apps den traditionellen Instrumentalunterricht ersetzen?
Die Arbeit sieht Apps eher als Ergänzung, die je nach didaktischem Ansatz unterschiedliche Funktionen erfüllen – von der Automatisierung von Grundlagen bis hin zur kreativen Entfaltung.
- Quote paper
- Benjamin Viale (Author), 2019, Das iPad im Instrumental- und Gesangsunterricht, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/925975