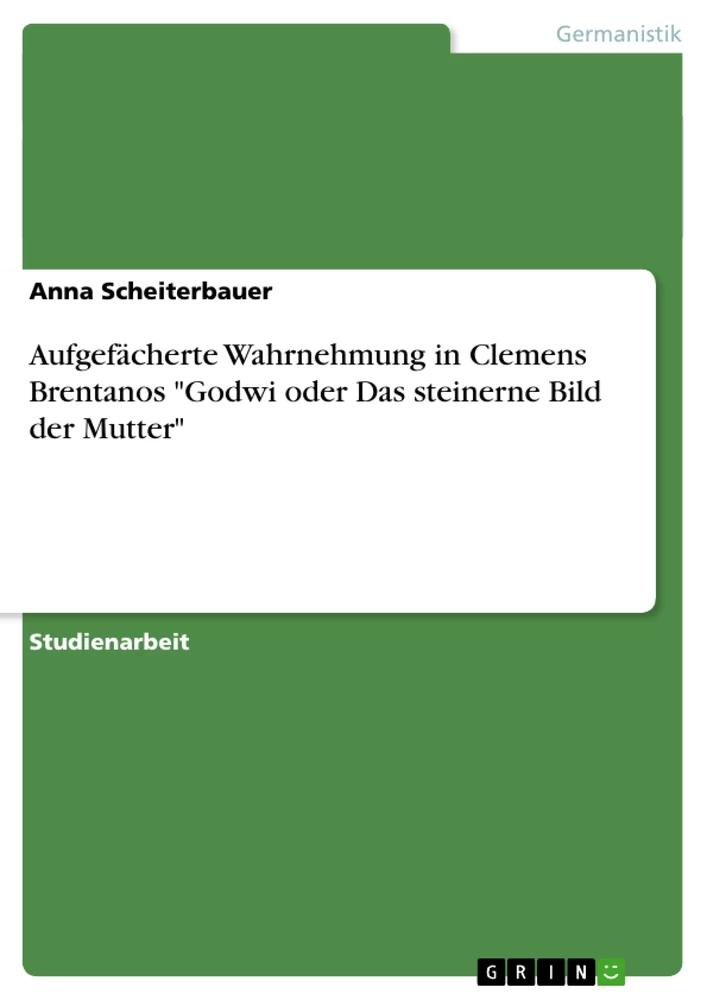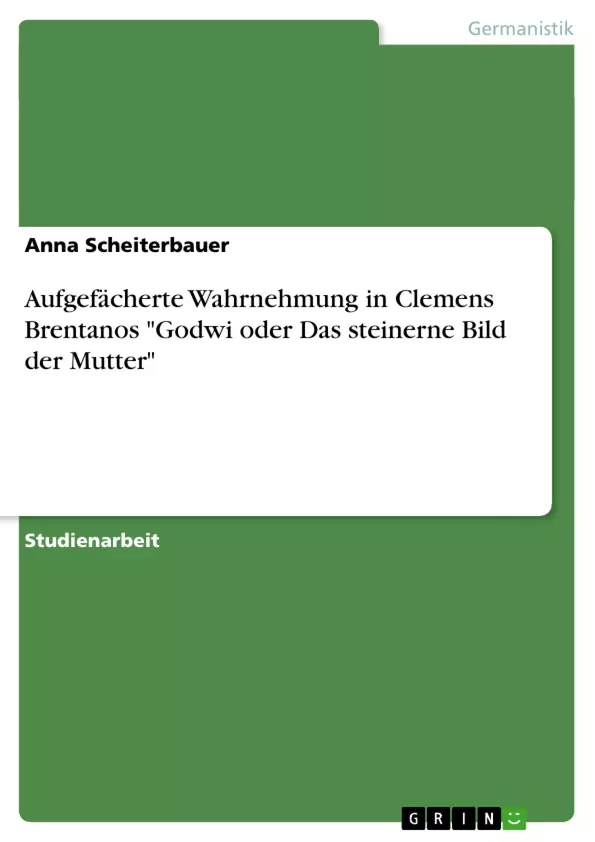Ein neuer philosophischer Anstoß im 18. Jahrhundert brachte eine philosophische Deutung der Sinne mit sich. Bis ins 18. Jahrhundert bedeutete „Aisthesis“ nach der griechischen Definition die neutrale Wahrnehmung durch die fünf Sinne. Seit der Ausprägung des Begriffes der „Ästhetik“ durch Alexander Gottlieb Baumgarten und der Reklamation der Ästhetik für die Philosophie wurde die Sinneswahrnehmung zu einem Thema der Künste.
Die Literatur der Romantik setzt sich auseinander mit den vielfältigen Aspekten der Wahrnehmung, mit der Wirkung der Sinneskräfte, mit der Erinnerung und schließlich mit der Projektion.
Die Philosophie der sinnlichen Erkenntnis besagt, dass wir das, was wir aus der Welt aufnehmen, als Phantasie im Kopf haben, und damit arbeiten. Man war der Ansicht, Kunst könne nur auf Grundlage der Erinnerung entstehen, und die Einbildungskraft wurde zu einer wichtigen Voraussetzung für die Kunst. Die Projektion als ein immer wiederkehrendes Thema der romantischen Literatur bedeutet die Übertragung eigener Erinnerungen auf die momentane Wirklichkeit.
Sinnliche Wahrnehmung wird nun nicht mehr als rezeptiver, sondern als aktiver Prozess aufgefasst. Es kommt zu einer Umkehrung der Innen- und der Außenwelt. Dabei hat die traditionelle Metapher der Sinne als das Fenster zur Seele ihre Gültigkeit behalten.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Der Betrachter rückt ins Bild:
- Subjektive Wahrnehmung – zum Problem der Vermittlung:
- Text - Bild - Projektionen:
- Aufgefächerte Wahrnehmung:
- Das Denkmal der Mutter:
- Das Denkmal der Violette:
- Künstlerische Einbildungskraft:
- Abschließendes und Weiterführendes:
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit analysiert die Rolle der Wahrnehmung in Clemens Brentanos Roman Godwi oder Das steinerne Bild der Mutter im Kontext der ästhetischen Umbrüche des 18. Jahrhunderts. Sie untersucht, wie die „aufgefächerte Wahrnehmung“ im Roman zum Ausdruck kommt, welche Rolle die Einbildungskraft in diesem Prozess spielt und wie die Verbindung von Erinnerung und Projektion die Wahrnehmung prägt.
- Die Rolle der Einbildungskraft in der subjektiven Wahrnehmung
- Das Konzept der „aufgefächerten Wahrnehmung“
- Die Verbindung von Erinnerung und Projektion
- Die Vermittlung von Bildern und Projektionen im Text
- Die ästhetischen Umbrüche des 18. Jahrhunderts
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung führt in die Thematik der Aisthesis im 18. Jahrhundert ein, beleuchtet die Entwicklung des Begriffs „Ästhetik“ und die Bedeutung der Sinneswahrnehmung in der romantischen Literatur. Die Arbeit stellt den Roman Godwi als Beispiel für die Auseinandersetzung mit Wahrnehmung, Einbildungskraft und Projektion vor.
Der Betrachter rückt ins Bild:
Dieser Abschnitt erörtert die ästhetischen Prozesse, die durch den Betrachter im Bild, wie in den Werken Caspar David Friedrichs, in den Vordergrund gestellt werden. Es wird aufgezeigt, wie Brentano in Godwi eine ähnliche Subjektivierung des Betrachtungs- und Wahrnehmungsprozesses realisiert und wie diese Prozesse in der multiperspektivischen Erzählstruktur des Romans zum Ausdruck kommen.
Subjektive Wahrnehmung – zum Problem der Vermittlung:
Dieser Abschnitt beleuchtet das Konzept der subjektiven Wahrnehmung in Godwi. Die Rolle von Gemälden und Statuen als zentrale Objekte der Wahrnehmung wird erörtert, wobei deren subjektive Interpretation und Vermittlung durch die Figuren im Mittelpunkt stehen. Die Methode der „Auffächerung der Wahrnehmung“ wird in diesem Zusammenhang vorgestellt und als Mittel zur Darstellung des Problems der subjektiven Wahrnehmung interpretiert.
Schlüsselwörter
Aisthesis, Wahrnehmung, Projektion, Einbildungskraft, Erinnerung, subjektive Wahrnehmung, aufgefächerte Wahrnehmung, Bilder, Gemälde, Statuen, ästhetische Umbrüche, Romantik, 18. Jahrhundert, Clemens Brentano, Godwi oder Das steinerne Bild der Mutter, Caspar David Friedrich
Was bedeutet der Begriff „Aisthesis“ im 18. Jahrhundert?
Ursprünglich die neutrale Wahrnehmung durch die Sinne, wandelte sich der Begriff mit der Entstehung der „Ästhetik“ hin zu einer philosophischen Deutung der sinnlichen Erkenntnis.
Wie wird Wahrnehmung in der Romantik aufgefasst?
Wahrnehmung gilt nicht mehr als rein rezeptiv, sondern als aktiver Prozess, bei dem Innen- und Außenwelt verschmelzen und die Einbildungskraft eine zentrale Rolle spielt.
Was versteht man unter „aufgefächerter Wahrnehmung“ bei Brentano?
Es beschreibt die multiperspektivische Darstellung von Objekten (wie Statuen oder Bildern) im Roman „Godwi“, wobei verschiedene Figuren das Objekt subjektiv unterschiedlich wahrnehmen.
Welche Rolle spielt die Projektion in der romantischen Literatur?
Projektion bedeutet die Übertragung eigener Erinnerungen und innerer Bilder auf die momentane Wirklichkeit, wodurch die Wahrnehmung der Realität subjektiv gefärbt wird.
Warum sind Denkmäler im Roman „Godwi“ so wichtig?
Denkmäler (wie das der Mutter) dienen als zentrale Objekte der Betrachtung, an denen sich die Prozesse von Erinnerung, Projektion und künstlerischer Einbildungskraft verdeutlichen lassen.