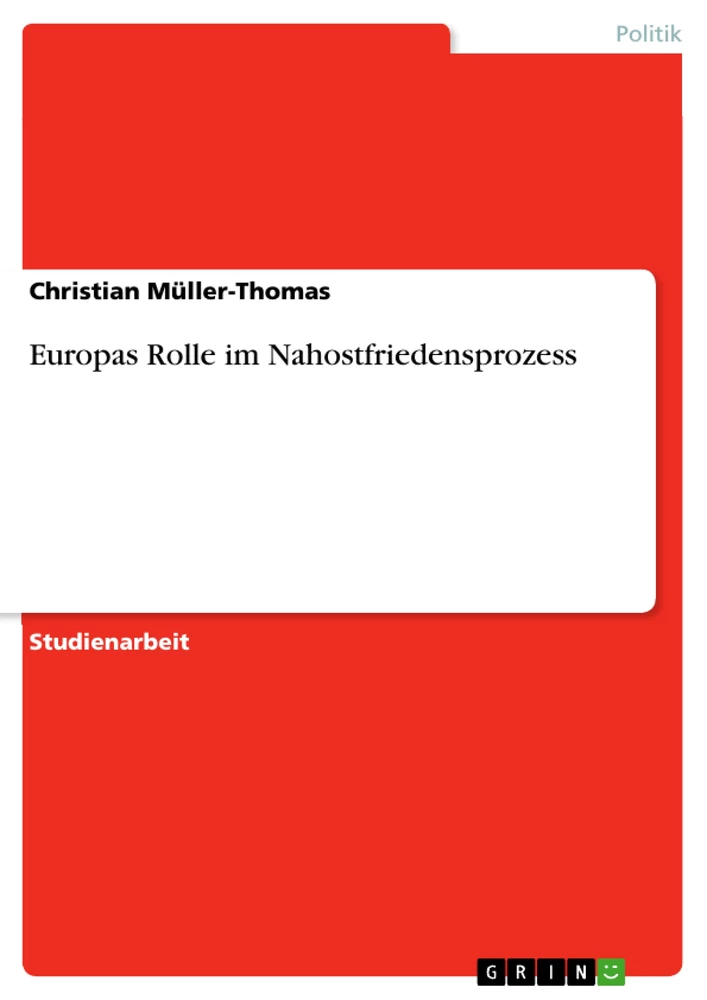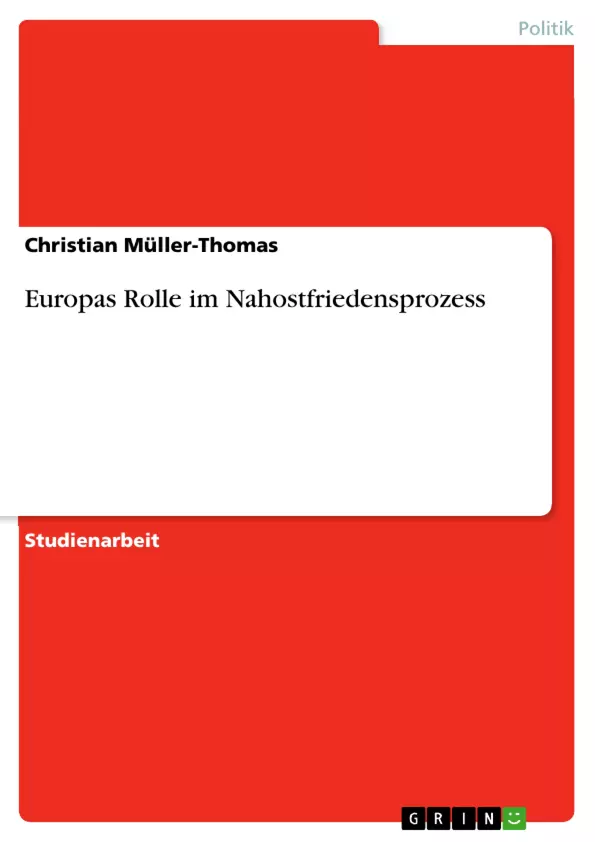Eine Annäherung außenpolitischer Handlungsmaxime der USA an die europäische Vorgehensweise im Nahostkonflikt ist im eigentlichen Sinne nicht problematisch. Da jedoch die USA nicht nur den größten Einfluss auf Israel besitzt, sondern mittlerweile auch im Nahen und Mittleren Osten die stärkste (vor allem militärische) Macht darstellt, verfügt sie über größere Einflussmöglichleiten auf die jeweiligen regionalen Akteure als es der EU möglich ist. Erschwerend kommt hinzu, dass die Gemeinsame Außen und Sicherheitspolitik (GASP) der EU bzw. die Europäische Sicherheits- und Verteidigungspolitik (ESVP) intergouvernemental geregelt ist. Eine reaktionäre Abstimmung auf die Konsequenzen im Umgang mit weltpolitischen Konflikten birgt deshalb die Gefahr der Uneinigkeit zwischen den Mitgliedern der EU. Vor allem der Riss innerhalb Europas, einhergehend mit der US-amerikanischen Intervention während des dritten Golfkrieges im Jahre 2003, verdeutlicht die Schwierigkeit eine einheitliche außenpolitische Positionierung für Europa zu finden und lässt erkennen, dass es Europa in Zeiten der Krise nach wie vor schwer fällt eine gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik nach außen zu vertreten. Während sich beispielsweise Großbritannien als primus inter pares der amerikanischen Verbündeten ohne zu zögern auf die Seite der USA stellte, reagierte Deutschland aus wahlkampftaktischen Gründen mit einem klaren nein. Frankreich verhielt sich vorsichtiger, Paris sprach sich zwar gegen ein unilaterales Handeln der USA aus, schloss aber ein militärisches Vorgehen gegen den Irak nicht prinzipiell aus.
Vor diesem skizzierten Hintergrund stellt sich die Frage, welche Möglichkeiten die EU besitzt, um sich als Krisen- und Konfliktmanager in den internationalen Beziehungen zu profilieren? Dabei ist es wichtig interne systemimmanente Regelungsmechanismen, aber auch Ziele der EU zu beleuchten, die entscheidenden Einfluss auf die außenpolitische Positionierung Europas nehmen. Bezüglich des Nahostkonfliktes bleibt es zu analysieren, welche Rolle die EU während verschiedenster Befriedungsbemühungen zwischen Israel und den Palästinensern einnimmt? Trotz zunehmender Annäherung in der Positionierung im Nahostfriedensprozess zwischen den USA und der EU, soll die Abhandlung besondere politstrategische Zielausrichtungen der EU im Nahen Osten herausarbeiten.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Theorien weltpolitischer Konflikte
- Konflikt nach realistischer Tradition
- Konflikt nach internationalistischer Tradition
- Konflikt nach universalistischer Tradition
- Zwischenfazit
- Der Nahostkonflikt – Eine historische Einführung
- Die Rolle der EU im Nahostfriedensprozess
- Die außen- und sicherheitspolitische Positionierung der Europäischen Union
- Etappen europäischer Nahostpolitik
- Der Osloer Friedensprozess
- Die Euromediterrane Partnerschaft
- Die Roadmap
- Ausblick – Neupositionierungen der EU im Nahostfriedensprozess
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Rolle der Europäischen Union (EU) im Nahostfriedensprozess. Ziel ist es, die außen- und sicherheitspolitische Positionierung der EU zu analysieren und herauszuarbeiten, welche Möglichkeiten die EU als Krisen- und Konfliktmanager besitzt. Dabei werden verschiedene weltpolitische Konflikttheorien herangezogen, um ein besseres Verständnis für den Nahostkonflikt und mögliche Lösungsansätze zu gewinnen.
- Analyse der außen- und sicherheitspolitischen Positionierung der EU im Nahostkonflikt
- Untersuchung verschiedener weltpolitischer Konflikttheorien und deren Anwendbarkeit auf den Nahostkonflikt
- Bewertung der Rolle der EU in verschiedenen Phasen des Friedensprozesses (Osloer Prozess, Euromediterrane Partnerschaft, Roadmap)
- Vergleich der außenpolitischen Strategien der EU und der USA im Nahostkonflikt
- Ausblick auf zukünftige Positionierungen der EU im Nahostfriedensprozess
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung beleuchtet die scheinbar ambivalente Rolle Europas im Nahostkonflikt, insbesondere nach dem Scheitern des Osloer Friedensprozesses. Sie hebt die Notwendigkeit eines stärkeren europäischen Engagements hervor, da die Ziele der EU und der USA im Konflikt zwar identisch sind, die Ansätze zur friedlichen Konfliktlösung jedoch differieren. Ein Zitat von Stefan Fröhlich unterstreicht die Notwendigkeit eines intensiveren europäischen Engagements, da die USA beginnen, Elemente des europäischen Konzepts multilateraler Verhandlungen in ihre Strategie einzubauen. Die Arbeit betont die Herausforderungen für die EU, eine einheitliche außenpolitische Position zu finden, insbesondere angesichts innerer Differenzen innerhalb der EU, wie sie sich z.B. während des Irakkrieges zeigten. Die Einleitung formuliert die zentrale Forschungsfrage nach den Möglichkeiten der EU, sich als Krisenmanager zu profilieren, und kündigt die Analyse der Rolle der EU in verschiedenen Befriedungsbemühungen an.
Theorien weltpolitischer Konflikte: Dieses Kapitel präsentiert ausgewählte theoretische Ansätze zur Erklärung weltpolitischer Konflikte, basierend auf der Systematik der Englischen Schule. Es werden die drei Traditionen des Realismus (Hobbesianisch), Internationalismus (Grotianisch) und Universalismus (Kantianisch) vorgestellt und unter dem Gesichtspunkt von Konflikten analysiert. Der Fokus liegt auf der Darstellung der unterschiedlichen Reichweiten und Erklärungskräfte dieser Ansätze und deren Beitrag zu einem besseren Verständnis von Lösungsansätzen. Der Realismus wird anhand der Theorien von Robert G. Gilpin und Samuel Huntington (Clash of Civilizations) erläutert, die den Konflikt als prinzipiell konfliktlastig und das Streben nach Macht und Sicherheit als zentrale Triebkraft beschreiben.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Analyse der Rolle der EU im Nahostfriedensprozess
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Die Arbeit analysiert die Rolle der Europäischen Union (EU) im Nahostfriedensprozess. Sie untersucht die außen- und sicherheitspolitische Positionierung der EU und deren Möglichkeiten als Krisen- und Konfliktmanager.
Welche theoretischen Ansätze werden verwendet?
Die Arbeit bezieht verschiedene weltpolitische Konflikttheorien ein, basierend auf der Systematik der Englischen Schule. Konkret werden der Realismus (Hobbesianisch), der Internationalismus (Grotianisch) und der Universalismus (Kantianisch) vorgestellt und auf den Nahostkonflikt angewendet.
Welche konkreten Themen werden behandelt?
Die Analyse umfasst die außen- und sicherheitspolitische Positionierung der EU, verschiedene Phasen des Friedensprozesses (Osloer Prozess, Euromediterrane Partnerschaft, Roadmap), einen Vergleich der außenpolitischen Strategien der EU und der USA, sowie einen Ausblick auf zukünftige Positionierungen der EU.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in folgende Kapitel: Einleitung, Theorien weltpolitischer Konflikte, Der Nahostkonflikt – Eine historische Einführung, Die Rolle der EU im Nahostfriedensprozess, und Ausblick – Neupositionierungen der EU im Nahostfriedensprozess. Jedes Kapitel wird im Inhaltsverzeichnis detailliert aufgelistet.
Welche Ziele verfolgt die Arbeit?
Ziel der Arbeit ist es, die außen- und sicherheitspolitische Positionierung der EU im Nahostkonflikt zu analysieren und die Möglichkeiten der EU als Krisen- und Konfliktmanager herauszuarbeiten. Ein besseres Verständnis des Nahostkonflikts und möglicher Lösungsansätze soll durch die Anwendung verschiedener Konflikttheorien erreicht werden.
Wie wird der Nahostkonflikt in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit bietet eine historische Einführung in den Nahostkonflikt und untersucht die Rolle der EU in verschiedenen Phasen des Friedensprozesses, unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Ansätze der EU und der USA zur Konfliktlösung.
Welche Rolle spielt der Vergleich zwischen der EU und den USA?
Die Arbeit vergleicht die außenpolitischen Strategien der EU und der USA im Nahostkonflikt, um die Unterschiede in ihren Ansätzen zur friedlichen Konfliktlösung herauszustellen.
Was ist das Ergebnis der Analyse?
Das Ergebnis der Analyse zeigt die Möglichkeiten und Herausforderungen für die EU auf, sich als Krisenmanager im Nahostkonflikt zu profilieren, unter Berücksichtigung der internen Differenzen innerhalb der EU und der unterschiedlichen Ansätze im Vergleich zu den USA.
Wie wird die Einleitung beschrieben?
Die Einleitung beleuchtet die ambivalente Rolle Europas im Nahostkonflikt, die Notwendigkeit eines stärkeren europäischen Engagements und die unterschiedlichen Ansätze der EU und der USA zur Konfliktlösung. Sie formuliert die zentrale Forschungsfrage nach den Möglichkeiten der EU als Krisenmanager.
Wie werden die Theorien weltpolitischer Konflikte dargestellt?
Das Kapitel zu den Theorien weltpolitischer Konflikte präsentiert ausgewählte Ansätze des Realismus, Internationalismus und Universalismus, analysiert deren Reichweiten und Erklärungskräfte und trägt zu einem besseren Verständnis von Lösungsansätzen bei.
- Quote paper
- Christian Müller-Thomas (Author), 2008, Europas Rolle im Nahostfriedensprozess, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/92841