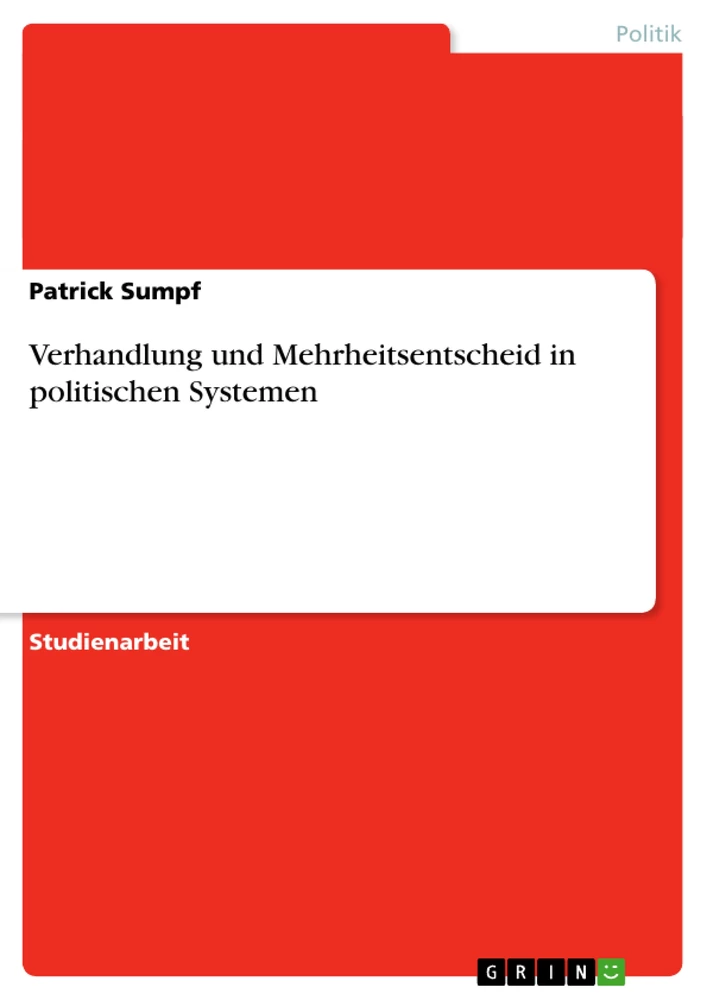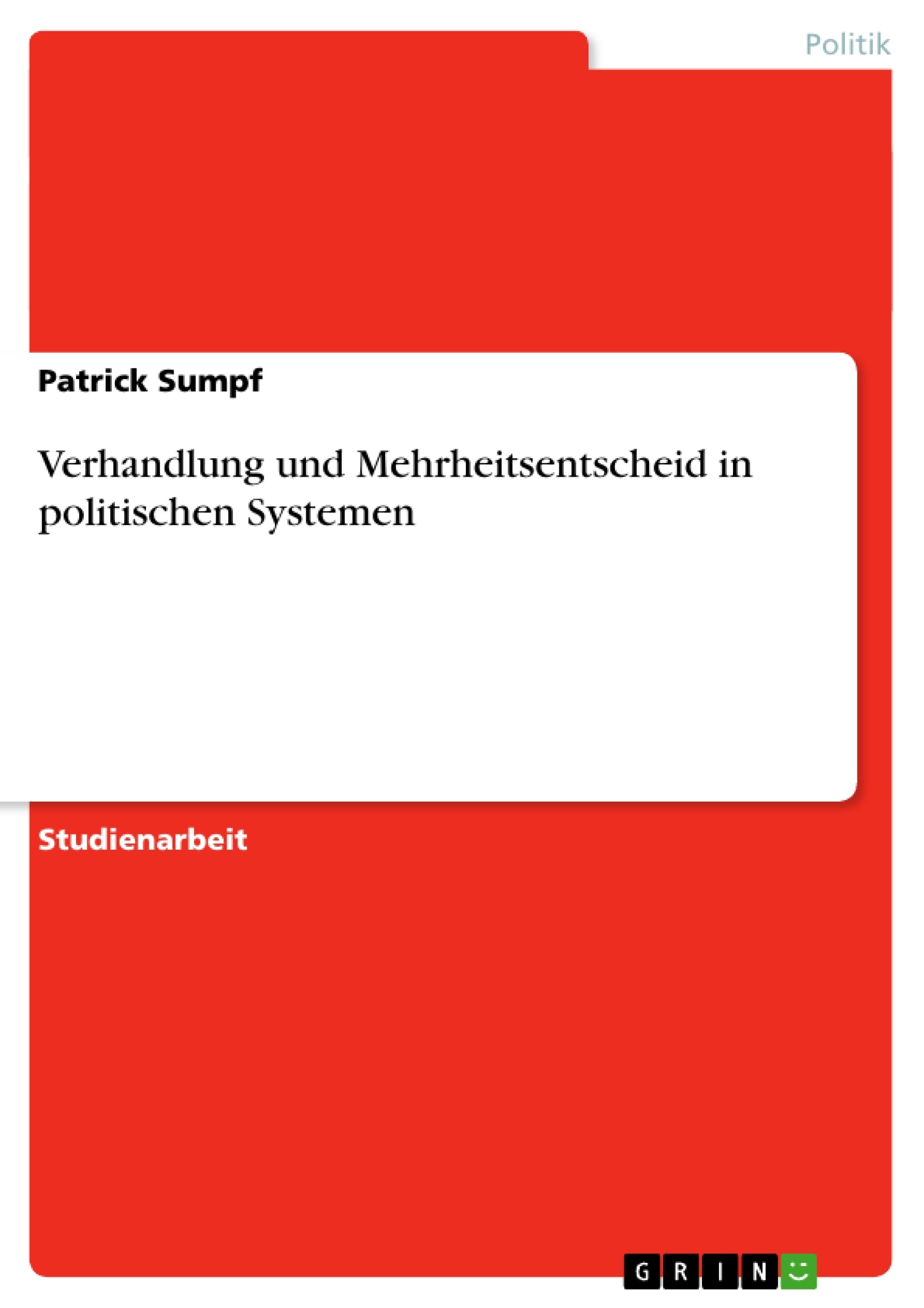Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich vornehmlich mit den unterschiedlichen Ausprägungen der Verhandlungsdemokratie. Sie versucht, durch den Vergleich zweier unterschiedlicher Ansätze (Roland Czada und Arend Lijphart) verhandlungsdemokratischer Phänomene einen Beitrag für das vertiefte Verständnis des Aufbaus und der Funktionsweise von Verhandlungsdemokratien sowie deren Art der Zuordnung zu bestimmten Ländergruppen zu schaffen. Anhand der Konzeptualisierung, des Datenmaterials und der Ergebnisse der Studien Arend Lijpharts (Lijphart 1999) soll die These von Roland Czada überprüft werden, dass die Verhandlungsdemokratie in die Dimensionen Konkordanz, Korporatismus, und Politikverflechtung zu differenzieren ist und sich aus diesen Variablen spezifische empirische Länderkonfigurationen sowie Schlussfolgerungen für das Zusammenspiel dieser drei Variablen in politischen Systemen ergäben. Schließlich sollen hieraus Anstöße für ein möglicherweise elaboriertes Modell der Verhandlungsdemokratie abgeleitet werden, das der Komplexität dieser Thematik gerecht wird.
Mit diesem Versuch geht auch eine Begriffsklärung der Termini einher, die regelmäßig im Zusammenhang mit dem Thema „Verhandlungsdemokratie“ auftreten (Konkordanz, Konsens, Konkurrenz usw.), sowie eine grobe Aufarbeitung und Beurteilung des Forschungsstandes und der wichtigsten Arbeiten und Autoren zu diesem Thema.
In Relation zu dem Demokratietypus der Verhandlungsdemokratie steht auch seine Abgrenzung zum (vermeintlich) konkurrierenden, ihm aber zumindest gegenüberstehenden Typus der Konkurrenz- bzw. Mehrheitsdemokratie. Auf die klassische Gegenüberstellung dieser beiden Demokratietypen wird in dieser Arbeit jedoch verzichtet, weil dies aus mehreren Gründen unfruchtbar erscheint. Letztlich ist zu klären, inwieweit spezifische Mischungsverhältnisse von verhandlungs- und mehrheitsorientierten Elementen den politischen Prozess beeinflussen. Diese Mischformen sind es nämlich, die das empirische Bild von Demokratien prägen und die für die zukünftige Entwicklung demokratischer Systeme von entscheidender Bedeutung sind.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Begriffsklärung
- Zum Verhältnis von Verhandlungs- und Mehrheitsdemokratie und dessen Implikationen
- Die Differenzierung der Verhandlungsdemokratie bei Roland Czada
- Lijpharts Konsensdemokratie
- Lijphart und Czada im Vergleich
- Ergebnisse
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht verschiedene Ausprägungen der Verhandlungsdemokratie durch den Vergleich der Ansätze von Roland Czada und Arend Lijphart. Ziel ist ein vertieftes Verständnis des Aufbaus und der Funktionsweise von Verhandlungsdemokratien und ihrer Zuordnung zu Ländergruppen. Die Arbeit überprüft Czadas These, dass die Verhandlungsdemokratie in die Dimensionen Konkordanz, Korporatismus und Politikverflechtung differenziert werden kann und daraus spezifische Länderkonfigurationen und Schlussfolgerungen für das Zusammenspiel dieser Variablen resultieren. Schließlich sollen Anstöße für ein elaboriertes Modell der Verhandlungsdemokratie abgeleitet werden.
- Vergleichende Analyse von Verhandlungsdemokratie-Modellen (Czada & Lijphart)
- Differenzierung der Verhandlungsdemokratie anhand von Konkordanz, Korporatismus und Politikverflechtung
- Empirische Länderkonfigurationen und das Zusammenspiel der drei Variablen
- Entwicklung eines elaborierten Modells der Verhandlungsdemokratie
- Begriffsabgrenzung im Kontext Verhandlungs- und Mehrheitsdemokratie
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Arbeit befasst sich mit unterschiedlichen Ausprägungen der Verhandlungsdemokratie und vergleicht die Ansätze von Roland Czada und Arend Lijphart, um ein vertieftes Verständnis des Aufbaus, der Funktionsweise und der Länderzuordnung von Verhandlungsdemokratien zu erlangen. Sie überprüft Czadas These, dass die Verhandlungsdemokratie in die Dimensionen Konkordanz, Korporatismus und Politikverflechtung differenzierbar ist, und daraus abgeleitete empirische Länderkonfigurationen und Schlussfolgerungen für das Zusammenspiel dieser drei Variablen in politischen Systemen untersucht. Der Fokus liegt auf der Verhandlungsdemokratie, da die zahlreichen Beiträge zu diesem Thema eine Aufarbeitung erfordern und die Thematik im englischsprachigen Raum vernachlässigt wird. Die Abgrenzung zur Mehrheitsdemokratie wird nicht als Konkurrenz, sondern als spezifisches Verhältnis betrachtet, das den politischen Prozess beeinflusst, da Mischformen aus verhandlungs- und mehrheitsorientierten Elementen das empirische Bild von Demokratien prägen.
Begriffsklärung: Der Begriff „Verhandlungsdemokratie“ wird als Oberbegriff für verschiedene Varianten „konstitutioneller nichtmajoritärer Demokratien“ verwendet (Schmidt 1998, 188). Die Wahl dieses Begriffs betont das in entsprechenden politischen Systemen vorherrschende Prinzip der Verhandlung gegenüber dem Mehrheitsprinzip. Der Begriff „Verhandlung“ ordnet den Konfliktregelungsmustern eine realistische Rationalität zu, im Gegensatz zur Annahme eines stets vorhandenen Konsenses. Die Rationalität politischer Tauschgeschäfte bestimmt das Verhalten der Akteure. Obwohl Lijpharts Ansatz als „Dissensdemokratie“ präziser wäre, bietet „Verhandlungsdemokratie“ eine bessere Synthese aus wissenschaftlicher Präzision und praktischer Verwendbarkeit.
Schlüsselwörter
Verhandlungsdemokratie, Mehrheitsdemokratie, Konkordanzdemokratie, Konsensdemokratie, Korporatismus, Politikverflechtung, Roland Czada, Arend Lijphart, Vergleichende Politikwissenschaft, Entscheidungsfindung, politische Systeme, Länderkonfigurationen, empirische Analyse.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Vergleichende Analyse von Verhandlungs- und Mehrheitsdemokratie
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Die Arbeit analysiert verschiedene Ausprägungen der Verhandlungsdemokratie im Vergleich der Ansätze von Roland Czada und Arend Lijphart. Ziel ist ein vertieftes Verständnis des Aufbaus und der Funktionsweise von Verhandlungsdemokratien und ihrer Zuordnung zu verschiedenen Ländern. Ein Schwerpunkt liegt auf der Überprüfung von Czadas These zur Differenzierung der Verhandlungsdemokratie anhand von Konkordanz, Korporatismus und Politikverflechtung.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit befasst sich mit dem Vergleich der Modelle von Czada und Lijphart, der Differenzierung der Verhandlungsdemokratie nach Konkordanz, Korporatismus und Politikverflechtung, empirischen Länderkonfigurationen und dem Zusammenspiel dieser Variablen, der Entwicklung eines elaborierten Modells der Verhandlungsdemokratie sowie der Begriffsabgrenzung zwischen Verhandlungs- und Mehrheitsdemokratie.
Wie werden Verhandlungs- und Mehrheitsdemokratie abgegrenzt?
Die Arbeit betrachtet das Verhältnis von Verhandlungs- und Mehrheitsdemokratie nicht als Konkurrenz, sondern als spezifisches, das politische Prozesse beeinflussendes Verhältnis. Es wird anerkannt, dass Mischformen aus verhandlungs- und mehrheitsorientierten Elementen das empirische Bild von Demokratien prägen. Der Begriff „Verhandlungsdemokratie“ wird als Oberbegriff für verschiedene Varianten „konstitutioneller nichtmajoritärer Demokratien“ verstanden, wobei das Prinzip der Verhandlung gegenüber dem Mehrheitsprinzip hervorgehoben wird.
Welche Rolle spielen Konkordanz, Korporatismus und Politikverflechtung?
Czada differenziert die Verhandlungsdemokratie anhand dieser drei Dimensionen. Die Arbeit untersucht, wie diese Variablen in verschiedenen politischen Systemen zusammenspielen und welche Länderkonfigurationen sich daraus ergeben. Ziel ist es, diese Zusammenhänge zu analysieren und in ein erweitertes Modell der Verhandlungsdemokratie zu integrieren.
Welche Autoren werden verglichen?
Die Arbeit vergleicht die Ansätze von Roland Czada und Arend Lijphart zur Verhandlungsdemokratie. Der Vergleich dient dazu, die verschiedenen Facetten und Ausprägungen dieses Demokratiemodells zu beleuchten und ein umfassenderes Verständnis zu entwickeln.
Was ist das Fazit der Arbeit?
(Das Fazit ist im vorliegenden Textfragment nicht explizit zusammengefasst, es wird jedoch angestrebt, ein elaboriertes Modell der Verhandlungsdemokratie zu entwickeln, das die untersuchten Dimensionen und die Erkenntnisse aus dem Vergleich der Ansätze von Czada und Lijphart berücksichtigt.)
Welche Schlüsselbegriffe sind relevant?
Schlüsselbegriffe sind Verhandlungsdemokratie, Mehrheitsdemokratie, Konkordanzdemokratie, Konsensdemokratie, Korporatismus, Politikverflechtung, Roland Czada, Arend Lijphart, Vergleichende Politikwissenschaft, Entscheidungsfindung, politische Systeme, Länderkonfigurationen und empirische Analyse.
Welche Kapitel enthält die Arbeit?
Die Arbeit umfasst eine Einleitung, eine Begriffsklärung, ein Kapitel zum Verhältnis von Verhandlungs- und Mehrheitsdemokratie mit Unterkapiteln zu Czada, Lijphart und einem Vergleich beider, sowie ein Fazit.
- Quote paper
- Patrick Sumpf (Author), 2007, Verhandlung und Mehrheitsentscheid in politischen Systemen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/92925