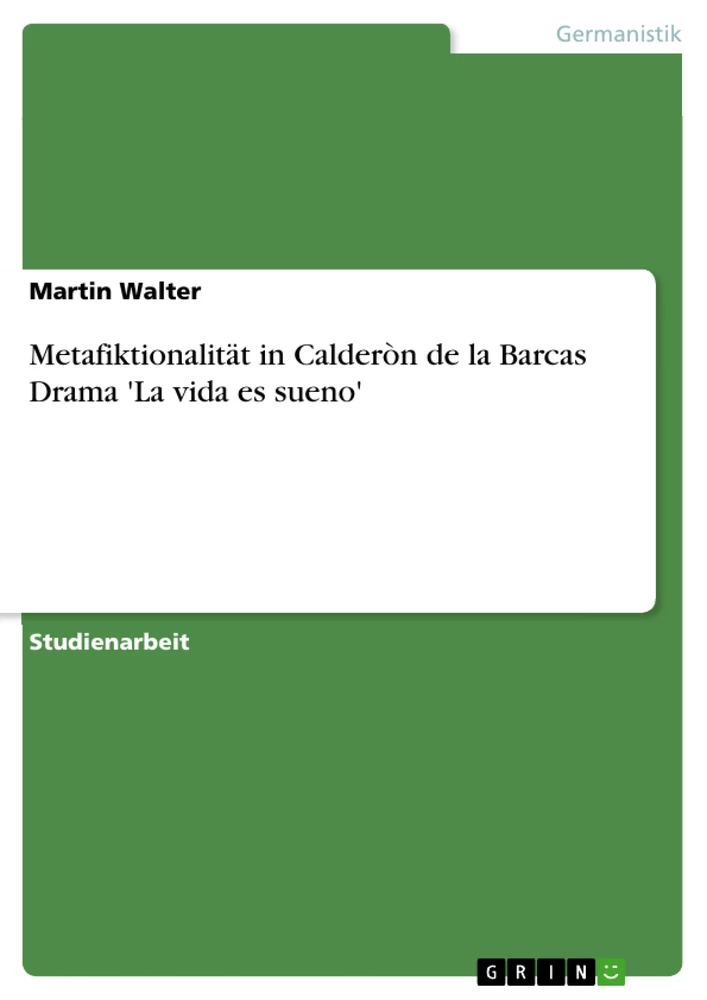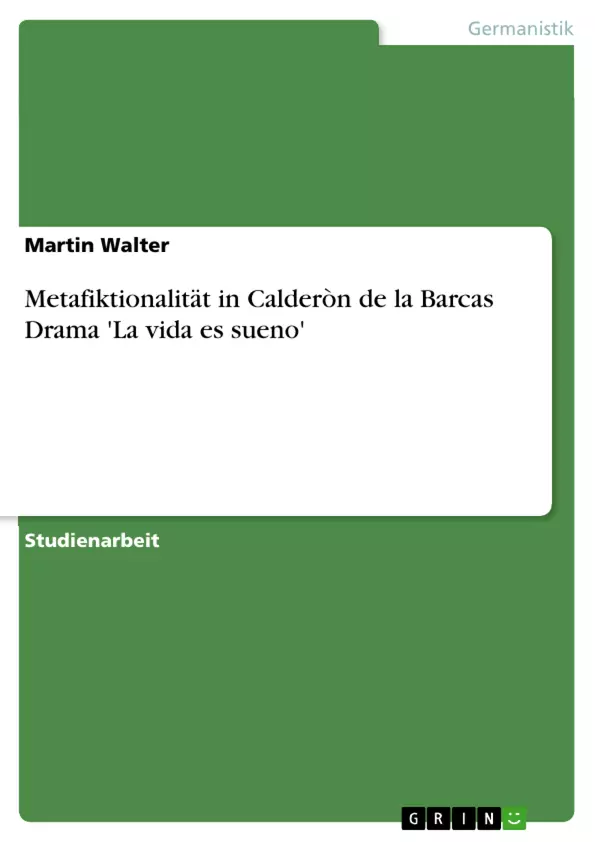Calderón de la Barca gilt als der bedeutendste Protagonist des spanischen Theaters der Barockzeit, sein philosophisch-theologisches Ideendrama La vida es sueño sticht als das berühmteste und am weitesten verbreitete Werk aus seinem Œuvre hervor. Daher ist auch die Menge der Interpretationen und inhaltlichen Analysen zum dem Drama von großer Zahl. Bis heute ist sich die Forschung nicht einig, in welche Richtung die Interpretation und infolgedessen eine Schlussfolgerung, eine Botschaft aus Calderóns Werk letztlich gehen muss.
Ziel dieser Arbeit soll es bei der Untersuchung von La vida es sueño allerdings gerade nicht sein, eine weitere Zusammenfassung dieser zahlreichen Auslegungsansätze zu liefern und daraus eine mögliche Botschaft des Stückes heraus zu filtern. Vielmehr soll im Folgenden das Stück an sich zwar auch inhaltlich thematisiert und untersucht werden, jedoch wird der Fokus dabei in erster Linie auf Aspekte der Metafiktionalität gerichtet sein.
Voraussetzung für eine eingehendere Betrachtung von Metafiktionalität in Calderóns Werk ist zunächst, wie schon angedeutet, natürlich dennoch eine Auseinandersetzung mit der Handlung des Dramas und möglichen Interpretationsversuchen. Sodann gilt es die Begrifflichkeiten der Themenstellung näher zu beleuchten und vor allem eine klare Definition des Terminus Metafiktion festzulegen, ehe dann im Hauptteil der Arbeit intensiv auf die eigentliche Themenstellung eingegangen werden kann. Dort gilt es zu prüfen, ob und in welcher Form Calderón de la Barca bereits im 17. Jahrhundert Metafiktion bewusst in seinem Schauspiel eingesetzt hat. Dafür wird eine eng an den Primärtext gebundene Form der Darstellung nötig sein. Die Sekundärliteratur bezüglich Calderón und seinem Drama La vida es sueño ist, was ob seiner intensiven Rezeptionsgeschichte kaum verwunderlich erscheint, relativ umfangreich und zeitlich breit gestreut, wobei sich die vorliegende Ausarbeitung in der Hauptsache auf deutschsprachige Forschungsliteratur bezieht. Vor allem seien hier Christoph Strosetzki und sein Buch über Calderón genannt, ebenso aber Max Kommerells Aufsatz über Die Kunst Calderóns oder Martin Franzbachs Untersuchungen zum calderónschen Theater.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Zu Inhalt und Interpretation von La vida es sueño
- 2.1 Inhaltsangabe
- 2.1.1 Die Haupthandlung
- 2.1.2 Die Nebenhandlung
- 2.1.3 Zusammenfassung
- 2.2 Quellen
- 2.3 Interpretationsversuche
- 2.1 Inhaltsangabe
- 3. Definition von Metafiktion
- 4. Metafiktionalität in La vida es sueño
- 4.1 Komische Elemente
- 4.2 Inszenierungen und Beobachtungen
- 4.3 Das Medium Theater
- 4.4 Theatermetaphern
- 4.5 Das Ende des Stückes
- 5. Schlussbetrachtungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht Calderóns La vida es sueño nicht im Hinblick auf eine weitere Interpretation der Handlung und der daraus resultierenden Botschaft. Stattdessen fokussiert sie sich auf Aspekte der Metafiktionalität im Drama. Die Analyse umfasst zunächst eine Auseinandersetzung mit der Handlung und bestehenden Interpretationsansätzen, gefolgt von einer Klärung des Begriffs "Metafiktion". Der Hauptteil der Arbeit analysiert dann die Verwendung von Metafiktion in Calderóns Werk und untersucht, in welcher Form er diese literarische Technik im 17. Jahrhundert einsetzte.
- Analyse der Handlung von La vida es sueño
- Definition und Klärung des Begriffs Metafiktion
- Untersuchung der Metafiktionalität in La vida es sueño
- Analyse der Verwendung von komischen Elementen, Inszenierungen und Theatermetaphern
- Beurteilung des bewussten Einsatzes von Metafiktion durch Calderón
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik ein und benennt Calderón de la Barca als bedeutenden Dramatiker des spanischen Barocktheaters. La vida es sueño wird als sein berühmtestes Werk hervorgehoben, dessen vielschichtige Interpretationen bis heute Gegenstand der Forschung sind. Die Arbeit kündigt an, sich nicht auf die bereits existierenden Interpretationsansätze zu konzentrieren, sondern den Fokus auf die Metafiktionalität des Stückes zu legen. Sie skizziert den Aufbau der Arbeit, der eine Auseinandersetzung mit der Handlung und Interpretationsversuchen, eine Definition von Metafiktion und schließlich die Analyse der Metafiktionalität in La vida es sueño umfasst.
2. Zu Inhalt und Interpretation von La vida es sueño: Dieses Kapitel bietet einen Überblick über Inhalt und Interpretationen von La vida es sueño. Es skizziert die Haupt- und Nebenhandlung des Dramas, beleuchtet die Quellenlage und diskutiert verschiedene Interpretationsansätze, die in der Forschung zu Calderóns Werk existieren. Die Zusammenfassung der Handlung bietet einen Einblick in die Geschichte von König Basilius, der seinen Sohn Sigismund aufgrund einer astrologischen Prophezeiung in einem Turm gefangen hält. Der kurze Aufenthalt Sigismunds im Palast, seine darauf folgende Reaktion, und die damit verbundene Konfrontation mit seiner wahren Natur werden als zentrale Elemente hervorgehoben. Die unterschiedlichen Interpretationsansätze werden lediglich angedeutet, ohne detailliert dargelegt zu werden. Die Konzentration liegt auf der Bereitstellung des notwendigen Hintergrundwissens für die spätere Analyse der Metafiktionalität.
3. Definition von Metafiktion: Dieses Kapitel widmet sich der genauen Definition des Begriffs "Metafiktion". Es klärt die theoretischen Grundlagen, die für das Verständnis des zentralen Themas der Arbeit unerlässlich sind. Diese Definition bildet die Basis für die anschließende Analyse der Metafiktion in Calderóns Werk. Es werden verschiedene Ansätze zur Definition des Begriffs beleuchtet und eine Arbeitsdefinition für die weitere Analyse festgelegt. Dies stellt sicher, dass die Analyse der Metafiktionalität in La vida es sueño auf einer fundierten theoretischen Basis beruht.
4. Metafiktionalität in La vida es sueño: Der Hauptteil der Arbeit analysiert die Metafiktionalität in La vida es sueño. Es werden verschiedene Aspekte des Dramas untersucht, die auf die bewusste Konstruktion und Reflexion der Fiktionalität hinweisen. Dies umfasst die Analyse komischer Elemente, Inszenierungen und Beobachtungen im Stück, die Rolle des Mediums Theater, den Einsatz von Theatermetaphern und die Bedeutung des Endes des Stückes für die Interpretation der Metafiktionalität. Die Untersuchung basiert auf einer detaillierten Analyse des Primärtextes und sucht nach Hinweisen auf Calderóns bewusstes Spiel mit der theatralen Wirklichkeit und der Reflexion der Grenzen zwischen Fiktion und Realität.
Schlüsselwörter
Calderón de la Barca, La vida es sueño, spanisches Barocktheater, Metafiktion, Theater, Traum, Realität, Fiktion, Interpretation, Philosophie, Theologie.
Häufig gestellte Fragen zu Calderóns "La vida es sueño" - Metafiktion im spanischen Barocktheater
Was ist der Fokus dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert Calderóns "La vida es sueño" unter dem Aspekt der Metafiktionalität. Im Gegensatz zu herkömmlichen Interpretationsansätzen, die sich auf Handlung und Botschaft konzentrieren, liegt der Schwerpunkt auf der bewussten Konstruktion und Reflexion der Fiktionalität im Drama.
Welche Aspekte werden in der Analyse untersucht?
Die Analyse umfasst die Untersuchung komischer Elemente, Inszenierungen und Beobachtungen im Stück, die Rolle des Mediums Theater, den Einsatz von Theatermetaphern und die Bedeutung des Endes des Stückes für die Interpretation der Metafiktionalität. Die Arbeit basiert auf einer detaillierten Analyse des Primärtextes.
Wie ist die Arbeit aufgebaut?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zur Handlung und Interpretation von "La vida es sueño", ein Kapitel zur Definition von Metafiktion, den Hauptteil zur Metafiktionalität in "La vida es sueño" und abschließende Schlussbetrachtungen. Sie beinhaltet eine Inhaltsangabe, die Erläuterung verschiedener Interpretationsansätze und eine detaillierte Analyse der im Drama verwendeten literarischen Techniken.
Was ist der Begriff "Metafiktion" und wie wird er in dieser Arbeit definiert?
Der Begriff "Metafiktion" wird im dritten Kapitel genau definiert. Die Arbeit beleuchtet verschiedene Ansätze zur Definition des Begriffs und legt eine Arbeitsdefinition fest, die als Grundlage für die Analyse der Metafiktionalität in Calderóns Werk dient.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Calderón de la Barca, La vida es sueño, spanisches Barocktheater, Metafiktion, Theater, Traum, Realität, Fiktion, Interpretation, Philosophie, Theologie.
Welche Kapitel gibt es und worum geht es in ihnen?
Die Arbeit enthält folgende Kapitel: Einleitung (Einführung in die Thematik und die Arbeit), Inhalt und Interpretation von La vida es sueño (Handlung, Quellen und Interpretationsansätze), Definition von Metafiktion (theoretische Grundlagen), Metafiktionalität in La vida es sueño (Hauptteil der Analyse) und Schlussbetrachtungen (Zusammenfassung und Ausblick).
Welche Zusammenfassung der Handlung von "La vida es sueño" wird geboten?
Die Zusammenfassung skizziert die Haupt- und Nebenhandlung, wobei die Geschichte von König Basilius und seinem Sohn Sigismund im Mittelpunkt steht. Der Fokus liegt auf Sigismunds Gefangenschaft, seinem kurzen Aufenthalt im Palast und seiner Konfrontation mit seiner wahren Natur.
Wie werden bestehende Interpretationsansätze behandelt?
Bestehende Interpretationsansätze werden im Kapitel "Zu Inhalt und Interpretation von La vida es sueño" kurz angerissen. Der Fokus der Arbeit liegt jedoch nicht auf diesen Ansätzen, sondern auf der Analyse der Metafiktionalität.
Welche Rolle spielt das Theater als Medium in der Analyse?
Die Rolle des Theaters als Medium spielt eine zentrale Rolle in der Analyse der Metafiktionalität. Die Arbeit untersucht, wie Calderón die theatralische Wirklichkeit und die Grenzen zwischen Fiktion und Realität im Drama bewusst einsetzt und reflektiert.
- Quote paper
- Martin Walter (Author), 2007, Metafiktionalität in Calderòn de la Barcas Drama 'La vida es sueno', Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/92934