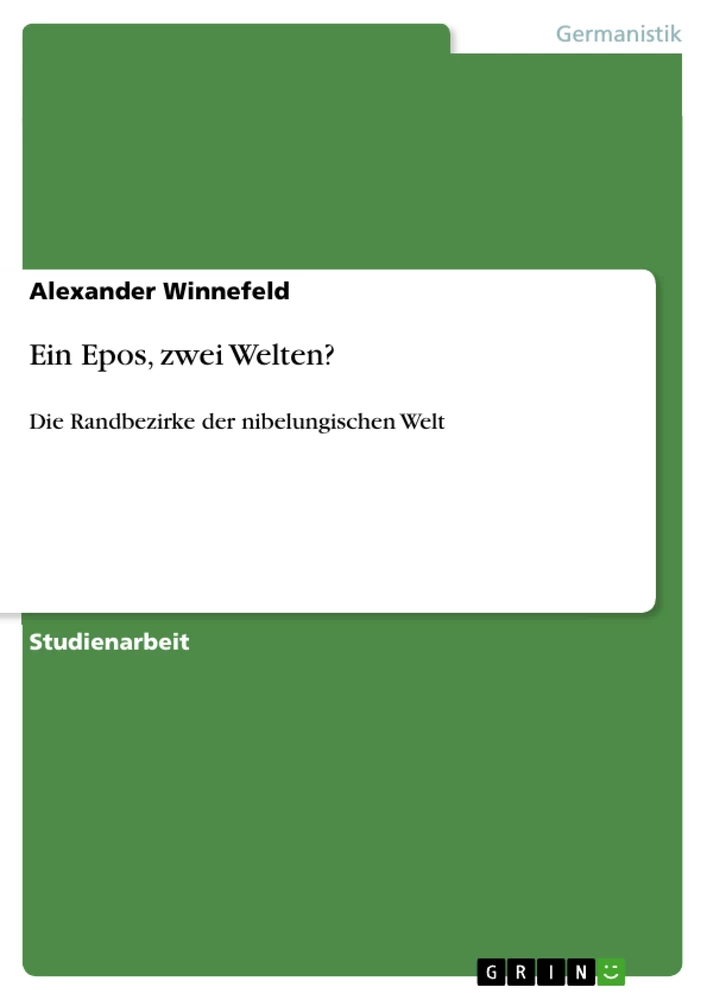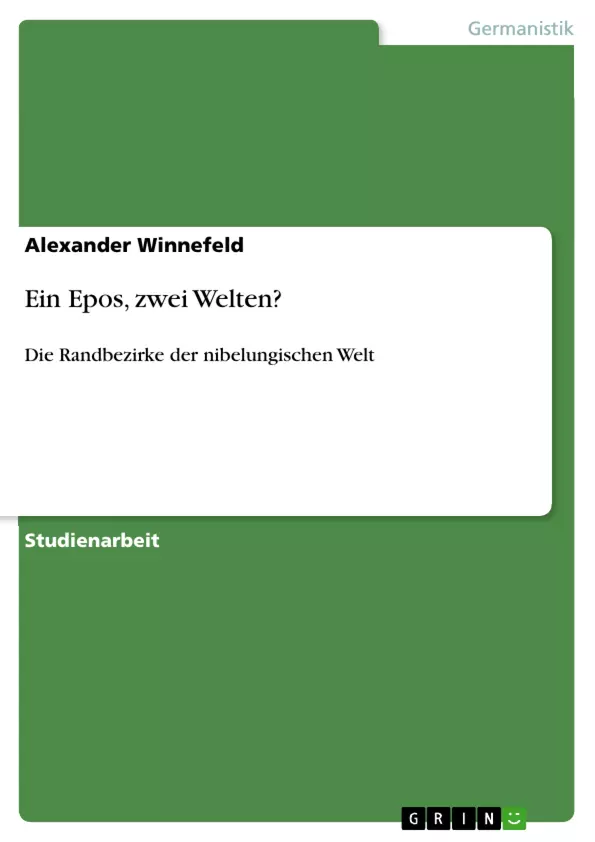Die Arbeit untersucht die 'Topographie' des Nibelungenliedes und setzt sich dabei kritisch mit dem von Jan-Dirk Müller herausgearbeiteten Gegensatz von 'höfischer' und 'heroischer' Welt auseinander.
Sie untersucht die Angaben zu geographischer Position und gesellschaftlicher Ordnung in Bezug auf die Randorte Isenstein, Niderlant und Nibelungenland und hinterfragt, inwiefern sich die Beschaffenheit der Länder tatsächlich in die von Müller entworfene 'Untergangsstruktur' integrieren lässt.
Einleitung:
Die Welt des Nibelungenliedes zerfällt, so Jan-Dirk Müller in seiner Studie „Spielregeln für den Untergang“, in zwei Zonen: zum einen die höfische, die Worms und Xanten ebenso wie Bechelaren und Etzelnburc umfasse; und auf der anderen Seite in jene „fremdartige“, heroische Welt, wie sie dem Leser auf Isenstein oder im Nibelungenland begegne. Diese Welten seien klar abgrenzbar und würden nur zwei mal überschritten werden - einmal, als Isenstein quasi kolonisiert, in die höfische Zone überführt werde, und dann ein zweites mal, als die mythische Welt zurückschlage und die höfische ‚überwuchere’ und schließlich ins Verderben ziehe .
Bei allem Wert, den Müllers Werk als Plädoyer gegen den Ausschließlichkeitsanspruch sagengeschichtlicher Herangehensweisen hat, so scheint er mir an dieser Stelle doch genau in die Falle der Sinnunterstellung hereinzulaufen, vor der Joachim Heinzle gewarnt hat. Es ist richtig, dass nicht jede Ungereimtheit im Nibelungenlied ein Fehler ist, dass uns die „nibelungische“ Art des Erzählens z.T. einfach sehr fremd ist; Müller scheint mir jedoch vor allem im Detail dem Bearbeiter (oder den Bearbeitern) des Nibelungenliedes eine zu sehr an neuzeitlichen Maßstäben orientierte Verfügungsgewalt über den Stoff zuzuschreiben, wenn er den aus verschiedenen Traditionen zusammengeflossenen Text als bis ins Kleinste durchorganisiertes Zeichensystem liest.
Ziel dieser Arbeit soll es nun sein, die Länder des Nibelungenliedes nach Lage wie nach Sitten, unabhängig von einer Gesamtdeutung des Epos, zu beschreiben, und aufzuzeigen, ob und wie sich die nibelungische Welt im Detail aufgliedert. In Anbetracht des beschränkten Umfanges geschieht dies hauptsächlich mit Blick auf die ‚Randzonen’ der Erzählung, allerdings mit der Gegenfolie der im Mittelpunkt der Erzählung stehenden Höfe von Worms und Etzelnburc.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung: Ein Epos, zwei Welten?
- Das ,,Wuchern\" des Nibelungennamens
- Nibelungische Randorte
- Ez was ein küneginne gesezzen über sê – Island
- Nidene bî dem Rîne – Niderlant
- Ze Norwaege in der marke - Das Nibelungenland
- Das Verschwimmen der Randzonen: Das Nibelungenland und Niderlant ab der 12. Aventiure
- Andere Randgebiete
- Abschlussbetrachtung - Eine alternative Topographie des Nibelungenliedes
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die topographischen Randzonen des Nibelungenliedes und hinterfragt die Annahme von zwei klar abgrenzbaren Welten im Epos. Sie analysiert die geografische und kulturelle Lage dieser Randgebiete und bewertet, inwiefern sie sich von der höfischen Welt von Worms und Etzelnburc unterscheiden.
- Untersuchung der geografischen und kulturellen Lage der Randzonen im Nibelungenlied
- Analyse der spezifischen Sitten und Gebräuche dieser Regionen
- Bewertung der Annahme von zwei klar abgrenzbaren Welten im Epos
- Hinterfragen der vermeintlichen "Untergangsstruktur" des Nibelungenliedes
- Erstellung einer alternativen Topographie des Epos
Zusammenfassung der Kapitel
- Die Einleitung befasst sich mit der These von Jan-Dirk Müller, der die Welt des Nibelungenliedes in zwei Zonen unterteilt: eine höfische und eine heroische Welt. Die Arbeit kritisiert Müllers Deutung des "Wucherns" des Nibelungennamens als Zeichen eines Einbruchs der heroischen Welt in die höfische. Der Autor argumentiert, dass diese Deutung nicht zwingend ist und alternative Erklärungen für die Namensgebung im Nibelungenlied und in verwandten nordischen Texten möglich sind.
- Das zweite Kapitel widmet sich den Randzonen des Nibelungenliedes. Als Beispiel wird die Lokalisierung Isensteins analysiert. Der Autor widerlegt Müllers Behauptung, dass Isenstein "außerhalb der bekannten Welt" liege. Er argumentiert, dass die geografische Positionierung Islands im Nibelungenlied pragmatisch erklärt werden kann und nicht als Indiz für eine "heroische" Anderswelt dient. Auch die Sitten Isensteins deuten nicht durchweg auf eine archaisch-heroische Gesellschaft hin.
Schlüsselwörter
Nibelungenlied, Topografie, Randzonen, heroische Welt, höfische Welt, Isenstein, Nibelungenname, Ortsbestimmung, Sitten, Gebräuche, Müller, Heinzle
Häufig gestellte Fragen
Was ist die zentrale These von Jan-Dirk Müller zum Nibelungenlied?
Müller vertritt die Ansicht, dass die Welt des Epos in zwei Zonen zerfällt: eine „höfische“ Welt (wie Worms) und eine „heroische/fremdartige“ Welt (wie Isenstein).
Was kritisiert der Autor an Müllers Modell?
Der Autor kritisiert, dass Müller dem Text ein zu modernes, durchorganisiertes Zeichensystem unterstellt und die Randzonen zu stark als mythische „Anderswelten“ deutet.
Wo liegt Isenstein laut dem Nibelungenlied?
Isenstein wird im Epos in Island lokalisiert. Die Arbeit argumentiert, dass diese Lage geografisch-pragmatisch und nicht zwingend als „außerhalb der Welt“ zu verstehen ist.
Welche Orte zählen zu den „Randzonen“ des Epos?
Zu den untersuchten Randorten gehören Island (Isenstein), Niderlant (Xanten) und das Nibelungenland (Norwegen).
Was bedeutet das „Wuchern“ des Nibelungennamens?
Es bezeichnet die Beobachtung, dass der Name „Nibelungen“ im Verlauf der Erzählung auf verschiedene Gruppen übergeht, was Müller als Einbruch des Mythischen deutet.
Gibt es wirklich zwei getrennte Welten im Nibelungenlied?
Die Arbeit kommt zu dem Schluss, dass die Grenzen zwischen höfischer und heroischer Welt oft verschwimmen und eine alternative Topographie des Epos sinnvoller ist.
- Citation du texte
- Alexander Winnefeld (Auteur), 2008, Ein Epos, zwei Welten?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/92962