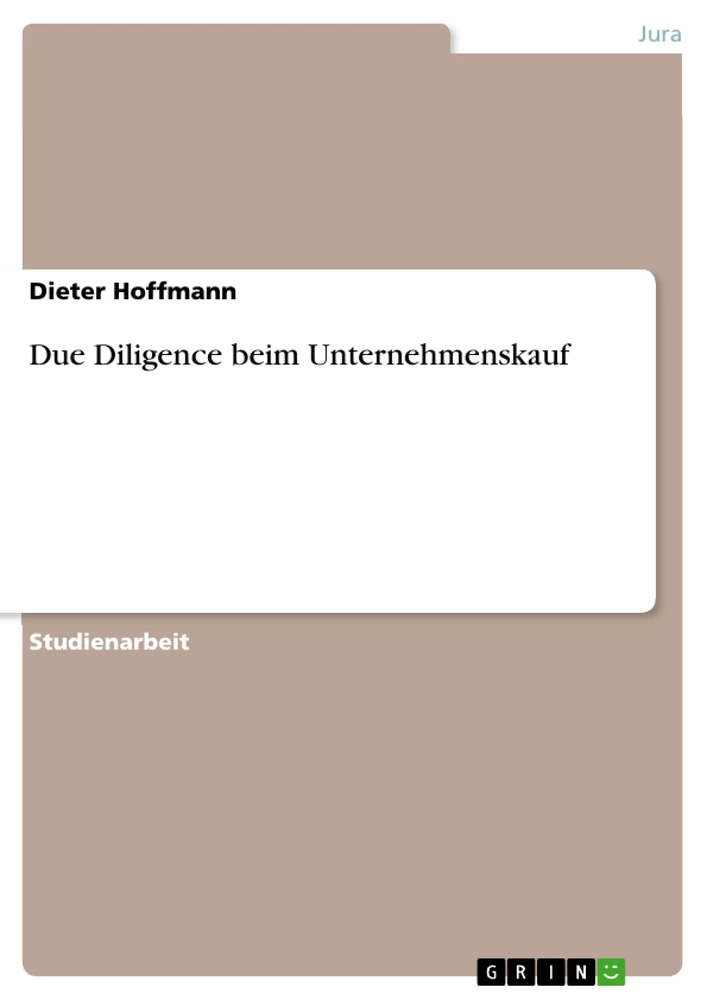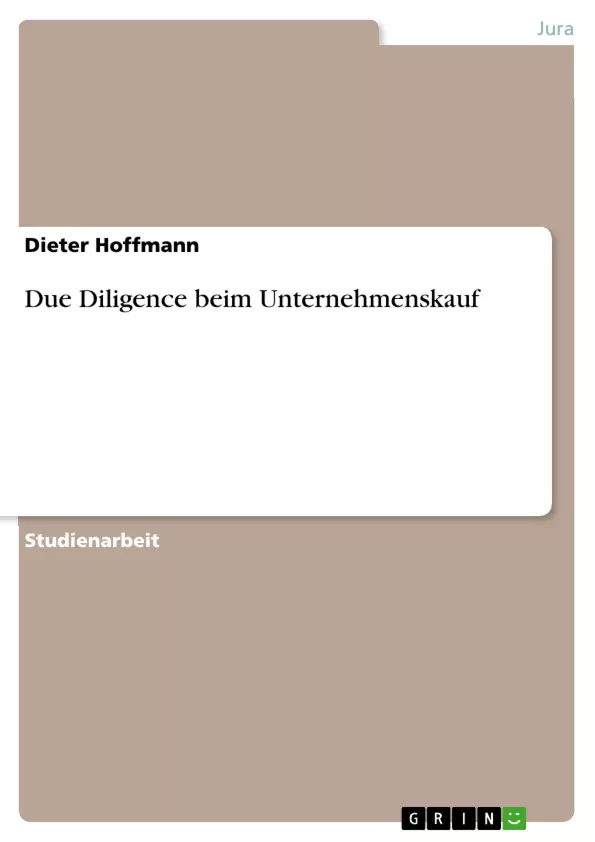Due Diligence-Untersuchungen gewinnen bei Unternehmenszusammenschlüssen und Unternehmenskäufen zunehmend an Bedeutung. Dies ist u.a. mit der Globalisierung, dem Trend zum Kerngeschäft, und damit zur Bereinigung der Bandbreite, sowie dem Kapitalbedarf für erforderliche Investitionen begründet. Da es sich bei einem Unternehmen um ein äußerst komplexes Kaufobjekt handeln kann, kommt einer umfassenden Due Diligence eine herausragende Bedeutung bei der Reduzierung des Käuferrisikos zu.
Hinsichtlich der Due Diligence werden vorrangig die bürgerlichrechtlichen Aspekte betrachtet. Soweit gesellschafts- und kapitalmarktrechtliche Themen besprochen werden, sind börsennotierte Aktiengesellschaften ausgenommen. Eine Unterscheidung nach den Grundformen des Unternehmenskaufs (Asset Deal, Share Deal) erfolgt nur dann, wenn dieses nötig ist. Zunächst erfolgen die Bestimmung der wichtigsten Begriffe, die Nennung der gängigsten Due Diligence-Arten und die rechtliche Einordnung der Due Diligence. Danach werden die möglichen Rechtsfolgen bei Unterlassung sowie nach Durchführung einer Due Diligence erörtert. Die Beschreibung von Verschwiegenheitspflichten und Haftungsfragen hinsichtlich externer Berater, sog. Beraterhaftung, und Leitungsorganen sowie eine Zusammenfassung schließen diese Arbeit ab.
Inhaltsverzeichnis
- A. Einführung in das Thema und Abgrenzung
- I. Einführung in das Thema
- II. Inhalt und Abgrenzung
- B. Begriffsbestimmungen und rechtliche Einordnung
- I. Unternehmen und Unternehmenskauf
- 1. Der Unternehmensbegriff
- 2. Der Unternehmenskauf
- a) Grundformen des Unternehmenskaufs
- b) Zivilrechtliche Einordnung des Unternehmenskaufs
- II. Die Due Diligence
- 1. Begriff und Zweck der Due Diligence
- 2. Arten der Due Diligence und Einordnung in den Ablauf eines Unternehmenskaufs
- a) Ansicht der Rechtsprechung
- b) Bejahende Auffassung im Schrifttum
- c) Gegenansicht im Schrifttum
- d) Stellungnahme
- 3. Rechtslage bei Unterlassen der Due Diligence
- a) Prüfungsobliegenheit
- b) Besondere Verdachtsmomente
- C. Rechtslage nach erfolgter Due Diligence
- I. Kenntnis gem. § 442 Abs. 1 S. 1 BGB
- II. Grob fahrlässige Unkenntnis gem. § 442 Abs. 1 S. 2 BGB
- III. Mitverschulden des Käufers gem. § 254 Abs. 1 BGB?
- D. Dritthaftung der Berater
- I. Haftung gegenüber dem Auftraggeber
- II. Möglichkeiten der Entlastung bzw. Haftungs-Milderung
- E. Sorgfaltspflichten der Leitungsorgane auf Käuferseite
- I. Sorgfaltspflichten der Vorstandsmitglieder einer AG
- II. Sorgfaltspflichten der Geschäftsführung einer GmbH
- F. Geheimhaltungspflichten der Leitungsorgane auf Verkäuferseite
- I. Geheimhaltungspflichten des Vorstands einer AG
- II. Geheimhaltungspflichten der GmbH-Geschäftsführung
- G. Zusammenfassung und Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Due Diligence im Kontext von Unternehmenskäufen. Im Fokus steht die rechtliche Analyse der Due Diligence als Prüfungsinstrument zur Risikoeinschätzung bei Unternehmenskäufen. Die Arbeit untersucht, welche rechtlichen Konsequenzen sich aus der Durchführung oder Unterlassung einer Due Diligence für die Vertragsparteien ergeben können.
- Die rechtlichen Rahmenbedingungen und Voraussetzungen für die Durchführung einer Due Diligence
- Die Bedeutung der Due Diligence für die Risikominimierung bei Unternehmenskäufen
- Die Haftung der Vertragsparteien bei Unterlassung der Due Diligence
- Die rechtlichen Folgen der Durchführung einer Due Diligence für die Haftung der Vertragsparteien
- Die Rolle der Berater im Rahmen der Due Diligence
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einführung in die Thematik und definiert die zentralen Begriffe wie Unternehmen, Unternehmenskauf und Due Diligence. Anschließend wird die rechtliche Einordnung des Unternehmenskaufs im Zivilrecht beleuchtet. Im Mittelpunkt steht die Due Diligence: Ihre Funktion, die unterschiedlichen Arten der Due Diligence und ihre Einordnung in den Ablauf eines Unternehmenskaufs werden näher erläutert.
Im weiteren Verlauf der Arbeit wird die Rechtslage bei Unterlassung der Due Diligence analysiert. Dazu werden die Themen der Kenntnis im Sinne des § 442 Abs. 1 S. 1 BGB und grobe Fahrlässigkeit im Sinne des § 442 Abs. 1 S. 2 BGB untersucht. Die Arbeit untersucht, ob und inwieweit eine Pflicht zur Durchführung einer Due Diligence besteht und welche rechtlichen Folgen aus einem Unterlassen der Due Diligence entstehen können.
Abschließend wird die Rechtslage nach erfolgter Due Diligence beleuchtet. Die Arbeit analysiert die Folgen der Kenntniszurechnung nach § 166 Abs. 1 BGB im Hinblick auf die Haftung des Käufers. Des Weiteren wird die Haftung der Berater im Rahmen der Due Diligence untersucht. Die Arbeit beleuchtet die Sorgfaltspflichten der Leitungsorgane auf Käufer- und Verkäuferseite.
Schlüsselwörter
Die vorliegende Arbeit konzentriert sich auf die rechtliche Bedeutung der Due Diligence im Rahmen von Unternehmenskäufen. Die Analyse umfasst die Definition und die rechtliche Einordnung der Due Diligence, die Prüfung der Haftung der Vertragsparteien bei Unterlassung der Due Diligence, die Folgen der Durchführung einer Due Diligence und die Haftungsrisiken von Beratern. Zentrale Begriffe sind Unternehmenskauf, Due Diligence, Kaufvertrag, Haftung, Sorgfaltspflicht, Geheimhaltungspflicht und Beratung.
Häufig gestellte Fragen
Was versteht man unter Due Diligence beim Unternehmenskauf?
Due Diligence bezeichnet die sorgfältige Prüfung und Analyse eines Zielunternehmens durch einen potenziellen Käufer, um Risiken zu identifizieren und den Kaufpreis zu validieren.
Welche Arten der Due Diligence gibt es?
Es gibt verschiedene Formen, darunter die rechtliche (Legal), finanzielle (Financial), steuerliche (Tax) und geschäftliche (Business) Due Diligence.
Welche rechtlichen Folgen hat das Unterlassen einer Due Diligence?
Das Unterlassen kann dazu führen, dass der Käufer Gewährleistungsansprüche verliert, wenn ihm grobe Fahrlässigkeit gemäß § 442 BGB vorgeworfen werden kann, weil er Mängel hätte erkennen können.
Wie wirkt sich die Kenntnis aus einer Due Diligence auf die Haftung aus?
Wenn der Käufer durch die Prüfung positive Kenntnis von einem Mangel erlangt, sind seine Mängelrechte bezüglich dieses spezifischen Fehlers in der Regel ausgeschlossen.
Haften externe Berater bei einer Due Diligence?
Ja, Berater können gegenüber ihrem Auftraggeber für Fehler bei der Prüfung haften (Beraterhaftung), wobei Haftungsmilderungen vertraglich vereinbart werden können.
Welche Pflichten haben die Geschäftsführer bei einem Unternehmenskauf?
Leitungsorgane (Vorstand/Geschäftsführung) haben Sorgfaltspflichten gegenüber ihrer Gesellschaft, um wirtschaftliche Schäden durch unzureichende Prüfung zu vermeiden, sowie Geheimhaltungspflichten gegenüber Dritten.
- Quote paper
- Dieter Hoffmann (Author), 2006, Due Diligence beim Unternehmenskauf, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/92989