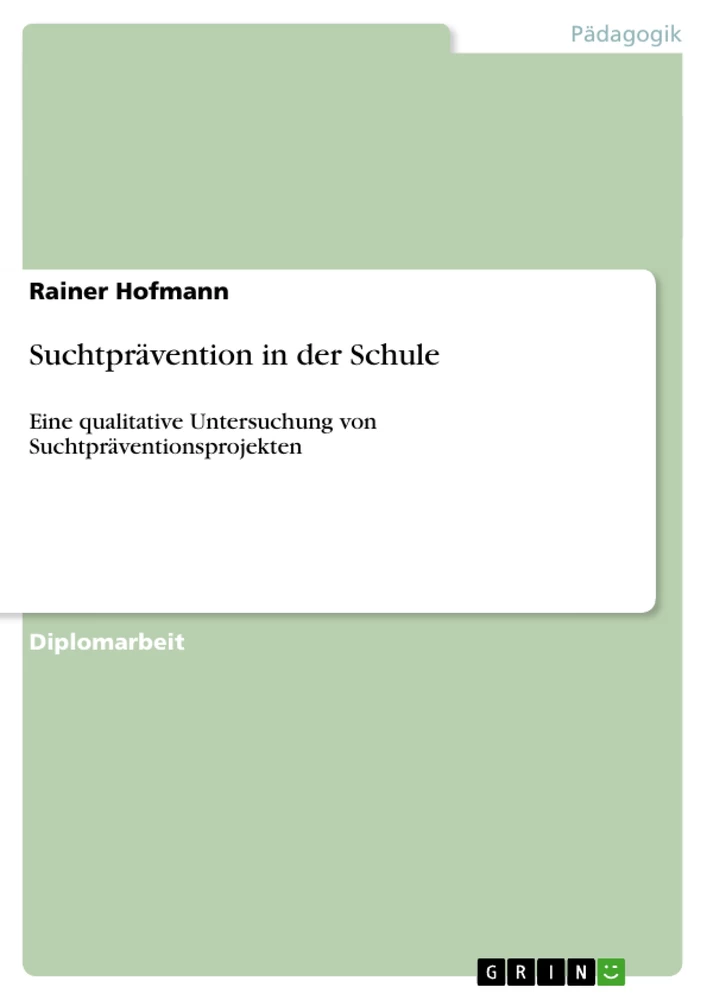Diese Diplomarbeit befasst sich mit der Suchtprävention an Schulen. In der heutigen Zeit, in der die Sucht und die Zunahme der Süchtigen bzw. der Suchtkranken immer wieder zu Problemen führen, muss etwas gegen diese Entwicklung unternommen werden. Deswegen haben sich einige Schulen vorgenommen, Suchtpräventionsprojekte zu starten. In dieser Arbeit wird anhand von vier ausgewählten Schulprojekten gezeigt, welche Bedeutung Suchtprävention in der Entwicklung von Schülern hat(...).
Für diese Arbeit wurden vier verschiedene Suchtpräventionsprojekte an unterschiedlichen Schulen ausgewählt und die Projektbeteiligten (Direktoren, Projektleiter, Schüler) über deren Verlauf und deren Erfolg interviewt. Es wurden verschiedene Schultypen ausgewählt, um einerseits die unterschiedlichen Vorgehensweisen der Schulen bei der Bewältigung des Suchtproblems aufzuzeigen. Andererseits soll das Suchtverhalten der Schüler, die demnach aus verschiedenen sozialen Schichten stammen, deutlich gemacht werden. Dies soll dazu dienen, um der Problematik des Suchtverhaltens auf verschiedenen Ebenen zu begegnen.
Inhalt
1 Einleitung
2 Zur Suchtgiftproblematik
2.1 Bedeutungen des Wortes Sucht
2.2 Ursachen der Sucht
2.3 Folgewirkungen der Sucht
2.3.1 Empirische Daten zum Suchtverhalten Jugendlicher in Wien
3 Gesundheitsförderung und Suchtprävention in der Schule
3.1 Gesundheitsförderung: Begriffsbestimmung und Probleme
3.2 Zur Entwicklung der Gesundheitsförderung in der Schule in den letzten Jahrzehnten
3.3 Suchtprävention als wichtiger Bereich der Gesundheitsförderung
3.4 Projektorientierte Ansätze der Suchtprävention
4 Qualitätskriterien von Gesundheitsförderungsprojekten
4.1 Settingorientiertes Vorgehen
4.2 Die Projektorganisation
4.3 Klare Zielsetzungen
4.4 Klarer und in Abschnitte gegliederter Arbeitsplan
4.5 Definition der Mitglieder eines Projekts
4.6 Vernetzungen
4.7 Nachhaltigkeit des Projekts
4.8 Evaluation
5 Zum forschungsmethodischen Vorgehen
5.1 Das Leitfadeninterview
6 Die Interviewstudie
6.1 Zur Konstruktion des Interviewleitfadens
6.1.1 Einleitende Frage
6.1.2 Ziele des Projekts
6.1.3 Implementation
6.1.4 Wahrnehmung von Effekten
6.1.5 Evaluation
6.1.6 Nachhaltigkeit des Projekts
6.1.7 Ökonomische Aspekte
6.1.8 Motivation zur Teilnahme am Projekt
6.2 Die Durchführung der Interviews
7 Interpretation der Interviews
7.1 Projekt A
7.1.1 Projektbeschreibung
7.1.2 Interviewinterpretation
7.1.3 Zusammenfassung
7.2 Projekt B
7.2.1 Projektbeschreibung
7.2.2 Interviewinterpretation
7.2.3 Zusammenfassung
7.3 Projekt C
7.3.1 Projektbeschreibung
7.3.2 Interviewinterpretation
7.3.3 Zusammenfassung
7.4 Projekt D
7.4.1 Projektbeschreibung
7.4.2 Interviewinterpretation
7.4.3 Zusammenfassung
8 Abschließende Bewertung und Diskussion
9 Literatur
1 Einleitung
Diese Diplomarbeit befasst sich mit der Suchtprävention an Schulen. In der heutigen Zeit, in der die Sucht und die Zunahme der Süchtigen bzw. der Suchtkranken immer wieder zu Problemen führen, muss etwas gegen diese Entwicklung unternommen werden. Deswegen haben sich einige Schulen vorgenommen, Suchtpräventionsprojekte zu starten. In dieser Arbeit wird anhand von vier ausgewählten Schulprojekten gezeigt, welche Bedeutung Suchtprävention in der Entwicklung von Schülern hat.
„Unter Prävention versteht man die Verhütung von Krankheiten durch Ausschaltung von Krankheitsursachen, durch Früherkennung und Frühbehandlung oder durch die Vermeidung des Fortschreitens einer bestehenden Krankheit“ (Franzkowiak, 2003, S. 179). Die Suchtprävention ihrerseits versucht zu vermeiden, dass man von einem Suchtmittel abhängig wird bzw. versucht die Entwicklung süchtigen Verhaltens zu verhindern.
Für diese Arbeit wurden vier verschiedene Suchtpräventionsprojekte an unterschiedlichen Schulen ausgewählt und die Projektbeteiligten (Direktoren, Projektleiter, Schüler) über deren Verlauf und deren Erfolg interviewt. Es wurden verschiedene Schultypen ausgewählt, um einerseits die unterschiedlichen Vorgehensweisen der Schulen bei der Bewältigung des Suchtproblems aufzuzeigen. Andererseits soll das Suchtverhalten der Schüler, die demnach aus verschiedenen sozialen Schichten stammen, deutlich gemacht werden. Dies soll dazu dienen, um der Problematik des Suchtverhaltens auf verschiedenen Ebenen zu begegnen.
Im Folgenden wird die Vorgehensweise dieser Arbeit kurz beschrieben.
Bei dem Thema Suchtprävention erscheint es sinnvoll, etwas weiter auszuholen. In Kapitel 2 wird zunächst näher auf die Hintergründe und Ursachen der Sucht, die Begriffsbedeutung des Wortes Sucht und auf die Schäden durch die Sucht eingegangen. Weiters werden aktuelle empirische Daten und Fakten betreffend das Suchtverhalten von Jugendlichen in Wien angeführt.
Gegenstand des dritten Kapitels ist das Thema der Gesundheitsförderung und der Suchtprävention im Speziellen an Schulen. Zunächst erfolgen einige kurze Erläuterungen, was Gesundheitsförderung überhaupt ist und es wird näher auf die Begrifflichkeit und die Bedeutung des Wortes eingegangen. Weiters kommt es in diesem Kapitel zu einer genauen Einführung in die historische Entwicklung der Gesundheitsförderung in Österreich, und in ihre Entwicklung in österreichischen Schulen. Es wird auch darauf hingewiesen, dass Suchtprävention einen Teil der Gesundheitsförderung darstellt, wobei hier auf die Vorgangsweise der Suchtprävention (in Form von Projekten) genauer hingewiesen wird. Danach wird auf die verschiedenen Ansätze der Suchtprävention eingegangen, da die Vorgehensweise auch wichtig für das Gelingen eines Projekts ist.
In Kapitel 4 erfolgt eine Auflistung der Qualitätskriterien von Projekten, die für eine erfolgreiche Projektumsetzung erfüllt werden sollten.
Gegenstand des fünften Kapitels ist eine kurz Einführung in die Forschungsmethode, die in dieser Arbeit angewendet wird. Es handelt sich dabei um das Leitfadeninterview.
Kapitel 6 und 7 stellen den Hauptteil der Arbeit, die Interviewstudie dar. Zunächst wird im sechsten Kapitel auf die Konstruktion des Interviewleitfadens eingegangen, der sich aus der einleitenden Frage, den Zielen des Projekts, der Implementation, der Wahrnehmung von Effekten, der Evaluation, den Fragen zur Nachhaltigkeit des Projekts, den ökonomischen Aspekten und der persönlichen Motivation zur Teilnahme an dem Projekt, zusammensetzt.
In Kapitel 7 erfolgt die Verwertung der gesammelten Interviewdaten, wobei jedes einzelne untersuchte Projekt zuerst im Rahmen einer Projektbeschreibung vorgestellt wird. Danach folgt die Interpretation der Interviews der einzelnen Projekte und zuletzt wird eine abschließende Zusammenfassung über jedes Projekt verfasst. D. h. in diesem Kapitel sollen die unterschiedlichen Suchtpräventionsprojekte aus den verschiedenen Settings, also aus den unterschiedlichen Formen von Schulen genau über die Interviewstudie erhoben und beschrieben werden.
In Kapitel 8, dem letzten Kapitel wird resümiert und überprüft, ob die vier untersuchten Suchtpräventionsprojekte den in Kapitel 4 aufgestellten Qualitätskriterien von Projekten tatsächlich entsprechen oder nicht. Des Weiteren erfolgt eine Beurteilung, ob es Unterschiede in der Durchführung der Projekte zwischen den einzelnen Schulen gibt. Es kann natürlich sein, dass bei der Projektarbeit verschiedene Probleme und Schwierigkeiten identifiziert werden, die auftauchen. Als abschließendes Ziel gilt es, wesentliche Punkte herauszuarbeiten, die bei der Durchführung von Suchtpräventionsprojekten beachtet werden müssen, damit sie überhaupt einen Sinn machen bzw. erwünschte Effekte erzielt werden.
Die zentralen Fragen bzw. Aufgabenbereiche dieser Arbeit sind folglich:
1. Die unterschiedlichen Suchtpräventionsprojekte aus den verschiedenen Settings, d.h. aus den unterschiedlichen Formen von Schulen werden über die Interviewstudie erhoben und genau beschrieben.
2. Es sollen dabei verschiedene Probleme und Schwerpunkte, die auftauchen identifiziert werden.
3. Es kommt zu einer Auflistung von verschiedenen Qualitätskriterien für Projekte, anhand welcher untersucht wird, ob die Projekte gemäß diesen Kriterien als gelungen oder als nicht erfolgreich bezeichnet werden können.
2 Zur Suchtgiftproblematik
Die Sucht ist eines der häufigsten und folgeschwersten körperlichen, psychosozialen und gesellschaftlichen Probleme der heutigen Zeit. Bei der Suchtgiftproblematik lassen sich stoffgebundene und nicht stoffgebundene Abhängigkeitsformen unterscheiden. Zu den stoffgebundenen zählt man: die Abhängigkeit von Rauschdrogen, Alkohol, Medikamenten und Tabak. Zu den nicht stoffgebundenen Abhängigkeitsformen zählt neben der Anorexie (Magersucht), Bulimie (Ess-Brechsucht), Kaufsucht, Arbeitssucht usw. die Spielsucht als stärkster Vertreter mit zunehmender Tendenz (vgl. Eser, 1989).
2.1 Bedeutungen des Wortes Sucht
Die Definition des Wortes Sucht erscheint aufgrund einer Vielzahl von Definitionsversuchen nicht einfach.
Im großen Lexikon der Medizin wird Sucht als ein „krankhaftes Verlangen nach Betäubungsmitteln und Rauschgiften definiert“ (Das große Lexikon der Medizin/6, 1979, S. 1169).
Schon vor Beginn des 19. Jh. wird der Begriff der „Sucht“ verwendet (vgl. Niebaum, S. 13). „Der klassische Suchtbegriff bezieht sich in seiner Definition immer auf ein Mittel, eine Droge“ (Niebaum, 2001, S. 96). Wobei man unter Drogen (im Französischen drogue) pflanzliche Stoffe, im weiteren Sinn auch Arzneistoffe und später dann auch halb- und vollsynthetische Drogen versteht.
Laubenthal geht sogar noch weiter indem er meint, dass Sucht ein mehr passives, begierdemäßiges, zwanghaftes Verhalten, dem das Merkmal einer freien Entscheidungsmöglichkeit fehlt, ist (vgl. Eser, 1989).
Das Wort Sucht kommt nicht von suchen, sondern von siechen, was soviel wie krank sein bedeutet. Ähnlich lautende Worte wie das althochdeutsche „suht“, das gotische „saúhts“, das niederländische „zucht“ und das schwedische „sot“ (Krankheit) lassen sich von dem Verb siechen ableiten. In Wörtern wie z.B. Mondsucht oder Tobsucht kann man das Grundwort als „krankhaftes Verlangen“ verstehen. Im neuhochdeutschen Sprachgebrauch hat man dieses Wort mit „suchen“ verknüpft. Wortzusammensetzungen wie Herrschsucht, Selbstsucht oder Gefallsucht werden in diesem Sinne verstanden (vgl. Duden, 2001).
Die WHO findet nach verschiedenen verwirrenden Definitionen von Sucht und Gewöhnung den Begriff der Drogenabhängigkeit (was allerdings nur für stoffgebundene Süchte gilt), den sie wie folgend definiert: „Drogenabhängigkeit ist ein Zustand psychischer oder psychischer und physischer Abhängigkeit von einer Substanz mit zentralnervöser Wirkung, die zeitweise oder fortgesetzt eingenommen wird. Sieben Drogenabhängigkeitstypen sind zu unterscheiden: Morphin-, Cannabis-, Halluzinogen-, Amphetamin-, Kokain-, Barbiturat- und Khat-Typ“ (Niebaum, 2001, S. 25).
2.2 Ursachen der Sucht
Wie bekannt ist, gibt es auch hier verschiedene Theorien und Erkenntnisse in der Ursachenforschung. Dem letzten Stand der Wissenschaft zufolge entwickelt sich die Suchtbereitschaft schon im frühkindlichen Alter und wird gefördert durch gesellschaftlich anerkanntes Konsumverhalten. Dem entwicklungsgeschichtlichen Modell Piagets zufolge ist der sich entwickelnde Mensch bestrebt ein inneres und äußeres Gleichgewicht herzustellen und spezifisch individuell wahrgenommene Defizite von Grundbedürfnissen auszugleichen. Und dazu meint auch Niebaum ergänzend: ,,Die mangelnde Befriedigung frühkindlicher Grundbedürfnisse bedingt somit die Suche nach einer positiv bestätigten adäquaten und spezifischen „Ausgleichs“– und/oder „Ersatzverhaltensweise“. Konsumverhalten bietet sich bereits frühkindlichen Erfahrungen zufolge für eine solche „Substitutions- (be)-handlung“ an“ (Niebaum, 2001, S. 93).
Auch stellte man in der medizinischen Forschung bei Drogenabhängigen einen Mangel an körpereigenen Glückshormonen (Serotonin) fest. Und dadurch, dass der Suchtkranke um körperliches Wohlbefinden zu erlangen immer wieder zur Droge (oder anderen Ersatzhandlungen) greift entsteht die Sucht. Tut er das nämlich nicht, so leidet er an Entzugserscheinungen, die so schlimm sein können, dass er sie nur mit neuerlichem Drogenkonsum bekämpfen kann.
Sucht ist also kein Problem willensschwacher Menschen, die primär in sozialen Randgruppen beheimatet sind. Vielmehr ist Sucht zu einem gesamtgesellschaftlichen Problem geworden, das weder vor einer bestimmten Altersgruppe noch vor einer sozialen Schicht halt macht. Grundsätzlich kann fast jeder Mensch süchtig werden, wenn genetische Voraussetzungen und entsprechende Lebensumstände in fataler Weise zusammenwirken. Und da Sucht nicht auf den Umgang mit bestimmten Stoffen beschränkt ist, kann jede Form menschlichen Verhaltens (unmäßig betrieben) zur Sucht werden (z.B. Arbeitssucht, Spielsucht, unkontrolliertes Verlangen nach sexueller Befriedigung).
Die Fachleute werden in zunehmendem Maße mit diesen neueren Suchtformen konfrontiert. Aus diesem Grund muss zwischen stoffgebundenen und nicht stoffgebundenen Ursachen für eine Sucht differenziert werden. Bei den Ursachen der Abhängigkeit von einem Suchtmittel (Drogen, Alkohol, Nikotin, Medikamente) unterscheidet man die psychischen und die physischen Komponenten. Unter psychischer Abhängigkeit versteht man ein massives Verlangen nach ständiger oder episodischer Zufuhr eines Suchtstoffes. Sie kann sich je nach Droge langsam oder schnell entwickeln. Die physische Abhängigkeit ist durch Entzugserscheinungen nach Absetzen oder einer Reduktion der Dosis des Suchtmittels charakterisiert. Durch eine erneute Dosierung aus der gleichen Suchtgiftklasse verschwinden die Entzugserscheinungen (vgl. Eser, 1989).
Die Ursachenfindung von nicht stoffgebundener Sucht ist komplizierter. Die intensivere Betrachtung der Spielsucht zum Beispiel bestätigt dies. Eine genaue Ursache ist nicht bekannt. Weil es Ähnlichkeiten mit Suchterkrankungen gibt, wird pathologisches Glücksspiel auch als Spielsucht bezeichnet. Es wird hierbei die Realität verzerrt wahrgenommen, der Betroffene hat die Illusion, die Kontrolle über seine Handlungen zu haben, schätzt dabei aber die tatsächlichen Risiken nicht richtig ein. Aus diesem Grund wird das fehlerhafte Verhalten beibehalten. In der Verwandtschaft von krankhaften Spielern finden sich tatsächlich gehäuft Suchtkranke sowie Menschen mit affektiven Störungen. Dies deutet eher auf eine erbliche Komponente hin (vgl. Klimroth-Hahn, 2005).
Wenn man nun die Ursachen von Magersucht betrachtet, kommt man auf drei verschiedene Einflussfaktoren: die biologischen, die psychischen und die gesellschaftlichen Einflüsse. Am häufigsten tritt die Anorexie im Pubertätsalter auf, d.h. in jenem Zeitraum in dem sich meistens das junge Mädchen (aber immer häufiger auch Jungen und junge Männer) zur erwachsenen Frau (Mann) entwickelt. Diese rasche Entwicklung kann dazu führen, dass die betroffene Person überfordert ist und somit unsicher wird. Für viele Patienten/Patientinnen scheint der Versuch, Kontrolle über ihr eigenes Körpergewicht ausüben zu können, ein Gefühl von Sicherheit zu vermitteln. Weiters übt die Gesellschaft auch gewaltigen Druck auf die sich in der Pubertät befindenden angehenden Frauen (Männern) aus. Hat sich doch das Schönheitsideal in den letzten Jahrzehnten immer mehr in Richtung eines schlanken Körpers entwickelt (vgl. Gawlik, 2005).
2.3 Folgewirkungen der Sucht
Gesundheitliche Folgen und Spätschäden der Suchtkrankheiten sind enorm. Ganz abgesehen vom volkswirtschaftlichen Schaden für Staat und Gesellschaft (vgl. Wikipedia, 2006).
Die Palette der diversen Suchterkrankungen und daher auch der gesundheitlichen Schädigungen, sowie der Spätschäden ist groß. Im schulischen Bereich (Jugendliche, etwa 10–15 Jahre) sind am häufigsten Alkohol-, und Drogenkonsum, Nikotin, aber auch Medikamentenmissbrauch, Essstörungen und Computer- (Fernseh-) sucht anzutreffen. Nimmt man das Rauchen her, so gibt es eine Vielzahl von Gesundsheits- (spät-) schäden bei denen Nikotin als Risikofaktor gilt (Lungenkrebs, diverse andere Lungenerkrankungen und Gefäßerkrankungen). Bei anderen Suchtmitteln (Alkohol, Drogen und Medikamente) steht vor allem die physische und psychische Abhängigkeit mit der damit verbundenen Verhaltensbeeinträchtigung im Vordergrund. Und weitere Folgen sind Vergiftungserscheinungen über Bewusstlosigkeit bis hin zum Tod. Oder es kommt zu regelrechten Persönlichkeitsveränderungen, Wahnvorstellungen, Angstzuständen, Panikattacken und anderen psychotischen Reaktionen. Der Suchtkranke wird in weiterer Folge zum Sozialfall und kann nur mehr durch eine entsprechende Therapie geheilt und auch wieder resozialisiert werden, was aber oft nicht gelingt (vgl. Wikipedia, 2006).
Zu den drogenassoziierten Begleiterkrankungen zählen neben Hepatitis und Aids in letzter Zeit auch TBC (Tuberkulose).
Nicht zu vergessen ist die Beschaffungskriminalität der Drogensüchtigen, die der Volkswirtschaft und der Gesellschaft großen Schaden zufügt. Neben dem großen Komplex der stoffgebundenen Abhängigkeiten (Süchte), die den größten Teil der Suchtproblematik ausmachen gibt es aber auch die stoffungebundenen Verhaltensstörungen, die vor allem den betroffenen Personen große Probleme bereiten können. Dazu zählt man Essstörungen, die zu schweren gesundheitlichen Schäden führen können bis hin zum Tod. Dann Computer- und Fernsehsucht, die zu Haltungsschäden und diversen Augenerkrankungen führen können.
Es gibt dann noch diverse andere Suchtverhalten wie Spielsucht, Arbeitssucht, Kaufsucht, Sexsucht etc. Auch diese Störungen können Menschen und ihrer Umwelt großen Schaden zufügen, ganze Existenzen können dadurch vernichtet und Familien zerstört werden. Daher ist es von großer volkswirtschaftlicher Bedeutung so früh wie möglich süchtiges Verhalten durch Prävention zu verhindern zu versuchen, was im Rahmen der Gesundheitsförderung ja in einigen (aber leider nicht in allen) Schulen in Form von Projekten durchgeführt wird.
2.3.1 Empirische Daten zum Suchtverhalten Jugendlicher in Wien
Im Allgemeinen kann man eine zunehmende Tendenz süchtigen Verhaltens von Kindern und Jugendlichen feststellen und dass die Konsumenten immer jünger werden.
Konsumerfahrungen mit illegalen Drogen finden sich in Österreich am häufigsten bezüglich Cannabis (der Einstiegsdroge) mit Prävalenzraten von ca. 30 Prozent bei den jungen Erwachsenen. In Repräsentativstudien finden sich weiters Konsumerfahrungen von rund zwei bis vier Prozent für Opiate. In den letzten Jahren wurde beim Probier- und Experimentierkonsum eine Verbreiterung und eine Erweiterung des Substanzspektrums festgestellt. In bestimmten Szenen und Gruppierungen von Jugendlichen finden sich dabei hohe Prävalenzraten für eine Reihe von unterschiedlichen Substanzen, darunter auch biogene Drogen (Pilze, Kakteen, etc.) und Schnüffelstoffe.
Aktuelle Ergebnisse von Repräsentativstudien weisen darauf hin, dass sich dies in generell höheren Prävalenzraten, vor allem bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen, niederschlägt. Im Rahmen einer in Wien vom IFES (Institut für empirische Studien) durchgeführten Suchtmittelstudie wurden im Herbst 2003 670 Personen ab 15 Jahren interviewt. Im Vergleich zu früheren Erhebungen bestätigte sich der Anstieg der Lebenszeiterfahrung mit Cannabis (1993: 5%, 2003: 16%) wobei auch angenommen wird, dass dies teilweise auf höhere Bekennerraten auf Grund der gesellschaftlichen Enttabuisierung zurückzuführen ist, und damit der reale Anstieg überschätzt wird. Zuwächse gibt es auch bei der Konsumation von Kokain, während alle anderen erhobenen Substanzen auf gleich bleibendem Niveau liegen. Der Konsum von biogenen Drogen wurde erstmals erhoben, wobei insgesamt drei Prozent der Befragten angaben, bereits einmal „Naturdrogen“ konsumiert zu haben. Bei fast allen illegalen Substanzen findet sich eine höhere Lebensprävalenz bei höher Gebildeten und jüngeren Altersgruppen. Am deutlichsten zeigt sich dies bei Cannabis, wo die Prävalenzrate mit zunehmendem Alter kontinuierlich sinkt (unter 30-Jährige: 40%, über 50-Jährige: unter 5%). Der Kokainkonsum ist bei berufstätigen Männern der mittleren Altersgruppe und der oberen Bildungsschicht am höchsten (5% bis 7%). Frauen weisen generell eine geringere Konsumprävalenz auf, mit Ausnahme von Ecstasy und Amphetaminen, wo es kaum geschlechtsspezifische Unterschiede gibt (vgl. Bericht zur Drogensituation, 2004).
Im Jahr 2003 wurde im Rahmen der vom BMGF (Bundesministerium für Gesundheit und Frauen) finanzierten ESPAD-Studie ein Schul-Survey bei 5619 Schülern und Schülerinnen im Alter von 13 bis 18 Jahren durchgeführt. Erste Ergebnisse zu den Konsumerfahrungen liegen bereites vor. Demnach hat rund ein viertel der Befragten mindestens einmal im Leben eine illegale Substanz konsumiert. Erwartungsgemäß die höchste Prävalenz findet sich bei Cannabis (22,5%), gefolgt von Amphetaminen/ Aufputschmitteln (4,7%), Ecstasy (3,1%), Kokain (2,2%) sowie LSD und anderen Halluzinogenen (2,2%).
Die Glaubwürdigkeit dieser Angaben ist aber erst nach einer genauer Analyse und Interpretation möglich (vgl. Uhl, in Bericht zur Drogensituation, 2004). Es zeigen sich auch in dieser Studie bei den Burschen höhere Prävalenzraten als bei den Mädchen (mit Ausnahme von Amphetaminen, Ecstasy und LSD). Weiters ist eine deutliche Zunahme des Konsumverhaltens mit steigendem Alter erkennbar.
In Abbildung 1 auf der Seite 14 werden österreichische Studien zur Suchtmittelerfahrung von Jugendlichen angeführt. Entnommen wurden diese Angaben dem Bericht zur Drogensituation 2004 vom Österreichischen Bundesinstitut für Gesundheitswesen.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 1: (Österreichisches Bundesinstitut für Gesundheitswesen, 2004, S. 109)
3 Gesundheitsförderung und Suchtprävention in der Schule
Um einen besseren Einblick in die Thematik dieser Diplomarbeit zu bekommen, werden in diesem Kapitel die dieser Arbeit zugrunde liegenden Begriffe wie Gesundheitsförderung, Gesundheitserziehung und Suchtprävention näher erörtert.
3.1 Gesundheitsförderung: Begriffsbestimmung und Probleme
Wenn man nun bei einem Projekt an einer Schule näher auf die Förderung der Gesundheit eingehen will, muss zunächst geklärt werden, was denn Gesundheit überhaupt ist.
Gesundheit ist „ein Zustand des umfassenden körperlichen, geistigen und sozialen Wohlbefindens und nicht nur das Fehlen von Krankheit oder Behinderung. Gesundheit ist eine Ressource für das tägliche Leben, nicht das Ziel des Lebens. Sie ist ein positives Konzept, welches soziale und persönliche Ressourcen gleichermaßen betont, wie körperliche Fähigkeiten“ (Glossar Gesundheitsförderung, 1998, S. 1).
Gesundheitsförderung bedeutet für die Weltgesundheitsorganisation (WHO) die Hinwendung zu einem sozialen Verständnis von Gesundheit. Sie will der Bevölkerung eine möglichst große Einflussnahme auf ihre Gesundheit ermöglichen (Ottawa–Charta, 1986). „Gesundheitsförderung zielt auf einen Prozess, allen Menschen ein höheres Maß an Selbstbestimmung über ihre Gesundheit zu ermöglichen und sie dadurch zur Stärkung ihrer Gesundheit zu befähigen“ (Glossar Gesundheitsförderung, 1998, S. 1).
Gesundheitsförderung zielt darauf ab, Gesundheit in Organisationen, wie zum Beispiel der Schule zu einem Thema zu machen, die zu anderen Zwecken geschaffen wurden und für andere Ziele strukturiert sind. Dies bedeutet für jede Organisation eine tiefgreifende Störung, da die Gesundheitsförderung nicht den etablierten Denk- und Handlungsmustern entspricht. Die Abläufe innerhalb einer Organisation, ihre Sicht und ihr Kontakt mit der Außenwelt sind auf die Erreichung ganz bestimmter Ziele ausgerichtet. Jeder Versuch eine Veränderung herbeizuführen, wird notwendigerweise Widerstände und Konflikte hervorrufen. Aus diesem Grund ist es wichtig, dass Gesundheitsförderung von einer Außenposition operieren muss. Folglich ist Gesundheitsförderung auf Interventionen in soziale Systeme angewiesen. Eine Intervention ist eine „zielgerichtete Kommunikation zwischen Individuen oder sozialen Systemen, welche die Autonomie des intervenierten Systems respektiert“ (Willke, in Grossmann, 2001, S. 30). Der Erfolg einer Intervention hängt entscheidend von einer genauen Kenntnis und einer präzisen Einschätzung der Strukturen und der Dynamik der Systeme ab, mit denen man es zu tun hat. Gesundheitsförderungsprojekte treffen oft auf ein komplexes, meist schwer erkennbares Netz von sozialen Strukturen, in denen die Ressourcen und Energien bereits verteilt sind. Eine Veränderung in einem Bereich des Netzes betrifft alle anderen Teile. Eine Veränderung des Gesundheitsbewusstseins der in einem sozialen System involvierten Personen wird nicht ohne Auswirkungen bleiben. Wenn nun die innere Dynamik eines sozialen Systems betrachtet wird, kann eine Intervention nie zur Gänze vorausgeplant oder ihre Wirkung vorhergesagt werden „Die Entwicklung von sozialen Systemen ist grundsätzlich durch die interne Kommunikation bestimmt“ (Grossmann, 2001, S. 30). Daher können Interventionen nur Anstöße zur Selbstentwicklung eines sozialen Systems sein.
Gesundheitsförderung im schulischen Alltag kann beispielsweise eine positive Handlungsalternative zum Burnout-Syndrom, mit dem geringere Schüler/Schülerinnenmotivation, undisziplinierte Schüler/Schülerinnen und Konflikt mit Kollegen und Vorgesetzten assoziiert wird, bieten. Gesundheitsförderung kann in diesem Bereich zusätzlich als Stressmanagement verstanden werden, weil sie es unterstützt, ein eigenes soziales Netzwerk in der Schule aufzubauen und hilft, durch den Erwerb bestimmter Fähigkeiten mit dem eigenen Energiepotential günstiger umgehen zu können (vgl. Barkholz, 1994, S. 29). Und als Folge der Gesundheitsförderung in der Schule entstehen ein angenehmeres Arbeitsklima und weniger Krankenstände und Frühpensionierungen bei den Lehrkräften. Unter Gesundheitsförderung in der Schule verstehen wir nun, die äußeren Einflüsse so zu gestalten und zu verändern, dass sie sich auf die Gesundheit der Personen in der Schule und im schulischen Umfeld möglichst positiv auswirken.
Schulische Gesundheitsförderung ergibt sich aus dem Zusammenwirken der fünf in der Ottawa-Charta von 1986 benannten Handlungsebenen:
1. die Qualifizierung der Personen im Sinne des Aufbaus einer gesünderen Lebensweise.
2. die Anregung gesundheitsförderlicher Gruppenaktivitäten.
3. organisationsbezogene Impulse, die eine Öffnung der Schule nach innen bewirken und die für die gesamte Institution bedeutsam werden.
4. die Stärkung der Verbindung mit dem sozialen Umfeld im Sinne einer Öffnung der Schule nach außen.
5. der Aufbau eines pädagogischen Profils, das dazu beiträgt, Gesundheitsförderung im Bewusstsein der Öffentlichkeit und bei den verantwortlichen politischen Entscheidungsträgern zu verankern und für Unterstützung zu werben (vgl. Barkholz, 1994, S. 198).
Zu den Problemen bzw. Schwierigkeiten der Gesundheitsförderung wäre folgendes zu sagen. Viele Menschen arbeiten in Organisationen, und alle wesentlichen Alltagsabläufe sind von der Auseinandersetzung mit großen Organisationen, etwa Schulen, Banken, Ämtern, Betrieben und Krankenhäusern, bestimmt. Organisationen nehmen direkt Einfluß auf ihre Mitarbeiter, so sind sie implizit Gesundheitserzieher ihrer Mitarbeiter. Der Umgang mit der Gesundheit von den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen am Arbeitsplatz wird nicht allein in der Organisation wirksam, sondern beeinflusst nachhaltig die Verhaltensweisen dieser Menschen auch außerhalb der Arbeit. Als Folge wirken die durch die jeweilige Organisationskultur vermittelten Einflüsse auf das Gesundheitsbewusstsein und Gesundheitsverhalten nachhaltig als Gesundheitserziehungsprogramm. Das Problem hierbei ist, dass die Ziele und Aufgaben der meisten Organisationen primär einer anderen Logik, als jener der Gesundheitsförderung folgen. Sich am Arbeitsplatz um die eigene Gesundheit kümmern ist meistens nicht Teil der Berufsrolle. Folglich tendieren die Organisationen dazu, die Gesundheitsproblematik auszuklammern und an Organisationen wie Krankenversicherungen zu delegieren. Gesundheit ist schließlich noch kein Problem, Krankheit hingegen schon. Dies stellt ein Kernproblem bei der Umsetzung von Gesundheitsförderung dar.
Normalerweise sind Berufe durch bestimmte Qualifikationsanforderungen definiert, spezielle Ausbildungen sorgen für die Sicherung professioneller Standards. Diese Spezialisierung ist aber nicht alleine durch Berufe und die dazugehörige Ausbildung gegeben, sondern professionelle Rollen werden innerhalb einer Organisation im Einzelnen definiert. Diese Definition von Rollen schafft Transparenz über die spezifischen zu erwartenden Leistungen der einzelnen Berufe. Bisher gibt es kein klar umschriebenes Anforderungsprofil für das Berufsbild eines Gesundheitsförderers. Dies soll jedoch nicht dazu führen, dass die erforderlichen Kompetenzen in einem vagen Berufsbild verschwimmen. Die Weiterentwicklung von Gesundheitsförderung hängt zu einem guten Teil davon ab, inwiefern es gelingt, die bereits erwähnte Transparenz herzustellen, indem passende organisatorische Strukturen und professionelle Rollen mit entsprechenden Anforderungsprofilen entwickelt werden. Das stellt ein gewisses Problem dar. „Traditionelle Berufe wie Führungskräfte, Lehrerinnen, Sozialarbeiter, Ärztinnen und andere therapeutische Berufe müssen ihr Handlungsspektrum verändern, wenn sie Gesundheitsförderung in den Zielkatalog ihrer täglichen Arbeit integrieren“ (Grossmann, 2001, S. 42).
Gesundheitsförderung zielt nun darauf ab, bestehende soziale Systeme und professionelle Rollen zu verändern und um die Dimension Gesundheit zu erweitern. Gesundheitsförderung steht somit vor einem Widerspruch, der in der relativ jungen Geschichte der Gesundheitsförderung noch zu wenig Bedeutung beigemessen wurde, und zwar ist sie einerseits bestrebt, in bestehenden Organisationen Fuß zu fassen und andererseits muss sie eine „eigene organisatorische Verankerung und eine qualifizierte professionelle Ausschilderung schaffen“ (Grossmann, 2001, S. 42), um ihre Aufgabe zu bewältigen. Betrachten man nun näher die Definition von Gesundheitsförderung der Ottawa Charta, so kristallisieren sich vier Funktionen (Expert, Advocate, Enabler und Change Facilitator) für jemanden der in professioneller Weise im Sinne der Gesundheitsförderung tätig sein will, heraus. Auf diese vier Funktionen wird aber in dieser Arbeit nicht genauer eingegangen.
Ein weiterer wichtiger Bereich, der den Erfolg der Gesundheitsförderung garantieren kann, ist der Setting- Ansatz. Die Entwicklung dieses Ansatzes war ein bedeutender Schritt in der jungen Geschichte der Gesundheitsförderungsprogramme. Er war die Antwort auf die beschränkten Erfolge der traditionellen Gesundheitserziehungsaktivitäten. Es wurde versucht, durch Bewusstseinsbildung bei den Menschen entsprechende Verhaltensänderungen zu bewirken. Die Ergebnisse waren jedoch ziemlich enttäuschend. Daraus hat man gelernt, dass eine Strategie, die sich nur auf ein Problem konzentriert, ihr Ziel verfehlt. Sie muss auch Einfluß auf die soziale Umwelt (Setting) eines Menschen ausüben. Der Setting-Ansatz berücksichtigt nicht nur die Rahmenbedingungen unter denen Menschen leben, lernen und arbeiten, sondern auch milieuspezifische Traditionen. „Dieser Ansatz beruht auf der Erkenntnis, dass Gesundheitsprobleme einer Bevölkerungsgruppe das Resultat einer wechselseitigen Beziehung zwischen ökonomischer, sozialer und institutioneller Umwelt und persönlichem Verhalten sind“ (Grossmann, 2001, S. 66). Um nun eine Intervention zu setzen, muss das betreffende soziale System in Bezug auf Gesundheitsförderungsaktivitäten genau definiert werden. Man kann nicht intervenieren, ohne sich dabei zu überlegen, welche Teile eines Systems jeweils angesprochen werden sollen. Eine bewusste Abgrenzung des sozialen Systems, das für die gewünschte Realisierung einer Aufgabe geeignet ist, zählt zu den grundsätzlichen Voraussetzungen einer erfolgreichen Intervention. Wobei diese Abgrenzung selbst schon eine Intervention darstellt. Bevor eine Gesundheitsförderungsaktivität gesetzt wird, muss entschieden werden, ob eine Organisation als ganze, oder nur bestimmte Abteilungen einbezogen werden sollen. Bevor ein Projekt gestartet wird, sollte der Setting-Ansatz geklärt sein. Auf den Setting-Ansatz wird auch noch im Kapitel 4 eingegangen.
3.2 Zur Entwicklung der Gesundheitsförderung in der Schule in den letzten Jahrzehnten
Durch eine Veränderung der gesellschaftlichen Anforderungen verändert sich auch der Erziehungsauftrag der Schule. Die Gesundheitsförderung ist mittlerweile zu einem zentralen Aufgabengebiet der Schule geworden weil durch sie ein großer Teil der Bevölkerung über viele Jahre hinweg erreichbar ist. Das Wissen, die Einstellungen und Verhaltensweisen im Umgang mit Gesundheit und Krankheit kann bereits im frühen Kindesalter erworben werden. Eines der Hauptziele der Gesundheitsförderung in der Schule ist die Lebenskompetenzförderung. Damit soll die physische, psychische und soziale Gesundheit der Kinder gefördert werden. Das Konzept der Lebenskompetenzförderung wird im Zuge dieser Arbeit noch genauer beschrieben werden.
In den Jahren 1970 bis 1980 war von Gesundheitsförderung noch kaum die Rede, es dominierte die traditionelle Gesundheitserziehung. Hauptziel der Gesundheitserziehung ist die Wissensentwicklung im Bereich Gesundheit bei einzelnen Personen oder Gruppen. Göpel versteht unter Gesundheitserziehung den autoritativen Versuch, „für andere Menschen verbindliche Lebensregeln zu entwickeln, die vor Gesundheitsschädigungen schützen sollen. (…) Angstappelle und Verantwortungsappelle sind häufig benutzte Mittel“ (Göpel, in Barkholz, 1994, S. 25). Es kann hier auch von so genannten Abschreckungskampagnen gesprochen werden. Wenn im schulischen Zusammenhang von Gesundheitsförderung gesprochen wurde, dann wurde in der Regel die Gesundheitserziehung gemeint. Gesundheit war ein isoliertes Sachgebiet einiger Fächer, wie zum Beispiel Biologie oder Bewegung und Sport. „ Wissen und Können lagen weit auseinander, weil über Gesundheit lernen und gesund leben praktisch gar nicht oder nicht ausreichend vermittelt waren“ (Barkholz, 1994, S. 11). Infolge zahlreicher negativer Erfahrungen mit den Abschreckungskampagnen kam es in der Suchtpräventionspolitik vieler Industriestaaten zu einer inhaltlichen Verschiebung der Schwerpunkte in Richtung Lebenskompetenzsteigerung und sachliche Informationsvermittlung. Die Disziplin der Suchtprävention hat sich im deutschsprachigen Raum vor etwa 20 Jahren vorrangig in der Schweiz und in Deutschland entwickelt. In Österreich etablierte sie sich vor ca. 12 Jahren durch die Gründung eigener Einrichtungen zur Suchtprävention, wie zum Beispiel in Vorarlberg die Gründung der Werkstatt für Suchtprophylaxe Supro 1993 und ein Jahr später 1994 die Gründung des Instituts für Suchtprävention in Linz 1994.
Der professionelle Umgang mit dem Thema Sucht und dem damit verbundenen Missbrauch hat sich aber nun schon über viele Jahre in Richtung Gesundheitsförderung entwickelt. In den letzten 15 Jahren sind Fragen und Zusammenhänge von Gesundheit und Schule wesentlich stärker in die Diskussion geraten. Dies ist auf ein zunehmendes Interesse der pädagogisch und bildungspolitisch interessierten Öffentlichkeit zurückzuführen. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) sieht in dem Ansatz des gemeinschaftlichen Erkennens und Bearbeitens von Gesundheitsproblemen einen zentralen Beitrag zur Erhaltung, Verbesserung und Entwicklung von Gesundheit. Aus diesem Grund wurde dieses Konzept 1986 von der WHO in der „Ottawa–Charta für Gesundheit“ niedergeschrieben und dient heute als Grundlage für Gesundheitsförderungsinitiativen in den unterschiedlichsten Bereichen, wie zum Beispiel der Schule. Heute gibt es außerdem gesundheitsfördernde Netzwerke in Betrieben, Gefängnissen, Regionen, Inseln, Universitäten, etc.
1991 wurde von der WHO, dem Europarat und der Kommission der Europäischen Union das Europäische Netzwerk Gesundheitsfördernder Schulen als Gemeinschaftsprojekt ins Leben gerufen. Das Konzept einer gesundheitsfördernden Schule zielt „auf die Erreichung gesunder Lebensweisen für alle am Schulleben Beteiligten, indem es in der Schule unterstützende Umwelten zur Förderung der Gesundheit schafft“ (WHO, in Naidoo, 2003, S. 279). Das „Wiener Netzwerk–Gesundheitsfördernder Schulen“ wurde im Jahr 1997 im Rahmen des WHO–Projekts „Wien–Gesunde Stadt“ gegründet. Nach einer erfolgreichen Pilotphase, an der sich von 1997–2000 elf Schulen beteiligten, wurde das „Wiener Netzwerk–Gesundheitsfördernder Schulen“ für neue Schulen geöffnet. 2001/2002 umfasste das Netzwerk 35 Schulen unterschiedlicher Schultypen (Pflichtschule, Gymnasien, berufsbildende Schulen und Krankenpflegeschulen). Das Netzwerk zielt in Anlehnung an das Gesundheitsförderungsverständnis der Ottawa–Charta und im Sinne der Schulentwicklung darauf ab, Strukturen und Prozesse an den teilnehmenden Schulen in Richtung der gesundheitlichen Interessen der verschiedenen Gruppen der Schulgemeinschaft (Lehrer/Lehrerinnen, Schüler/Schülerinnen, Eltern und nicht unterrichtendes Personal) gemeinsam und gesundheitsförderlich zu gestalten (vgl. Dietscher, 2003, S. 9 f.).
3.3 Suchtprävention als wichtiger Bereich der Gesundheitsförderung
Um genauer auf Suchtprävention eingehen zu können, muss zunächst angeführt werden, dass sich der Bereich der Prävention in die Primärprävention, Sekundärprävention und die Tertiärprävention unterteilen lässt.
Ziel der Primärprävention ist es, die Entwicklung von Sucht bevor ein Kontakt zu spezifischen Substanzen stattgefunden hat, zu verhindern. „Es handelt sich bei dieser Aufgabe um eine früh einsetzende, langfristig angelegte, lebenslange Erziehung zum richtigen Umgang mit Drogen; hinzukommen muss eine allgemein präventive Erziehung mit dem Ziel, ein geeignetes Verhaltensrepertoire aufzubauen, um Drogenmissbrauch und allgemein abweichendes Verhalten besser zu verhüten“ (Feser, in Niebaum, 2001, S. 151). Die auf die Primärprävention aufbauende Sekundärprävention hat die Früherkennung und Frühbehandlung der bereits als drogen– bzw. suchtgefährdet geltenden Menschen zur Aufgabe. D.h. die Aufgabenbereiche der Sekundärprävention sind neben der aktiven Suche nach Drogengefährdeten, sowie die vorbeugenden Bemühungen um potentiell gefährdete Gruppen, auch die Unterstützung der einzelnen Personen in ihrer Konfliktbewältigung und die Beratung und Hilfe, die für spezifische Familien notwendig erscheint. Folglich dienen die Maßnahmen der Sekundärprävention der Wiederherstellung der Gesundheit nach einer Erkrankung oder Verletzung. Der Aufgabenbereich der Tertiärprävention umfasst die Reduzierung der Rückfallquote von Süchtigen, die sich einer Therapie unterzogen haben und die Eindämmung möglicher chronischer Entwicklungen und möglicher Pflegebedürftigkeit. Die Maßnahmen der Tertiärprävention zielen im Wesentlichen auf die Rehabilitation bereits süchtiger Menschen ab.
Für den Bereich von Suchtpräventionsprojekten in einer Schule bedeutet dies, dass alle drei Bereiche aufgegriffen werden können, um für Schüler/Schülerinnen ein erforderliches Projekt zu entwickeln. Nicht nur vorbeugende Aktivitäten sondern auch der Bereich der Wiederherstellung der Gesundheit bzw. vorbeugende Bemühungen um potentiell gefährdete Gruppierungen erscheinen in den untersuchten Schulen als sinnvoll. Grundlage einer effizienten Suchtprävention ist ein Präventionsverständnis im Sinne der Gesundheitsentstehung. Das bedeutet, dass es nicht unsere Absicht sein sollte, Sucht zu verhindern, sondern dass wir Maßnahmen der Suchtprophylaxe setzen (im speziellen bei Kindern und Jugendlichen), die zu einem ganzheitlichen Wohlbefinden, im körperlichen, psychischen und sozialen Bereich beitragen, sodass es gar nicht erst zu einem Suchtverhalten kommt. Folglich ist die Suchtprävention ein wesentlicher Anteil der allgemeinen Gesundheitsförderung.
Dieses wesentlich weiter gefasste Konzept (im Gegensatz dazu steht das Abschreckungskonzept der 80er Jahre, siehe Kap. 3.2) ermöglicht wirklich effiziente Maßnahmen, einerseits zur Unterstützung Heranwachsender bei der Entfaltung ihrer Persönlichkeit, andererseits Mitgestaltung gesunder Lebensräume, in denen diese Entfaltung auch stattfinden kann. Fachleute im Tätigkeitsfeld der Suchtprävention haben die Aufgabe, möglichst viele Impulse zu setzen, die einzelne Personen anregen, sich mit sich selbst und ihrer Gesundheit und ihrem Verhalten auseinanderzusetzen. Im suchtpräventiven Sinne ist es für junge Menschen wichtig persönlichkeitsfördernde Kompetenzen wie Selbstständigkeit, Selbstsicherheit und individuelle und soziale Kompetenzen zu entwickeln, um der Sucht etwas entgegenzusetzen.
3.4 Projektorientierte Ansätze der Suchtprävention
Gesundheitsförderung und Suchtprävention sind zwei Begriffe, die oft im sprachlichen Alltagsgebrauch Verwendung finden. Aus diesem Grund kann es leicht zu einer Verschmelzung der Begrifflichkeiten kommen. Eine genaue Definition ist daher wichtig.
Das gemeinsame Ziel aller Präventionsarten ist die Wiederherstellung bzw. Erhaltung der Gesundheit.
Hefel versteht unter Suchtprävention das „wirksame Vorbeugen aller Formen von Sucht bei Einzelpersonen oder ganzen Bevölkerungsgruppen, so dass Suchtprobleme erst gar nicht entstehen können“ (Hefel, in Weidenholzer 1997, S. 19).
Suchtprävention war früher an der Findung der Ursache für die Sucht orientiert. Sie entwickelte sich in zunehmendem Maße in Richtung Gesundheits- und Entwicklungsförderung. Ihr Tätigkeitsfeld reicht von der Familie, Schule und Gesellschaft, bis zu den Jugendlichen. Weiters umfasst sie sowohl Kinder als auch Erwachsene, bis hin zum alten Menschen und berücksichtigt unterschiedliche Lebenswelten. Als Ziele der Suchtprävention wären zu nennen: die Stärkung und Förderung der Persönlichkeit, der Konfliktlösungsfähigkeit und sozialer Kompetenzen, wobei sich die Suchtprävention an den vorhandenen Ressourcen orientiert und nicht an den Defiziten. Sie sollte somit bereits im frühkindlichen Alter beginnen.
Die neue Risikogruppe, bei der die Suchtprävention ansetzen muss, sind leistungsüberforderte Menschen, die leistungssteigernde Substanzen benützen, um mit den steigenden Anforderungen der Gesellschaft (wie Jugendlichkeit, Bildung, Geschwindigkeit) mithalten zu können. Es existieren unterschiedliche Ansätze der Suchtprävention. Im Folgenden soll ein Überblick über die aufgelisteten projektorientierten suchtpräventiven Ansätze, die Fellöcker (2000) in einem Buch beschrieben hat, gegeben werden.
a) Salutogenetischer Ansatz
„Salus“ kommt aus dem Lateinischen und bedeutet so viel wie „Unverletztheit, Heil, Glück“, „Genese“ kommt aus dem Griechischen und bedeutet „Entstehung“ (vgl. Bengel, in Dorner, 2004, S. 5).
Während sich die Vertreter des verbreiteten pathogenetischen Denkansatzes überwiegend mit dem Entstehen und Heilen von Krankheiten beschäftigen, lautet die salutogenetische Fragestellung umfassend: Wie wird ein Mensch mehr gesund und weniger krank“ (Dorner, 2004, S. 5). Wenn man den salutogenetischen Ansatz auf den Umgang mit Suchtmitteln überträgt, geht es darum, auf persönlicher und struktureller Ebene die individuellen vorhandenen Bewältigungsressourcen zu stärken und die Risikofaktoren zu minimieren (vgl. Antonovsky, 1979).
b) Protektiver Ansatz
Schutz- oder protektive Faktoren bewahren Personen davor, selbstschädigende Verhaltensweisen wie z.B. Substanzmissbrauch zu entwickeln. Als wichtige Schutzfaktoren führt Troschke (1995) u.a. Selbstvertrauen, Fremdvertrauen und Hoffnungsbereitschaft, sowie die Fähigkeit, Nähe und Distanz regulieren zu können, an. Nach Rutter (1990) weisen protektive Faktoren eine bedeutende Funktion im Verständnis von Risikoprozessen vor. Sie bewirken eine Minimierung der Risikoeinwirkung und eine Verhinderung von negativen Kettenreaktionen (vgl. Fellöcker, 2000).
c) Risikokompetenzansatz
Risikokompetenz soll Jugendliche „befähigen, Sicherheit in riskanten Situationen selbst herzustellen und gleichzeitig ihr Entwicklungspotential in allen Bereichen des Lernens auszuschöpfen“ (Vetter, 2004, S. 3 f.). Das Risiko einer Suchtabhängigkeit kann durch eine Verringerung der Einwirkung minimiert werden. Nur hat das Risikoverhalten die durchaus positive Eigenschaft, den Umgang mit Grenzsituationen zu lernen. Der Erwerb dieser Risikokompetenz ist somit ein autonomes und sehr bedeutendes Ziel in der Entwicklung der Persönlichkeit des Jugendlichen (vgl. Franzkowiak, 1994). Außerdem stellt das Risiko nach Erben (1986) eine „Grundkategorie menschlichen Lebens“ dar, welche auszuschalten als einen Angriff auf das Leben selbst zu verstehen ist.
In der Prävention selbst sollte nun die Sinnhaftigkeit des Risikoverhaltens berücksichtigt und als ein Teil der Präventionsarbeit angesehen werden.
d) Ansatz des sozialen Lernens
„Die Theorie des sozialen Lernens geht davon aus, dass der Erwerb eines Verhaltens mit den damit verbundenen negativen oder positiven Konsequenzen korreliert und das Verhaltensweisen von als Modell akzeptierten Personen übernommen werden“(zit. Fellöcker, nach Bandura 1979). Umgelegt auf die Suchtprävention bedeutet das, dass Strategien zur Verbesserung des Verhaltens gegenüber externen Einflüssen entwickelt werden.
e) Ansatz der Alternativen zum Substanzmissbrauch
Ein bestimmtes Verhalten wird so lange nicht eingestellt bzw. verändert, wie keine besseren Alternativen gefunden worden sind. Für die Suchtprävention bedeutet dies die Förderung eines breiten Spektrums an Verhaltensweisen, die z.B. bei der Bewältigung mit konflikthaften Situationen dienlich sein sollten, oder auch beim Umgang mit Langeweile helfen könnten (vgl. Koller, in Fellöcker 2000).
f) Lebenskompetenzenansatz (life skills approach)
Dieser Ansatz basiert auf der Annahme, dass wenn ein Mensch über ausreichende Fähigkeiten zur Lebensbewältigung verfügt, er in geringerem Maße Gefahr läuft, in selbstschädigende Prozesse wie z.B. eine Suchtmittelabhängigkeit verwickelt zu werden. In den Pogrammen, die die Förderung allgemeiner Lebenskompetenzen zum Ziel haben, werden überwiegend Methoden aus der Verhaltensmodifikation wie Rollenspiel, Entspannungsverfahren und/oder Selbstinstruktionen eingesetzt.
[...]
Häufig gestellte Fragen
Warum ist Suchtprävention in der Schule so wichtig?
Schulen bieten ein ideales Umfeld, um Jugendliche frühzeitig über die Gefahren von Abhängigkeiten aufzuklären und ihre Lebenskompetenzen zu stärken, bevor sich süchtiges Verhalten festigt.
Was ist der Unterschied zwischen stoffgebundenen und nicht stoffgebundenen Süchten?
Stoffgebundene Süchte beziehen sich auf Substanzen (Drogen, Alkohol, Tabak). Nicht stoffgebundene Süchte umfassen Verhaltensweisen wie Spielsucht, Kaufsucht oder Essstörungen.
Was bedeutet das Wort „Sucht“ ursprünglich?
Etymologisch leitet sich „Sucht“ vom Verb „siechen“ ab, was „krank sein“ bedeutet. Es beschreibt ein krankhaftes Verlangen, dem das Merkmal der freien Entscheidung fehlt.
Welche Qualitätskriterien gelten für Suchtpräventionsprojekte?
Wichtige Kriterien sind eine klare Zielsetzung, Nachhaltigkeit, Vernetzung der Beteiligten, Evaluation der Ergebnisse und ein settingorientiertes Vorgehen.
Wie wird Gesundheitsförderung in Schulen umgesetzt?
Gesundheitsförderung erfolgt oft durch projektorientierte Ansätze, die Schüler, Lehrer und Eltern einbeziehen, um ein gesundheitsbewusstes Schulklima zu schaffen.
- Citation du texte
- Rainer Hofmann (Auteur), 2006, Suchtprävention in der Schule, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/93000