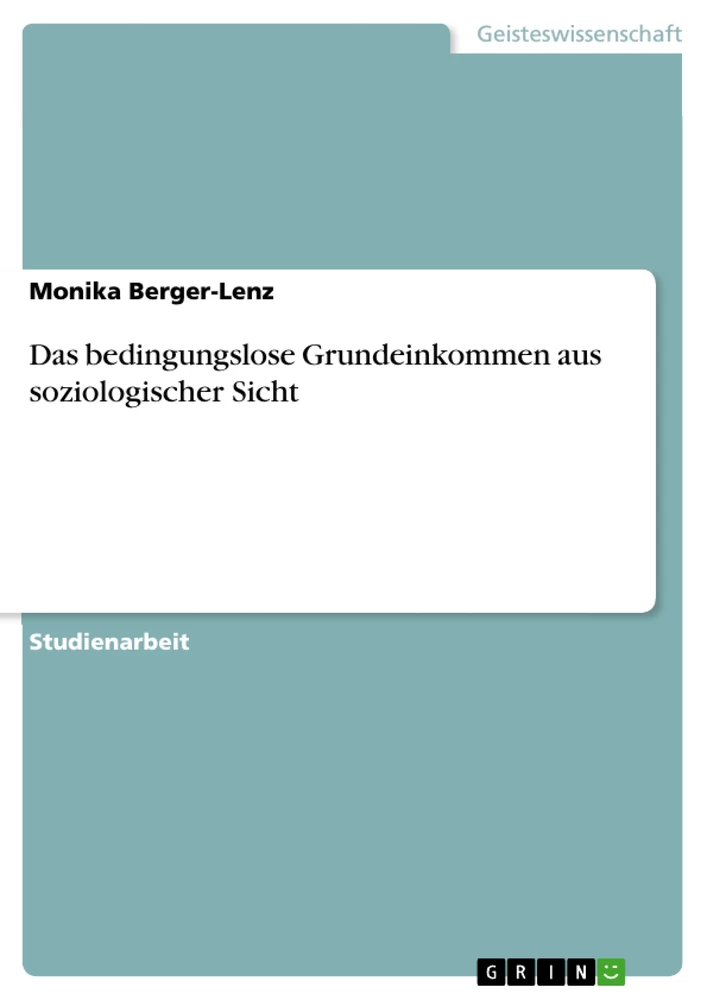Der Mensch braucht Einkommen, um zu leben. Und er hat zunehmend seltener die Möglichkeit, dieses Einkommen aus Arbeit zu beziehen. An dieser Stelle setzt die Idee des bedingungslosen Grundeinkommens, im folgenden BGE genannt, an. Doch wäre das BGE tatsächliche eine Lösung? Welche Auswirkungen hätte es auf die Menschen? Würden sie vielleicht ihre sozialen Kontakte verlieren, sich zurückziehen, isolieren? Würden sie krank werden, weil ihnen die Arbeit fehlt? Möglicherweise würden sie sich nicht mehr bilden? Wie steht es um das Leben in der Familie, wenn es das BGE gäbe? In dieser Arbeit werden diese Punkte näher betrachtet. Bei der zugrundeliegenden Literatur handelt es sich um sozialwissenschaftliche Erkenntnisse und Theorien. Empirische Untersuchungen einer solchen Situation gibt es nicht, da es das BGE noch nicht gibt. Die Diskussion dazu verläuft allerdings immer engagierter. An dieser Stelle soll ein Überblick über den Stand der Debatte gegeben werden. Dabei überwiegt die Argumentation der Befürworter eines BGEs. Eine grundlegende Auseinandersetzung der Kritiker des BGEs mit diesem Thema gibt es derzeit kaum. Wo es sie gibt, bezieht sie sich hauptsächlich auf wirtschaftliche Argumente. Unabhängig davon, inwieweit diese zutreffen oder auf Annahmen statt Zahlen beruhen, sollen an dieser Stelle jedoch lediglich die soziologischen Aspekte betrachtet werden. In einem ersten Teil wird das BGE definiert. Dabei werden sowohl Ursprung der Idee als auch aktuelle Konzepte näher betrachtet. In den folgenden Kapiteln sollen die verschiedenen soziologischen Aspekte eines BGEs dargestellt werden. Es wird sich dabei zeigen, dass die Einführung eines BGEs ein grundlegendes Umdenken in der Gesellschaft zur Folge haben dürfte. Die Auswirkungen eines BGEs auf die Gesellschaft wären voraussichtlich enorm.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Begriffliche Definition
- Bedingungsloses Grundeinkommen
- Arbeit
- Das Bedingungslose Grundeinkommen - Von der Idee zum Konzept
- Geschichte
- Konzepte
- Das Bedingungslose Grundeinkommen und seine Auswirkungen
- Gesellschaft
- Demokratie und Freiheit
- Familie
- Bildung
- Gesundheit
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit analysiert das bedingungslose Grundeinkommen (BGE) aus soziologischer Sicht. Sie untersucht die Idee und Entwicklung des BGEs sowie seine potenziellen Auswirkungen auf die Gesellschaft, die Demokratie, die Familie, die Bildung und die Gesundheit. Die Arbeit bezieht sich dabei auf sozialwissenschaftliche Erkenntnisse und Theorien, da empirische Daten zum BGE aufgrund dessen Nicht-Existenz noch nicht verfügbar sind.
- Definition des bedingungslosen Grundeinkommens und seine Abgrenzung von anderen Sozialleistungen
- Entwicklung des Konzepts vom 16. Jahrhundert bis zur Gegenwart
- Soziologische Auswirkungen des BGEs auf verschiedene Lebensbereiche
- Das BGE im Kontext der sich wandelnden Arbeitswelt
- Beurteilung der Argumente von Befürwortern und Kritikern des BGEs
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die aktuelle Debatte um das BGE vor und skizziert die zentralen Fragen, die in der Arbeit untersucht werden. Kapitel 2 definiert das bedingungslose Grundeinkommen und setzt es in Relation zum Begriff der Arbeit. Dabei werden verschiedene Definitionen von Arbeit und deren Relevanz für die Debatte um das BGE beleuchtet. Kapitel 3 beleuchtet die Geschichte des Konzepts und die wichtigsten Konzepte des bedingungslosen Grundeinkommens.
Schlüsselwörter
Bedingungsloses Grundeinkommen, Arbeit, Sozialpolitik, Gesellschaft, Demokratie, Freiheit, Familie, Bildung, Gesundheit, Soziologie, Empirie, Theorie
- Citar trabajo
- Monika Berger-Lenz (Autor), 2008, Das bedingungslose Grundeinkommen aus soziologischer Sicht, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/93038