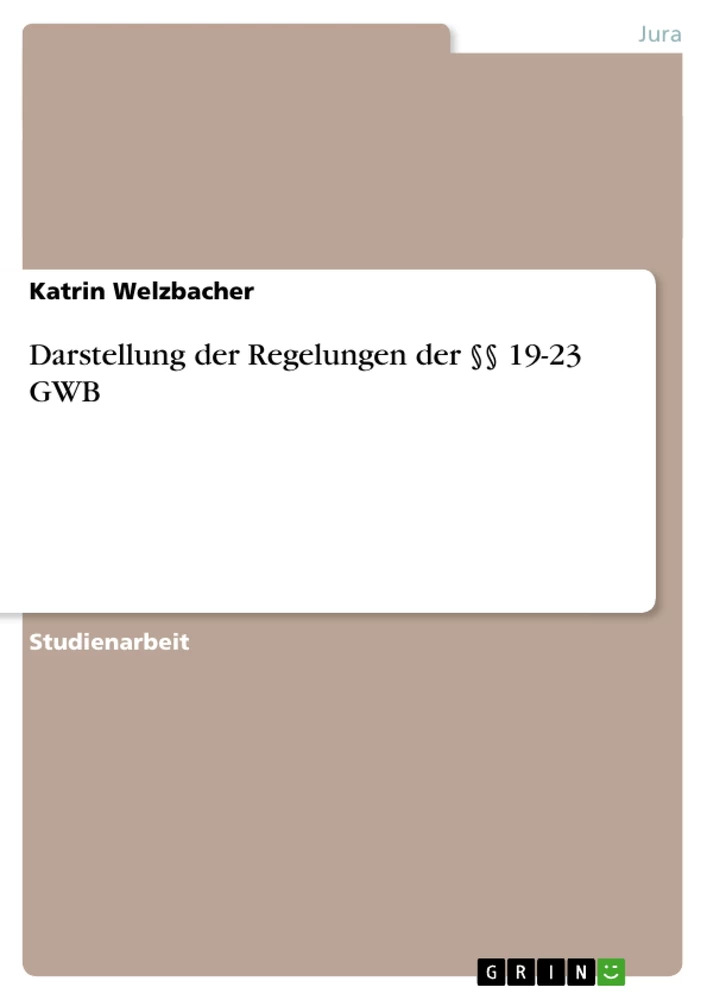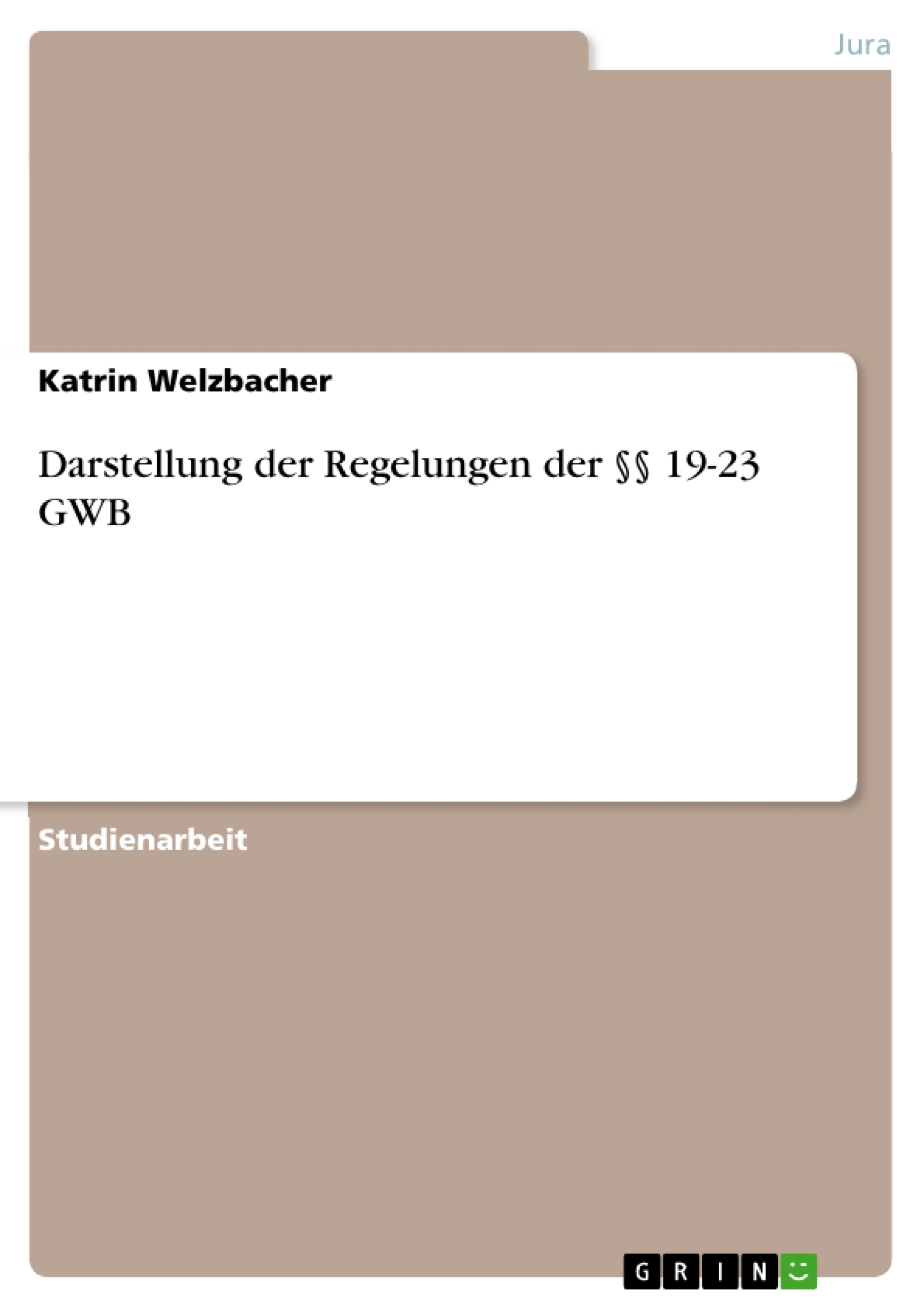Das GWB stellt eines der wichtigsten Gesetze der deutschen Wirtschaft dar und verfolgt das Ziel, den Bestand des Wettbewerbs zu sichern. Deshalb soll der freie Wettbewerb unterstützt und gefördert werden, um ein funktionierendes Verhältnis zwischen Angebot und Nachfrage zu gewährleisten. Dieses Verhältnis ist gestört, sobald Unternehmen Absprachen bei Entscheidungen treffen (Kartellbildung) oder eine derart starke Stellung auf dem Markt besitzen, dass sie keinerlei Rücksicht auf die Wettbewerber nehmen müssen und diese Situation ausnutzen.
Der jeweilige Marktgegner, zumeist der Verbraucher, hat in diesen Fällen keine Möglichkeit frei zu entscheiden, da ihm entweder die Alternativen fehlen oder stark eingeschränkt sind. Die regulierende Wirkung des Wettbewerbs ist somit ausgehebelt.
Um dies zu verhindern, hat der Gesetzgeber drei Tatbestandsgruppen (Kartelle, Vertikalvereinbarungen, Marktbeherrschung) im GWB definiert, für die Regelungen getroffen wurden.1
Die Überwachung dieser Gebiete obliegt hauptsächlich dem Bundeskartellamt mit Sitz in Bonn. Es ist zuständig, wenn die Wirkung eines wettbewerbswidrigen Verhaltens über die Landesgrenzen hinaus geht. Ist dies nicht der Fall, sind die obersten Landesbehörden zuständig.
Zusätzlich ist anzumerken, dass bei bestimmten Verstößen auch das UWG zur Anwendung kommen kann, das grundsätzlich neben dem GWB anwendbar ist.
Die nachfolgende Arbeit befasst sich mit der Tatbestandsgruppe Marktbeherrschung und wettbewerbsbeschränkendes Verhalten, das in den §§ 19 bis 23 GWG geregelt wird.
Grundsätzlich sind marktbeherrschende Unternehmen, die allein aufgrund ihres Bestehens eine besondere Position auf dem Markt einnehmen, nicht verboten. Erst die missbräuchliche Ausnutzung dieser Stellung führt zur Anwendung des GWB, das außerdem ein Diskriminierungsverbot und ein Verbot unbilliger Behinderung beinhaltet.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung (§ 19 GWB)
- 2.1 Marktabgrenzung
- 2.1.1 Sachliche Abgrenzung
- 2.1.2 Räumliche und zeitliche Abgrenzung
- 2.2 Marktbeherrschung
- 2.3 Vermutung einer marktbeherrschenden Stellung
- 2.4 Besondere Missbrauchstatbestände
- 2.1 Marktabgrenzung
- 3 Diskriminierungsverbot bzw. Verbot unbilliger Behinderung (§ 20 GWB)
- 3.1 Geltungsbereich der Vorschrift
- 3.1.1 Normadressaten
- 3.1.2 Gleichartiger Geschäftsverkehr
- 3.2 Behinderungsverbot
- 3.3 Diskriminierungsverbot
- 3.4 Missbrauch der Marktmacht
- 3.5 Aufnahmegebot
- 3.1 Geltungsbereich der Vorschrift
- 4 Boykottverbot, Verbot sonstigen wettbewerbsbeschränkenden Verhaltens (§ 21 GWB)
- 4.1 Boykottverbot
- 4.2 Einsatz von Druckmitteln
- 4.3 Zwangsausübung
- 5 Empfehlungenverbot (§ 22 GWB)
- 5.1 Tatbestand
- 5.2 Ausnahmen
- 5.2.1 Mittelstandsempfehlungen
- 5.2.2 Normen- und Typenempfehlungen
- 5.2.3 Konditionenempfehlungen
- 5.2.4 Unverbindliche Preisempfehlung für Markenwaren (§ 23 GWB)
- 6 Rechtsfolgen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit befasst sich mit der Darstellung der Regelungen der §§ 19-23 GWB über Marktbeherrschung und wettbewerbswidriges Verhalten auf nationaler Ebene. Ziel ist es, anhand von Fallbeispielen ein Verständnis für die komplexen Rechtsnormen zu entwickeln und deren Anwendung zu veranschaulichen.
- Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung (§ 19 GWB)
- Diskriminierungsverbot und Verbot unbilliger Behinderung (§ 20 GWB)
- Boykottverbot und Verbot wettbewerbsbeschränkenden Verhaltens (§ 21 GWB)
- Empfehlungenverbot (§ 22 GWB)
- Rechtsfolgen bei Verstößen
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der Seminararbeit ein und beschreibt den Gegenstand der Untersuchung: die Regelungen der §§ 19-23 GWB. Sie skizziert den Aufbau der Arbeit und die Methodik, die zur Analyse der komplexen Rechtsmaterie verwendet wird. Der Fokus liegt auf der praktischen Anwendung der Gesetze anhand von Fallbeispielen, um ein tiefgehendes Verständnis zu ermöglichen.
2 Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung (§ 19 GWB): Dieses Kapitel analysiert den Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung gemäß § 19 GWB. Es beginnt mit der Definition und Abgrenzung des relevanten Marktes, unterscheidet zwischen sachlicher, räumlicher und zeitlicher Abgrenzung. Anschließend werden die Kriterien der Marktbeherrschung detailliert erläutert, inklusive der Vermutung einer marktbeherrschenden Stellung. Der Schwerpunkt liegt auf den verschiedenen Missbrauchstatbeständen, die im Detail dargestellt und durch Beispiele aus der Praxis illustriert werden. Die Bedeutung der jeweiligen Tatbestände für die Wettbewerbsordnung wird hervorgehoben.
3 Diskriminierungsverbot bzw. Verbot unbilliger Behinderung (§ 20 GWB): Das Kapitel behandelt das Diskriminierungsverbot und das Verbot unbilliger Behinderung nach § 20 GWB. Es klärt zunächst den Geltungsbereich der Vorschrift, einschließlich der Normadressaten und des gleichartigen Geschäftsverkehrs. Das Behinderungsverbot und das Diskriminierungsverbot werden differenziert dargestellt, wobei der Zusammenhang zwischen Marktmacht und wettbewerbswidrigem Verhalten analysiert wird. Das Aufnahmegebot wird im Kontext der unbilligen Behinderung erläutert. Die Ausführungen werden durch relevante Fallbeispiele veranschaulicht.
4 Boykottverbot, Verbot sonstigen wettbewerbsbeschränkenden Verhaltens (§ 21 GWB): Dieses Kapitel konzentriert sich auf das Boykottverbot und das Verbot sonstigen wettbewerbsbeschränkenden Verhaltens gemäß § 21 GWB. Es untersucht den Tatbestand des Boykotts und analysiert den Einsatz von Druckmitteln und die Ausübung von Zwang als wettbewerbsbeschränkende Maßnahmen. Die Bedeutung dieses Paragraphen für den Schutz des freien Wettbewerbs wird betont und durch relevante Gerichtsentscheidungen untermauert.
5 Empfehlungenverbot (§ 22 GWB): Das Kapitel widmet sich dem Empfehlungenverbot nach § 22 GWB und analysiert den gesetzlichen Tatbestand. Besondere Aufmerksamkeit wird den Ausnahmen von diesem Verbot gewidmet, wie beispielsweise Mittelstandsempfehlungen, Normen- und Typenempfehlungen, Konditionenempfehlungen und unverbindlichen Preisempfehlungen für Markenwaren (§ 23 GWB). Die jeweiligen Voraussetzungen und Grenzen dieser Ausnahmen werden im Detail erörtert.
Schlüsselwörter
Marktbeherrschung, Wettbewerbswidriges Verhalten, § 19 GWB, § 20 GWB, § 21 GWB, § 22 GWB, § 23 GWB, Diskriminierung, Unbillige Behinderung, Boykott, Empfehlungen, Kartellrecht, Wettbewerbsrecht, Fallbeispiele, Rechtsfolgen.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Seminararbeit: Marktbeherrschung und wettbewerbswidriges Verhalten nach §§ 19-23 GWB
Was ist der Gegenstand dieser Seminararbeit?
Die Seminararbeit befasst sich mit den Regelungen der §§ 19-23 GWB (Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen) über Marktbeherrschung und wettbewerbswidriges Verhalten auf nationaler Ebene. Sie analysiert die komplexen Rechtsnormen und veranschaulicht deren Anwendung anhand von Fallbeispielen.
Welche Themen werden in der Seminararbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Schwerpunktthemen: Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung (§ 19 GWB), Diskriminierungsverbot und Verbot unbilliger Behinderung (§ 20 GWB), Boykottverbot und Verbot wettbewerbsbeschränkenden Verhaltens (§ 21 GWB), Empfehlungenverbot (§ 22 GWB) und die Rechtsfolgen bei Verstößen gegen diese Vorschriften.
Wie ist die Seminararbeit aufgebaut?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, Kapitel zu den einzelnen Paragraphen des GWB (§§ 19-23), eine Zusammenfassung der Kapitel und eine Liste der Schlüsselbegriffe. Jedes Kapitel analysiert den jeweiligen Paragraphen detailliert und veranschaulicht die Anwendung anhand von Beispielen aus der Praxis.
Was wird unter "Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung (§ 19 GWB)" verstanden?
Dieses Kapitel definiert und grenzt den relevanten Markt ab (sachlich, räumlich, zeitlich) und erläutert die Kriterien der Marktbeherrschung, inklusive der Vermutung einer marktbeherrschenden Stellung. Es werden verschiedene Missbrauchstatbestände detailliert dargestellt und durch Praxisbeispiele illustriert.
Was beinhaltet das Kapitel zum Diskriminierungsverbot und Verbot unbilliger Behinderung (§ 20 GWB)?
Hier wird der Geltungsbereich der Vorschrift (Normadressaten, gleichartiger Geschäftsverkehr) geklärt. Das Behinderungsverbot und das Diskriminierungsverbot werden differenziert dargestellt, der Zusammenhang zwischen Marktmacht und wettbewerbswidrigem Verhalten analysiert und das Aufnahmegebot erläutert. Relevante Fallbeispiele veranschaulichen die Ausführungen.
Worauf konzentriert sich das Kapitel zum Boykottverbot und Verbot sonstigen wettbewerbsbeschränkenden Verhaltens (§ 21 GWB)?
Dieses Kapitel untersucht den Tatbestand des Boykotts, den Einsatz von Druckmitteln und die Ausübung von Zwang als wettbewerbsbeschränkende Maßnahmen. Die Bedeutung dieses Paragraphen für den Schutz des freien Wettbewerbs wird betont und durch Gerichtsentscheidungen untermauert.
Was wird im Kapitel zum Empfehlungenverbot (§ 22 GWB) behandelt?
Das Kapitel analysiert den gesetzlichen Tatbestand des Empfehlungenverbots und die Ausnahmen hiervon (Mittelstandsempfehlungen, Normen- und Typenempfehlungen, Konditionenempfehlungen, unverbindliche Preisempfehlungen für Markenwaren nach § 23 GWB). Die Voraussetzungen und Grenzen dieser Ausnahmen werden detailliert erörtert.
Welche Rechtsfolgen werden bei Verstößen gegen die §§ 19-23 GWB behandelt?
Die Seminararbeit behandelt die Rechtsfolgen von Verstößen gegen die §§ 19-23 GWB, allerdings wird der genaue Inhalt nicht explizit im FAQ aufgeführt. Details dazu finden sich im entsprechenden Kapitel der Seminararbeit.
Welche Schlüsselwörter sind relevant für diese Seminararbeit?
Die wichtigsten Schlüsselwörter sind: Marktbeherrschung, Wettbewerbswidriges Verhalten, § 19 GWB, § 20 GWB, § 21 GWB, § 22 GWB, § 23 GWB, Diskriminierung, Unbillige Behinderung, Boykott, Empfehlungen, Kartellrecht, Wettbewerbsrecht, Fallbeispiele, Rechtsfolgen.
- Quote paper
- Katrin Welzbacher (Author), 2002, Darstellung der Regelungen der §§ 19-23 GWB, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/9304