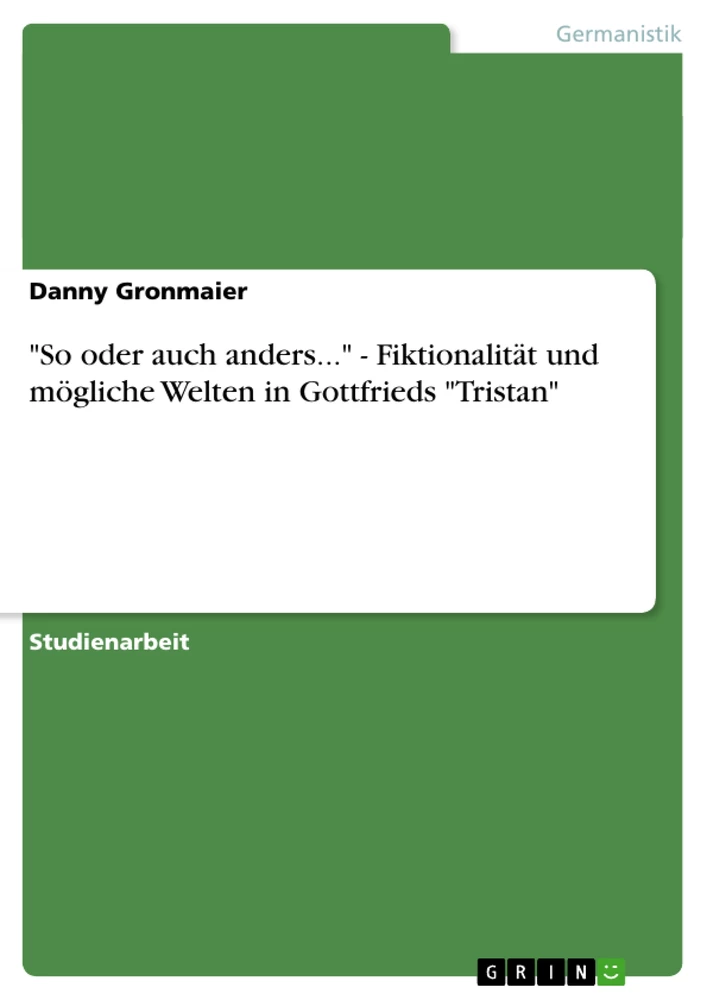Die literaturtheoretische Diskussion um dichterische Wahrheit und ihren Bezug zu einer faktischen Wirklichkeit ist ungebrochen. Eine entscheidende Rolle hierbei spielt die Fiktionalitätstheorie. Was ist eigentlich Fakt, was Fiktion? Und kann man diese zwei Kategorien überhaupt so einfach trennen? Das Bewusstsein für solche Fragestellungen nahm in der Antike schon sehr früh ihren Anfang. Der mögliche Beginn einer Entwicklung hin zu einem modernen Fiktionalitätsbegriff ist in der Zeit um 1200 auszumachen. Ich möchte in dieser Arbeit über eine allgemeine Begriffsbestimmung von Fiktionalität diesen Beginn näher beleuchten und zu einem Konzept der möglichen Welten hinführen. Dieses Modell soll dann auf den Tristanroman Gottfrieds von Straßburg angewendet werden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Fiktionalität
- Fiktionalität im höfischen Roman um 1200
- Alternativität und das Konzept der möglichen Welten
- Gottfrieds „Tristan“
- Autor-Alternativen
- Charakter-Alternativen
- Ergebnisse
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit der Frage, wie sich der Begriff der Fiktionalität im Kontext des höfischen Romans um 1200 verstehen lässt. Ziel ist es, die Entwicklung einer modernen Fiktionalitätskonzeption zu beleuchten und diese mit dem Konzept der möglichen Welten zu verbinden. Diese theoretischen Grundlagen werden dann auf den Tristanroman Gottfrieds von Straßburg angewendet.
- Entwicklung des Fiktionalitätsbegriffs um 1200
- Das Konzept der möglichen Welten
- Anwendung des Konzepts auf den Tristanroman
- Alternative Welten in Gottfrieds Tristan
- Fiktionaler Vertrag zwischen Autor und Leser
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung skizziert die Relevanz der Fiktionalitätstheorie in der Literaturwissenschaft und die Herausforderungen, die sich aus der Unterscheidung zwischen Fakt und Fiktion ergeben. Sie stellt die historische Entwicklung des Fiktionalitätsbegriffs und den Fokus auf die Anwendung des Konzepts der möglichen Welten auf Gottfrieds Tristanroman vor.
- Fiktionalität: Dieses Kapitel beschäftigt sich mit verschiedenen Ansätzen zur Definition von Fiktionalität. Es untersucht die Unterscheidung zwischen fiktionalen und nicht-fiktionalen Texten und die Bedeutung des Verhältnisses von Wirklichkeit, schriftlichen Aussagen und Wahrheit.
- Alternativität und das Konzept der möglichen Welten: Dieses Kapitel erörtert das Konzept der möglichen Welten als Modell, um die verschiedenen Möglichkeiten der Darstellung von Wirklichkeit in literarischen Texten zu erfassen. Es diskutiert die vielfältigen Perspektiven auf die Welt und ihre Bedeutung für die Fiktionalitätsanalyse.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit zentralen Themen der Literaturwissenschaft wie Fiktionalität, mögliche Welten, höfischer Roman, Tristanroman, Gottfried von Straßburg, Mittelalter, Textanalyse, Wirklichkeitsbegriff und Textualität. Sie untersucht die spezifischen Eigenschaften von Fiktionalität im Kontext der mittelalterlichen Literatur und verbindet diese mit dem Konzept der möglichen Welten, um ein tieferes Verständnis des Tristanromans zu ermöglichen.
Was untersucht die Arbeit im Hinblick auf Gottfrieds "Tristan"?
Die Arbeit wendet das Konzept der "möglichen Welten" auf den Tristanroman an, um das Verhältnis von Fakt und Fiktion sowie alternative Handlungsverläufe zu beleuchten.
Wann begann die Entwicklung des modernen Fiktionalitätsbegriffs?
Laut der Arbeit ist der Beginn einer Entwicklung hin zu einem modernen Fiktionalitätsbegriff in der Zeit um 1200, insbesondere im höfischen Roman, auszumachen.
Was versteht man unter dem "Konzept der möglichen Welten"?
Es ist ein literaturtheoretisches Modell, um verschiedene Perspektiven und Alternativen der Darstellung von Wirklichkeit in Texten zu erfassen.
Welche "Alternativen" werden im Tristanroman analysiert?
Die Untersuchung unterscheidet zwischen Autor-Alternativen (wie der Text hätte geschrieben werden können) und Charakter-Alternativen (Handlungsoptionen der Figuren).
Was ist der "fiktionale Vertrag"?
Es handelt sich um die unausgesprochene Übereinkunft zwischen Autor und Leser darüber, wie die fiktive Welt des Textes im Verhältnis zur Realität zu verstehen ist.