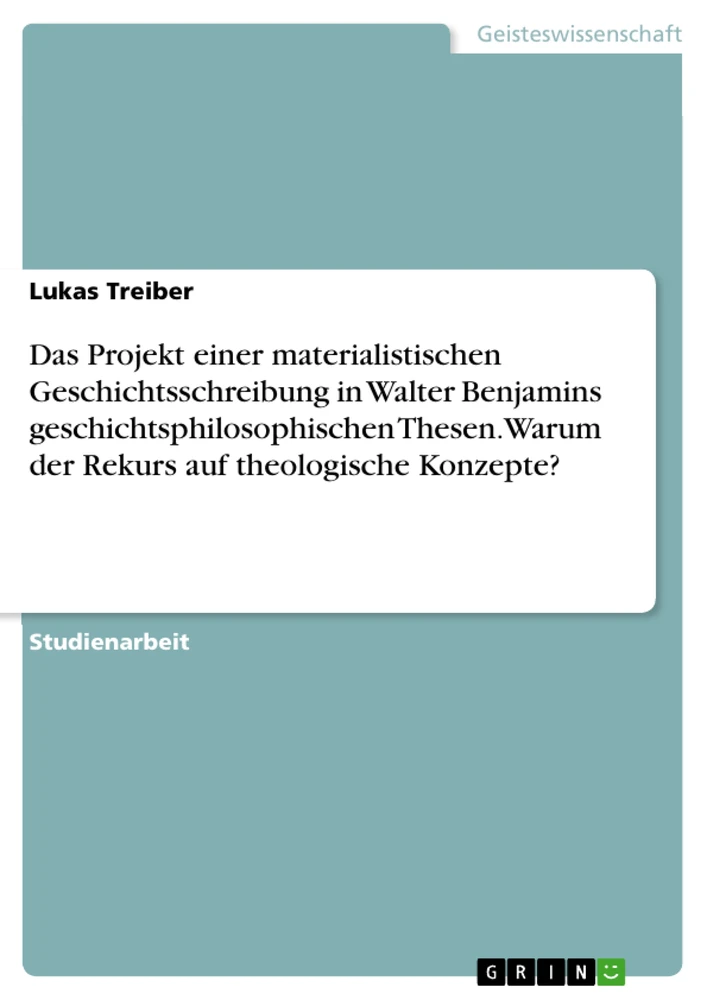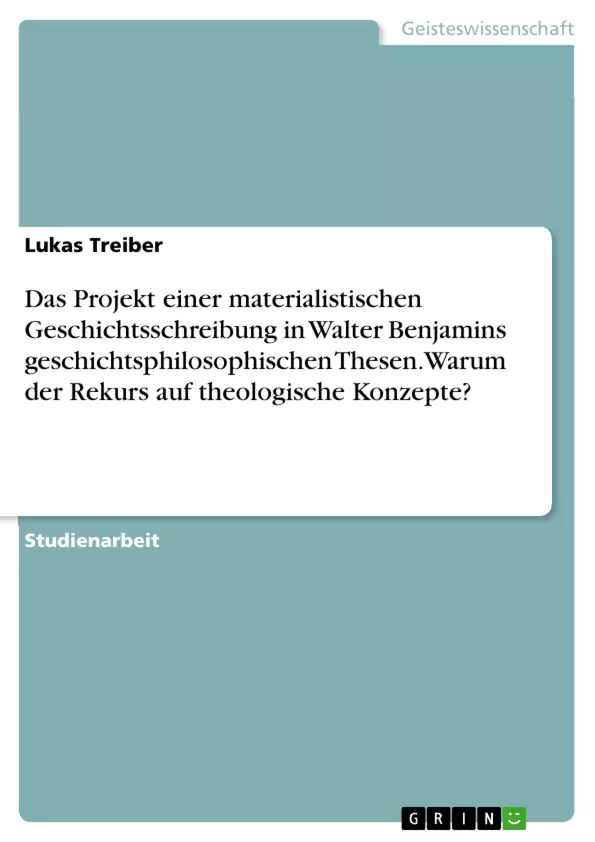Die Rekonstruktion und Analyse Benjamins materialistischer Geschichtsschreibung, die den Kern dieser Arbeit bildet, vollzieht der Autor anhand von drei Schlüsselthemen.
Zunächst richtet er sein Augenmerk auf Benjamins Abgrenzung vom konservativen Historis-mus. Er knüpft dabei an die Analysen von Gagnebin, Fürnkäs, Raulet und Cvejić an, um seine Interpretation Benjamins zu stützen. Da im Rahmen dessen eine Hinwendung zu Benjamins materialistischer Geschichtsschreibung unerlässlich ist, skizziert er im Anschluss die theoretischen Voraussetzungen und Praxis dieser. Dabei rekurriert er auf Benjamins Konzept des Eingedenkens (Marcheson), des Zitats (Voigts) und die Dialektik des Stillstands (Wong). Des Weiteren untersucht er Benjamins Abgrenzung vom Fortschrittsoptimismus seiner Zeit. Dazu setzt der Autor sich mit Marx Kritik am Gothaer Programm und Schmidts Marxrezeption auseinander, um Benjamins eigenständige Position auch in Abgrenzung zu einer marxistisch-utopischen Position herauszuarbeiten.
Seit der ersten, von Peter Bulthaup 1975 herausgegebenen Sammlung von Aufsätzen zu Ben jamins Thesen, hat sich die wissenschaftliche Auseinandersetzung vorwiegend auf den Widerstreit der beiden wichtigsten Denkrichtungen konzentriert: Theologie (Sholem) und Marxismus (Brecht). Im letzten Schritt will der Autor diese unilateralen Lesarten jedoch vernachlässigen. Stattdessen entwickelt er auf der Basis von Löwy und Wong ein neues Verständnis für die Funktion theologischer Motive bei Benjamin. Für den Autor ist dabei die Frage zentral, warum sich Benjamin theologischer Figuren und Konzepte bei dem Versuch bedient, eine kritische Historiographie und revolutionäre Praktik zu denken.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Überlegungen zum Historismus
- Abgrenzung vom konservativen Historismus
- Eingedenken als Mittel materialistischer Geschichtsschreibung
- Struktureller Wandel durch materialistische Geschichtsschreibung
- Dialektik im Stillstand
- Überlegungen zum Fortschritt
- Abgrenzung vom gegenwärtigen Fortschrittsbegriff
- Kritik am Fortschrittsglauben der sozialdemokratischen Arbeiterpartei
- Angelus Novus
- Überlegungen zur Theologie
- Materialismus und Messianismus
- Theologie als Mittel zur Erörterung materialistischer Geschichtsschreibung
- Schlussbetrachtung
- Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit Walter Benjamins Geschichtsphilosophie und analysiert seine materialistische Geschichtsschreibung, die er als Gegenentwurf zum konservativen Historismus und Fortschrittsoptimismus seiner Zeit entwickelt. Der Fokus liegt auf der Rekonstruktion und Analyse von Benjamins Argumentation, wobei drei Schlüsselthemen im Vordergrund stehen: die Abgrenzung vom konservativen Historismus, die Kritik am Fortschrittsoptimismus sowie die Rolle theologischer Motive in Benjamins Geschichtsphilosophie.
- Kritik am konservativen Historismus und dessen einseitigen Fokus auf abgeschlossene Ereignisse
- Entwicklung des Konzepts der materialistischen Geschichtsschreibung, die Vergangenheit als transformative Kraft für die Gegenwart begreift
- Abgrenzung von einem Fortschrittsbegriff, der die Menschheit zu einem fortschreitenden Ideal führen soll
- Analyse der Rolle theologischer Motive in Benjamins Geschichtsschreibung und deren Funktion für die Entwicklung einer kritischen Historiographie
- Die Bedeutung des Eingedenkens und der Dialektik im Stillstand für eine neue Sichtweise auf Geschichte
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel der Arbeit legt die Grundlage für die Analyse von Benjamins Geschichtsphilosophie. Es stellt die zentralen Punkte seiner Thesen dar und beleuchtet die Entstehungsgeschichte seiner Arbeit im Kontext der weltgeschichtlichen Lage im Jahr 1940.
Das zweite Kapitel beschäftigt sich mit Benjamins Abgrenzung vom konservativen Historismus. Es analysiert die Kritik an der Vorstellung von Geschichte als abgeschlossenen Ereignissen und zeigt auf, wie Benjamins materialistische Geschichtsschreibung eine alternative Perspektive auf die Vergangenheit eröffnet. Hierbei werden Konzepte wie Eingedenken, Zitat und Dialektik im Stillstand erläutert.
Das dritte Kapitel widmet sich Benjamins Kritik am Fortschrittsoptimismus seiner Zeit. Es setzt sich mit Marx' Kritik am Gothaer Programm und Schmidts Marxrezeption auseinander, um Benjamins eigenständige Position in Abgrenzung zu einer marxistisch-utopischen Position herauszuarbeiten.
Das vierte Kapitel untersucht die Rolle theologischer Motive in Benjamins Geschichtsphilosophie. Es analysiert, wie Benjamin sich theologischer Figuren und Konzepte bedient, um eine kritische Historiographie und revolutionäre Praktik zu denken.
Schlüsselwörter
Walter Benjamin, Materialistische Geschichtsschreibung, Konservativer Historismus, Fortschrittsoptimismus, Eingedenken, Dialektik im Stillstand, Theologie, Messianismus, Kritische Historiographie.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Kernkonzept von Walter Benjamins materialistischer Geschichtsschreibung?
Es ist ein Gegenentwurf zum konservativen Historismus, der die Vergangenheit nicht als abgeschlossen, sondern als transformative Kraft für die Gegenwart begreift.
Warum nutzt Benjamin theologische Konzepte für eine marxistische Theorie?
Benjamin nutzt theologische Motive wie den Messianismus, um eine kritische Historiographie und revolutionäre Praktik zu denken, die über rein ökonomischen Materialismus hinausgeht.
Was versteht Benjamin unter "Eingedenken"?
Eingedenken ist ein Mittel der Geschichtsschreibung, das die unerfüllten Hoffnungen der Vergangenheit in die Gegenwart rettet und so eine revolutionäre Unterbrechung ermöglicht.
Was kritisiert Benjamin am Fortschrittsoptimismus?
Er lehnt die Vorstellung ab, dass sich die Menschheit automatisch auf ein idealisiertes Ziel zubewegt, da dies die Katastrophen der Geschichte ignoriert.
Welche Rolle spielt die "Dialektik im Stillstand"?
Dieses Konzept beschreibt einen Moment der innegehaltenen Zeit, in dem die geschichtliche Konstellation schlagartig erkennbar wird und Veränderung möglich macht.
- Quote paper
- Lukas Treiber (Author), 2020, Das Projekt einer materialistischen Geschichtsschreibung in Walter Benjamins geschichtsphilosophischen Thesen. Warum der Rekurs auf theologische Konzepte?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/931781