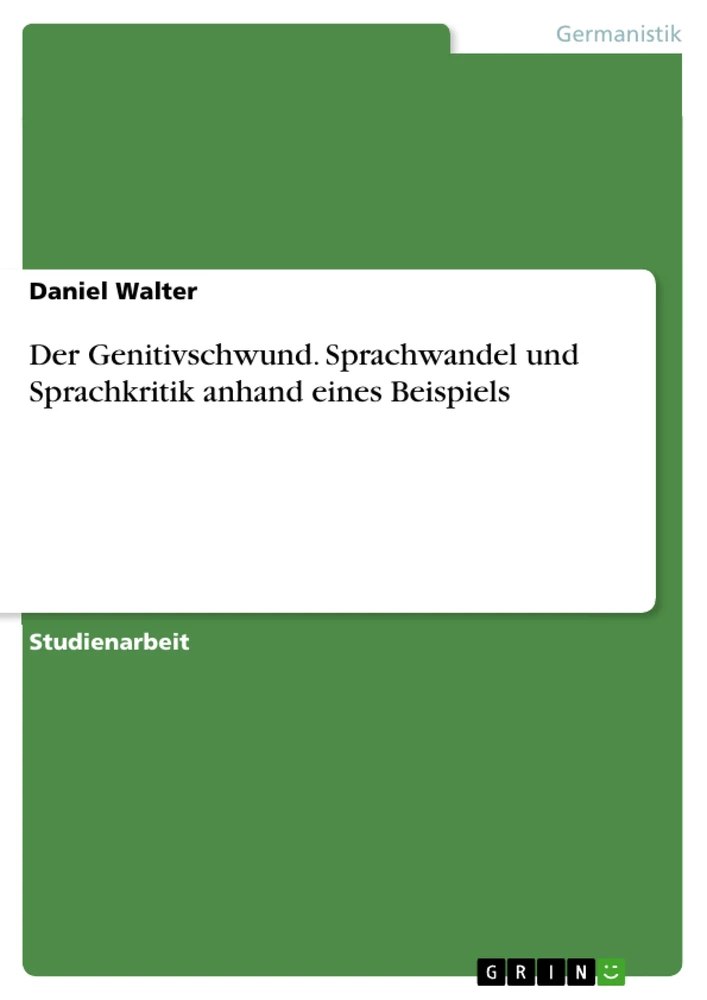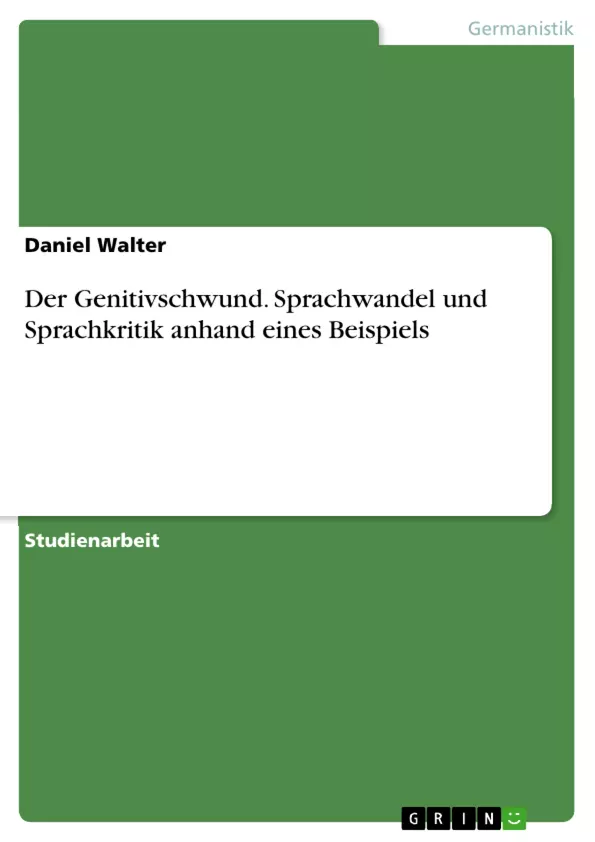Offenkundig bietet Sprachwandel viele Anhaltspunkte für sowohl positive als auch negative Sprachkritik. Ergo stehen Sprachwandel und Sprachkritik immer in Verbindung. Anhand des Beispiels des Genitivs, der scheinbar vom Dativ ersetzt wird, lässt wird in dieser Arbeit veranschaulicht, was man unter Sprachwandel im Allgemeinen versteht, wie Sprachkritik damit korreliert, welche Ansichten der Autor Bastian Sick in dieser Hinsicht vertritt und was an diesen zu kritisieren ist.
"Früher war alles besser", sagen ältere Menschen gern. Wie auch immer man die Vergangenheit bewertet, sicher ist: Früher war einiges anders." Was in diesem Zusammenhang für die Gesellschaft, den Lebensstil der Menschen, Politik oder auch Medizin gilt, gilt ebenso für die Sprache. Sowohl in geschriebener, aber auch in gesprochener Form unterscheidet sich unsere heutige Sprache grundlegend von früheren Varianten. Sprachwandel ist ein Phänomen, welches sich seit Beginn der Sprachbeobachtung fortlaufend wahrnehmen lässt.
Die Gründe dafür sind vielseitig: Während in den älteren Formen der deutschen Sprache die Lautverschiebungen eine Rolle spielten, sind es heutzutage Vorgänge wie die Globalisierung und die Digitalisierung, die zu maßgeblichen Veränderungen unserer Art des Sprechens und des Schreibens beitragen. Ein prägnantes Beispiel für den Sprachwandel ist der Wechsel vom Gebrauch des Genitivs zum Dativ. Damit befasst sich auch Bastian Sick, welcher dieses Phänomen und die Ausmaße dieses Wandels in seinem Buch "Der Dativ ist dem Genitiv sein Tod" auf humorvolle Art und Weise vorstellt und erklärt.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Hauptteil
- 2.1 Was versteht man unter Sprachwandel?
- 2.2 Was versteht man unter Sprachkritik?
- 2.3 Das Phänomen des Genitivschwunds
- 2.4 Kritik an Sick
- 2.4.1 Kritik an Sicks Meinung zum Genitivschwund
- 2.4.2 Kritik an Sicks Meinung zu Anglizismen und „making sense“
- 3 Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit dem Phänomen des Sprachwandels am Beispiel des Genitivschwunds. Sie beleuchtet die verschiedenen Aspekte des Sprachwandels und wie er von Sprachkritikern beurteilt wird, wobei Bastian Sicks Buch „Der Dativ ist dem Genitiv sein Tod“ als zentrale Quelle dient.
- Definition und Ursachen von Sprachwandel
- Sprachkritik und ihre Rolle im Sprachwandelprozess
- Der Genitivschwund als Beispiel für Sprachwandel
- Sicks Ansichten zum Genitivschwund und Kritik an seiner Argumentation
- Die Beziehung zwischen Sprachwandel und Sprachkritik
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung
Die Einleitung stellt den Sprachwandel als ein konstantes Phänomen dar, das sich durch die Geschichte der Sprache zieht. Sie beleuchtet die unterschiedlichen Ursachen für Sprachwandel, von Lautverschiebungen bis hin zu Globalisierung und Digitalisierung. Als Beispiel wird der Genitivschwund vorgestellt und die Rolle von Bastian Sicks Buch „Der Dativ ist dem Genitiv sein Tod“ im Kontext der Sprachkritik hervorgehoben.
2 Hauptteil
2.1 Was versteht man unter Sprachwandel?
Dieser Abschnitt definiert den Begriff „Sprachwandel“ und erläutert seine verschiedenen Ursachen und Ausprägungen.
2.2 Was versteht man unter Sprachkritik?
Dieser Abschnitt befasst sich mit der Definition und den verschiedenen Formen der Sprachkritik. Er beleuchtet die Rolle der Sprachkritik im Sprachwandelprozess.
2.3 Das Phänomen des Genitivschwunds
Hier wird der Genitivschwund als ein konkretes Beispiel für Sprachwandel näher beleuchtet.
2.4 Kritik an Sick
Dieser Abschnitt analysiert die Kritik an Bastian Sicks Buch „Der Dativ ist dem Genitiv sein Tod“. Er konzentriert sich auf die Kritik an Sicks Meinung zum Genitivschwund und zu Anglizismen.
Schlüsselwörter
Sprachwandel, Sprachkritik, Genitivschwund, Bastian Sick, „Der Dativ ist dem Genitiv sein Tod“, Anglizismen, Sprachbewusstsein.
- Citar trabajo
- Daniel Walter (Autor), 2018, Der Genitivschwund. Sprachwandel und Sprachkritik anhand eines Beispiels, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/931901