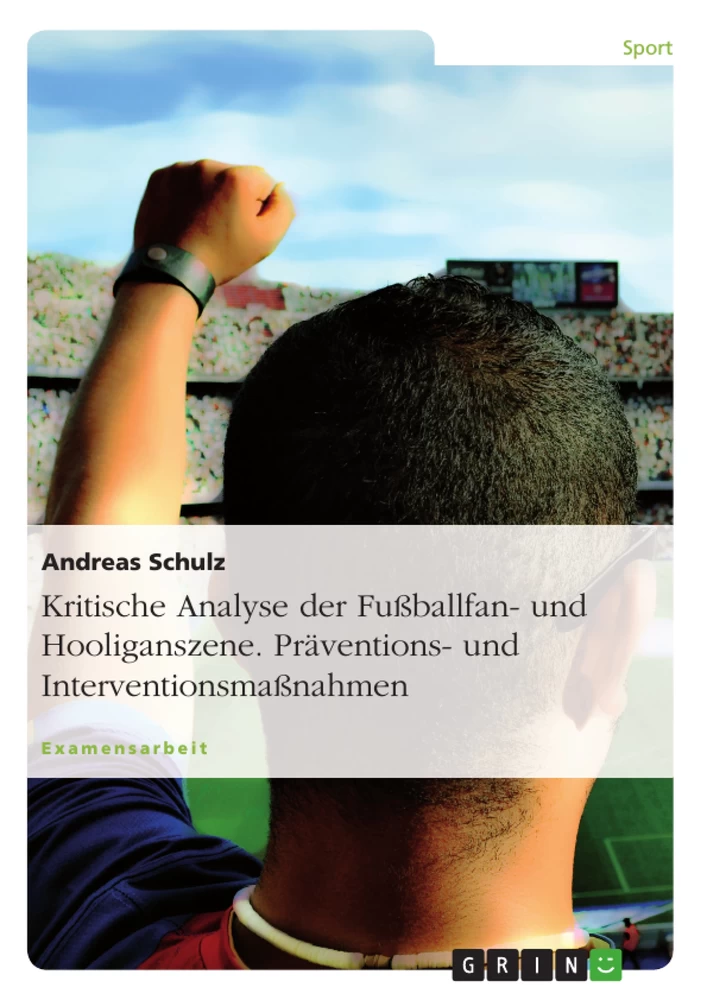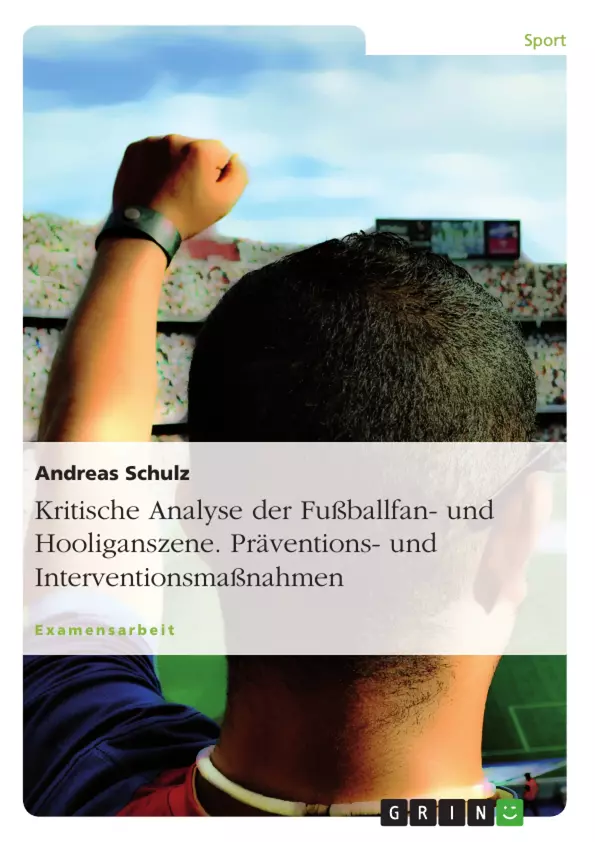1998 erschütterte der „Fall Nivel“ die ganze Welt, Deutschland im Besonderen. Am Rande des Fußballspiels Deutschland – Jugoslawien während der Fußball-Weltmeisterschaft in Frankreich wurde der französische Gendarm Daniel Nivel von deutschen Hooligans misshandelt. Die Bilder des am Boden liegenden und blutüberströmten, leblosen Familienvaters waren tagelang in den Zeitungen und Nachrichten zu sehen. Nivel lag nach dem Übergriff sechs Wochen lang im Koma und leidet bis heute an dessen Folgen. Er kann nur mühsam sprechen und wird nie wieder einen Beruf ausüben können.
Dieser Fall von aggressiven Verhaltensweisen ist jedoch eher aus jüngerer Zeit bekannt, während zuvor vielmehr die Heysel-Tragödie mit dem Thema Hooligans in Verbindung gebracht wurde, bei der im Mai 1985 während des Spiels FC Liverpool – Juventus Turin durch Hooliganausschreitungen 39 Menschen getötet und 454 Menschen verletzt worden sind.
Seit der Heysel-Tragödie werden Gewaltprobleme durch Fußballanhänger in der Öffentlichkeit behandelt, doch schon lange zuvor gab es in Großbritannien am Rande von Fußballspielen gewalttätige Auseinandersetzungen von Fußballfans; zu Beginn der siebziger Jahre häuften sich diese Fälle auch in deutschen Stadien.
Problematisch sind jedoch nicht nur Extremfälle wie die Heysel-Tragödie oder der Fall Nivel, die weltweit in den Medien Beachtung finden, sondern auch die „alltäglichen“ Auseinandersetzungen in Deutschlands Amateurligen. Am 28.10.2007 mussten 1.300 Polizisten für das Landesligaspiel zwischen Dynamo Dresden II und dem 1.FC Lok Leipzig abgestellt werden. Dennoch kam es in Stadionnähe zu großen Konflikten der gegnerischen Hooligangruppen – 240 Randalierer mussten festgenommen werden; 10 Menschen wurden verletzt. In Folge dessen muss man sich fragen, ob es weiterhin sinnvoll ist, Fanprojekte mit Steuergeldern zu unterstützen oder aber polizeiliche Maßnahmen verstärkt angewendet werden sollten.
Abgesehen von der Frage auf die Art und Weise der Bekämpfung dieser Auseinandersetzungen skizziert dieser jüngste Fall einen Trend im deutschen Fußball: Randale findet nicht mehr am Rande von stark überwachten Bundesligaspielen statt, da sich diese Auseinandersetzungen im vergangenen Jahrzehnt auf die deutschen Amateurligen verschoben haben, in denen Überwachung durch Kameras und Polizisten stark eingeschränkt ist.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Aufbau der Arbeit
- Teil I: Theoretischer Hintergrund
- 1 Definitionen verschiedener Fantypen
- 1.1 Erläuterung des Begriffs „Fußballfan“
- 1.2 Der „Kuttenfan“
- 1.3 Der „unauffällige Zuschauer“
- 1.4 Die „Supporter“
- 1.5 Die „Ultras“
- 1.6 Der „Hooligan“
- 1.7 Die „Hooltras“
- 2 Erklärungsansätze zur Zuschauergewalt
- 2.1 Vorstellung der Aggressionstheorien
- 2.1.1 Trieb- und instinkttheoretische Ansätze
- 2.1.2 Erklärungswert triebtheoretischer Ansätze
- 2.1.3 Die Frustrations-Aggressions-Theorie
- 2.1.4 Erklärungswert der Frustrations-Aggressions-Theorie
- 2.1.5 Lerntheoretische Konzepte
- 2.1.6 Erklärungswert Lerntheoretischer Konzepte
- 2.1.7 Multikausales Aggressionsmodell
- 2.1.8 Erklärungswert multikausaler Erklärungsmodelle
- 2.2 Die Bedeutung des Alkohols
- 3 Ursache der Hooligangewalt
- 3.1 Hooligans als Verlierer der Modernisierungsphase
- 3.2 Der „Kick“
- 4 Zwischenfazit
- Teil II: Die Entwicklung der gewalttätigen Fußballfanszene und polizeitaktische Veränderungen
- 1 Die Ultraszene in Deutschland
- 1.1 Die Ausdifferenzierung der Ultraszene
- 1.2 Das Selbstverständnis der Ultras
- 1.3 Abkehr von der Gewaltlosigkeit
- 1.4 Rassismus in der Ultraszene
- 2 Hooliganismus in Deutschland
- 2.1 Die Entwicklung in den siebziger Jahren
- 2.2 Erste Polizeitaktische Veränderungen
- 2.3 Hooliganismus in den achtziger Jahren
- 2.3.1 Rechtsradikalismus in den achtziger Jahren
- 2.3.2 Das Bekenntnis zur Gewalt in den achtziger Jahren
- 2.3.3 Fallbeispiel: Europameisterschaft in Frankreich 1984
- 2.3.4 Fallbeispiel: Weltmeisterschaft in Italien 1990
- 2.4 Hooliganismus in der DDR
- 2.4.1 Veränderung des Hooliganismus seit der Wende
- 2.4.2 Veränderungen der Polizeitaktik in den neunziger Jahren
- 2.4.2.1 Zentrale Informationsstelle Sporteinsätze
- 2.4.2.2 Einsatz Szenekundiger Beamter
- 2.4.2.3 Stadionverbote und Hooligandatei
- 2.5 Veränderungen der Szene seit Mitte der neunziger Jahre
- 3 Rassismus innerhalb der Hooligangruppierungen
- 4 Gewalt durch Frauen im Fußball
- 5 Aktuelle Statistik zum Gewaltpotenzial
- 5.1 Störerlage
- 5.2 Sicherheitslage
- 5.3 12-Jahres-Übersicht
- 5.4 Spiele der deutschen Mannschaften im Ausland
- 6 Auseinandersetzungen während der Weltmeisterschaft 2006 in Deutschland
- 7 Hooligans im europäischen Vergleich
- 7.1 Hooliganismus in England
- 7.2 Hooliganismus in Italien und Frankreich
- 7.3 Hooliganismus in den Niederlanden
- 7.4 Hooliganismus in der Schweiz
- 7.5 Hooliganismus in Osteuropa
- 8 Zwischenfazit
- Teil III: Aktuelle Präventions- und Interventionsmaßnahmen zur Bekämpfung der Gewalt durch Fußballfans
- 1 FARE - Football Against Racism in Europe
- 2 Nationales Konzept Sport und Sicherheit
- 2.1 Einrichtung von Fanprojekten auf örtlicher Ebene
- 2.2 Koordinationsstelle Fanprojekte
- 2.3 Maßnahmenkatalog gegen Gewalt in Fußballstadien
- 2.3.1 Stadionverbote
- 2.3.2 Zweck von Stadionverboten
- 2.3.3 Ordnerdienste
- 2.3.4 Musterstadionordnung
- 2.3.5 Stadionsicherheit
- 2.3.5.1 Umfriedung
- 2.3.5.2 Verkehr
- 2.3.5.3 Zuschauerbereiche
- 2.4 Zusammenarbeit auf (über-) örtlicher Ebene
- 2.5 Bewertung der vorgestellten Maßnahmen
- 2.5.1 Kritische Bewertung der Maßnahmen des NKSS
- 2.5.2 Beurteilung des Stadionverbots durch die KOS
- 3 Fanprojekte
- 3.1 Einführung der Fanprojekte
- 3.2 Die Selbstbegründung der Fanprojekte
- 3.2.1 Zielsetzung der Fanprojekte
- 3.2.2 Erfolge der Fanprojekte
- 4 Interviews mit den Fanprojekten
- 4.1 Fanbeauftragter des VfL Osnabrück
- 4.2 Präventionsmaßnahmen des VfL Osnabrück
- 4.3 Interview mit dem Fanprojekt in Hannover
- 4.4 Fanprojektarbeit in Hannover
- 4.5 Interview mit dem Fanprojekt des DSC Arminia Bielefeld
- 4.6 Angebote des Fanprojekts in Bielefeld
- 4.7 Interview mit dem Fanprojekt in Dresden
- 4.8 Angebote des Fanprojekts in Dresden
- 4.9 Bewertung der Maßnahmen der Fanprojekte
- 5 Fazit
- Definition verschiedener Fantypen und Abgrenzung von Hooligans
- Erklärungsansätze für Zuschauergewalt, insbesondere Aggressionstheorien
- Entwicklung der Hooliganszene in Deutschland, insbesondere in den 70er, 80er und 90er Jahren
- Polizeitaktische Veränderungen im Umgang mit Hooligans
- Aktuelle Präventions- und Interventionsmaßnahmen zur Bekämpfung von Gewalt durch Fußballfans
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit befasst sich mit der kritischen Analyse der Fußballfan- und Hooligan-Szene unter besonderer Berücksichtigung von Präventions- und Interventionsmaßnahmen. Ziel ist es, die Entwicklung der Szene, die Ursachen von Gewalt und die Wirksamkeit verschiedener Maßnahmen zu untersuchen.
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik der Fußballfan- und Hooligan-Szene ein und skizziert den Aufbau der Arbeit. Teil I behandelt den theoretischen Hintergrund, indem verschiedene Fantypen definiert und Aggressionstheorien vorgestellt werden. Des Weiteren werden die Ursachen für Hooligangewalt beleuchtet.
Teil II widmet sich der Entwicklung der gewalttätigen Fußballfanszene in Deutschland und den damit verbundenen polizeitaktischen Veränderungen. Die Ultraszene, der Hooliganismus in den 70er, 80er und 90er Jahren sowie die Entwicklung in der DDR werden näher betrachtet.
Teil III präsentiert aktuelle Präventions- und Interventionsmaßnahmen zur Bekämpfung der Gewalt durch Fußballfans. Das Nationale Konzept Sport und Sicherheit, Fanprojekte sowie Interviews mit Fanprojekten werden ausführlich analysiert.
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselwörter sind: Fußballfan, Hooligan, Ultraszene, Aggressionstheorien, Gewalt, Prävention, Intervention, Fanprojekte, Stadionverbote, polizeitaktische Veränderungen, Rassismus.
- Arbeit zitieren
- Andreas Schulz (Autor:in), 2007, Kritische Analyse der Fußballfan- und Hooliganszene. Präventions- und Interventionsmaßnahmen, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/93204