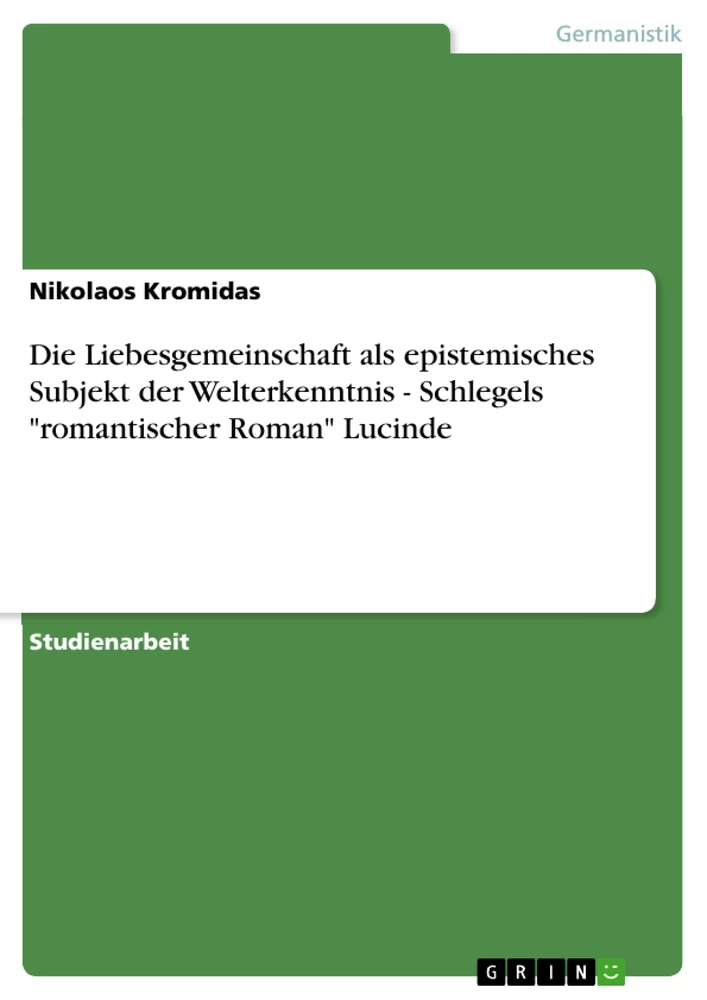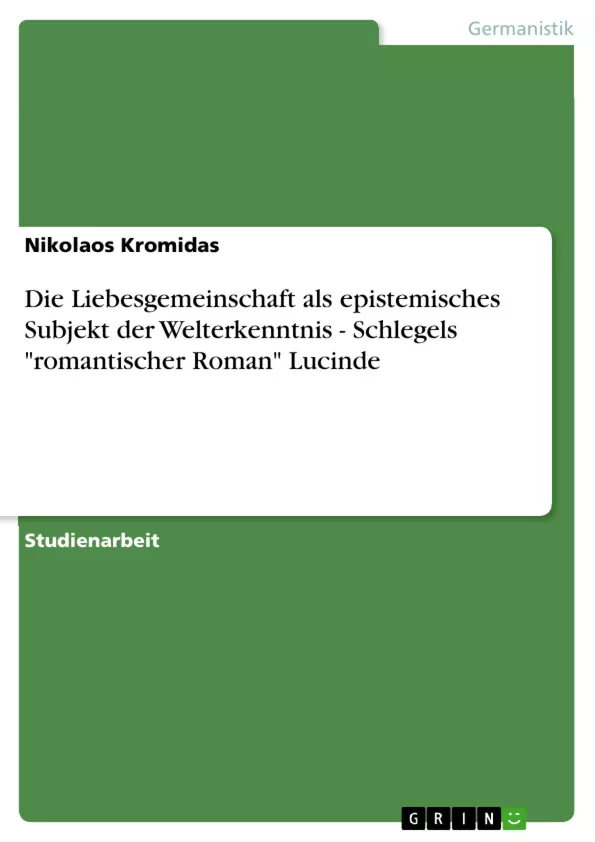Ich stellte mir zu Beginn meiner Arbeit die Frage, wie Friedrich Schlegel zu einer Interpretation der Lucinde stünde, welche Ansprüche er an eine solche erheben würde. Ich kam zu dem Ergebnis, dass die Interpretation eines „romantischen Romans“ – in Einklang mit der transzendentalpoetischen Auffassung – selbst romantisch sein müsste, um dem idealistischen Realismus eines romantischen Werks gerecht zu werden und zwar indem es die vorliegende Schrift und Lucinde als Gesamtheit einer Erkenntnishandlung „Interpretation“ begreift. Andererseits sollte eine Interpretation literaturwissenschaftlichen Kriterien der wissenschaftlichen Systematik eindeutiger Aussagen genügen und nicht eine mehrdeutige Verwirrung derselben sein. Hier kollidieren literaturwissenschaftliche Betonung der differenzierenden „Philosophie“ und der romantische Anspruch an eine dichte „Poesie“ und stellen jede Interpretation mit einem totalitären Anspruch vor ein unausweichliches Dilemma.
Ich habe mich – in großen Teilen Manfred Engels Arbeit folgend – für eine graduelle Lösung einer strukturparallelen (homomorphen) An-Deutung entschieden, als einem systematischen Gedankenfundament einer freien, romantischen, gleichartigen (iso-morphen) Deutung. Die Deutung selbst als romantisch-idealistisches Gedankengebäude muss sich im Mitdenkenden herausbilden. Die vorgestellte Interpretation ist hiernach keine Erkenntnishandlung an sich – daher unromantisch – aber sie versucht den Weg einer Erkenntnishandlung durch Andeutung des „Bandes der Ideen“ nachzuvollziehen. Das Band der Ideen findet seinen klarsten Asudruck in der Liebesgemeinschaft als epistemischem Subjekt der Welterkenntnis: die Liebesbezihung des Paares in der Lucinde, die Beziehung des Rezipienten zum Author oder der des Leseres dieser Arbeit zur Interpretation. Erst durch die wechselseitige Beziehung entsteht der totalitäre Geist, welcher ganzheitlich erkennt.
Inhaltsverzeichnis
- Die Problemstellung der Interpretation eines „,romantischen Romans”
- Was charakterisiert den „,romantischen Roman”?
- Theoretische Grundlagen der Literaturproduktion nach Schlegel
- Fichtes Wissenschaftstheorie
- Wilhelm Meisters Lehrjahre
- Die französische Revolution
- Praktische bzw. ästhetische Grundlagen der Literaturproduktion nach Schlegel
- Die romantische Verwirrung
- Der sentimentale Stoff
- Der historische Stoff
- Die progressive Universalpoesie
- Die Transzendentalpeosie
- Die Neue Mythologie
- Die romantische Ironie
- Lucindes Gestalt als „,romantisches Buch”
- Der formale Aufbau
- Die inhaltliche Struktur
- Die vier thematischen Ebenen
- Die Ebene der organischen Bildung
- Die Ebene der Liebe
- Die Ebene der Kunst
- Die Ebene der Religion und Mythologie
- Die drei Bauprinzipien
- Das Bauprinzip „Organismus”
- Das Bauprinzip „Potenzierung”
- Das Bauprinzip „intensiver => extensiver Totalität”
- Lucindes Inhalt als transzendentale Geschichte eines Bildungsprozesses
- Die Detailanalyse des Prologs
- Erster Absatz
- Zweiter Absatz
- Dritter Absatz
- Vierter Absatz
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit der Interpretation von Friedrich Schlegels "Lucinde" und versucht, die Ansprüche zu beleuchten, die Schlegel an eine solche Interpretation stellen würde. Die Arbeit untersucht die theoretischen Grundlagen der Literaturproduktion nach Schlegel, insbesondere im Kontext von Fichtes Wissenschaftstheorie, Goethes "Wilhelm Meisters Lehrjahre" und der französischen Revolution.
- Die Interpretation eines "romantischen Romans"
- Theoretische Grundlagen der "romantischen" Literaturproduktion
- Die ästhetische Bedeutung von "Lucinde" als "romantisches Buch"
- Die transzendentale Geschichte des Bildungsprozesses in "Lucinde"
- Die Detailanalyse des Prologs von "Lucinde"
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel stellt die Problemstellung der Interpretation von "Lucinde" in den Kontext der "romantischen" Literaturproduktion und die Ansprüche, die Schlegel an eine solche Interpretation stellen würde. Das zweite Kapitel untersucht die theoretischen und praktischen Grundlagen der Literaturproduktion nach Schlegel, indem es Fichtes Wissenschaftstheorie, "Wilhelm Meisters Lehrjahre", die französische Revolution sowie wichtige Elemente wie die "romantische Verwirrung", den "sentimentalen Stoff", den "historischen Stoff", die "progressive Universalpoesie", die "Transzendentalpoesie", die "Neue Mythologie" und die "romantische Ironie" analysiert. Das dritte Kapitel beleuchtet die Gestalt von "Lucinde" als "romantisches Buch", untersucht seinen formalen Aufbau und seine inhaltliche Struktur sowie die vier thematischen Ebenen (Bildung, Liebe, Kunst, Religion und Mythologie) und die drei Bauprinzipien ("Organismus", "Potenzierung", "intensive => extensive Totalität"). Das vierte Kapitel widmet sich dem Inhalt von "Lucinde" als einer transzendentalen Geschichte eines Bildungsprozesses. Schließlich analysiert das fünfte Kapitel den Prolog von "Lucinde" in vier Absätzen.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf die Interpretation von Friedrich Schlegels "Lucinde" im Kontext der "romantischen" Literaturproduktion. Wichtige Themen sind die theoretischen Grundlagen der "romantischen" Literaturproduktion nach Schlegel, insbesondere Fichtes Wissenschaftstheorie, die transzendentale Geschichte eines Bildungsprozesses in "Lucinde" und die Analyse des Prologs. Zentrale Begriffe sind "romantischer Roman", "romantische Ironie", "transzendentale Poesie", "Bildung" und "Liebe".
Häufig gestellte Fragen
Was charakterisiert Friedrich Schlegels Roman "Lucinde"?
"Lucinde" gilt als Paradebeispiel für den "romantischen Roman", der durch progressive Universalpoesie, romantische Ironie und eine komplexe inhaltliche Struktur geprägt ist.
Welche Rolle spielt die Liebesgemeinschaft in der Erkenntnistheorie?
Die Liebesbeziehung wird als epistemisches Subjekt begriffen, durch das eine ganzheitliche Welterkenntnis erst möglich wird.
Wie beeinflusste Fichte Schlegels Literaturtheorie?
Fichtes Wissenschaftslehre bildete ein wichtiges theoretisches Fundament für Schlegels Konzepte der Transzendentalpoesie und der intellektuellen Anschauung.
Was bedeutet "romantische Ironie" im Kontext von Lucinde?
Es ist das Prinzip der ständigen Selbstreflexion und des Schwebens zwischen Schöpfung und Vernichtung des Werkes durch den Autor.
Welche thematischen Ebenen werden im Roman untersucht?
Die Analyse unterscheidet vier Ebenen: organische Bildung, Liebe, Kunst sowie Religion und Mythologie.
- Citar trabajo
- Nikolaos Kromidas (Autor), 2006, Die Liebesgemeinschaft als epistemisches Subjekt der Welterkenntnis - Schlegels "romantischer Roman" Lucinde, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/93218