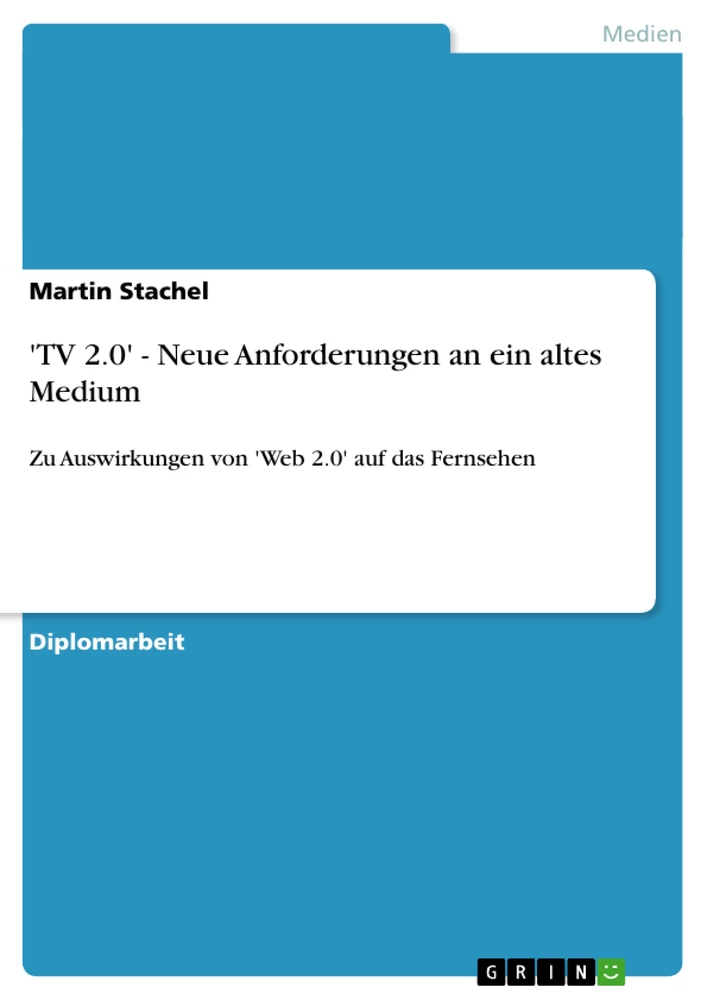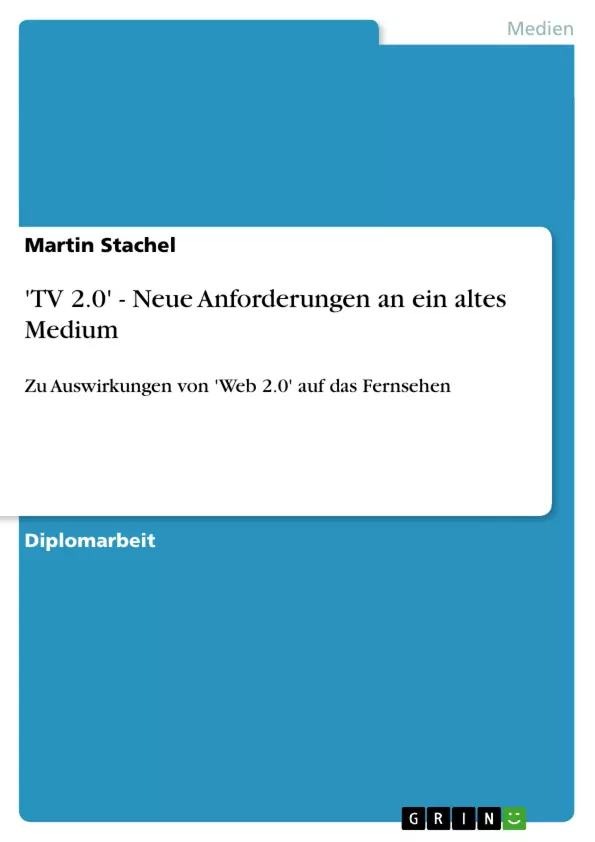Sucht man mit der Internet-Suchmaschine Google nach dem Begriff „TV“, erhält man knapp 1,6 Milliarden Ergebnisse. Andererseits erzielt die Eingabe von „Web 2.0“ auch schon weit über 730 Millionen Treffer. Und das, obwohl dem Medium Fernsehen über 70 Jahre Zeit blieben, um sich derart gesellschaftlich zu etablieren, der Begriff „Web 2.0“ aber gerade mal erst eineinhalb Jahre alt ist. Von der offensichtlich methodischen Problematik dieses Vergleichs einmal abgesehen, kann er eins jedoch äußerst wirkungsvoll veranschaulichen: den rasanten Erfolg des Begriffes und des damit zusammenhängenden Phänomens. Nahezu täglich berichten die führenden Medien dieser Welt über „Web 2.0“ und den damit zusammenhängenden Websites wie YouTube, MySpace und Co. Neben der Frage, was unter dem Begriff nun eigentlich genau zu verstehen sei, herrscht vor allem aber in der Diskussion um die Relevanz dieser vermeintlich neuen Version des Internets großer Dissens. Handelt es sich analog zur geplatzten Dotcom-Blase zur Jahrtausendwende nur um einen neuen Internet-Hype oder eventuell doch um einen fundamentalen Medienwandel?
[...]
Allzu oft nehmen jedoch futurologische Entwürfe eines Medienwandels einen viel breiteren Raum ein als die Bilanzierung des Status quo. Es fehlt in der Debatte um die Auswirkungen von „Web 2.0“ auf das Fernsehen an einer pragmatischen Herangehensweise durch die Untersuchung bisheriger Entwicklungen unter Einbezug aktueller empirischer Ergebnisse. Diese Arbeit soll daher eine Bestandsaufnahme und Analyse aktueller Konvergenzprozesse von Web 2.0 und Fernsehen liefern, wobei Konvergenz hier eher im formalen und inhaltlichen, denn im rein technologischen Sinne betrachtet wird. Die Berücksichtigung der technologischen Innovationsdynamik ist zwar unabdingbar, da sie oft erst die Voraussetzung für formale und inhaltliche Veränderungen darstellt, aber nicht primäres Ziel dieser Arbeit. Es geht also um einen systematischen Zugang an die Frage, welche Auswirkungen das Phänomen „Web 2.0“ bis zum gegenwärtigen Zeitpunkt auf das Fernsehen hatte und wie diese zu bewerten sind.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Der Uses-and-Gratifications-Ansatz als theoretischer Bezugsrahmen
- 3 Rahmenbedingungen
- 3.1 Mediatisierung
- 3.2 Virtualisierung
- 3.3 Individualisierung
- 3.4 Globalisierung
- 4 Das „Web 2.0“ und seine User
- 4.1 Definition von „Web 2.0“
- 4.1.1 Wie aus dem Internet „Web 2.0“ wurde
- 4.1.2 „Web 2.0“ – Ein neues Medium?
- 4.1.3 Phänotypen und ihre Charakteristika
- 4.1.3.1 User Generated Content-Applikationen
- 4.1.3.1.1 Weblogs
- 4.1.3.1.2 Podcasts
- 4.1.3.1.3 Foto-Plattformen
- 4.1.3.1.4 Video-Plattformen
- 4.1.3.1.5 Personalisiertes Internetradio
- 4.1.3.2 Social Software
- 4.1.3.2.1 Wikis
- 4.1.3.2.2 Social Networking-Plattformen
- 4.1.3.3 Virtuelle Welten
- 4.1.3.1 User Generated Content-Applikationen
- 4.2 Nutzung des „Web 2.0“
- 4.1 Definition von „Web 2.0“
- 5 Das Fernsehen und seine Zuschauer
- 5.1 Evolution des Mediums Fernsehen
- 5.1.1 Vervielfachung von Programm
- 5.1.2 Verschiebung von Broadcasting zu Narrowcasting
- 5.1.3 Emanzipation des Fernsehens
- 5.1.4 Interaktives Fernsehen
- 5.2 Nutzung des Fernsehens
- 5.1 Evolution des Mediums Fernsehen
- 6 „TV 2.0“ - Neue Anforderungen an ein altes Medium?
- 6.1 „Web 2.0“ als funktionale Alternative zum Fernsehen?
- 6.1.1 Funktion: Information
- 6.1.2 Funktion: Unterhaltung
- 6.1.3 Funktionen: Entspannung, Eskapismus und Zeitvertreib
- 6.1.4 Zusammenfassung
- 6.2 Wie reagiert das Fernsehen auf „Web 2.0“?
- 6.2.1 Reaktionsschema 1: Konfrontation
- 6.2.2 Reaktionsschema 2: Instrumentalisierung
- 6.2.3 Reaktionsschema 3: Integration und Adaption
- 6.2.4 Zusammenfassung
- 6.1 „Web 2.0“ als funktionale Alternative zum Fernsehen?
- 7 Zusammenfassung, Diskussion und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht die Auswirkungen von „Web 2.0“ auf das Fernsehen. Sie analysiert, wie „Web 2.0“-Anwendungen das Fernseherlebnis verändern und wie das Fernsehen auf diese neuen Herausforderungen reagiert.
- Definition und Charakteristika von „Web 2.0“
- Nutzung von „Web 2.0“ und Fernsehen
- Funktionale Überschneidungen von „Web 2.0“ und Fernsehen
- Reaktionen des Fernsehens auf „Web 2.0“
- Zukünftige Entwicklungen des Fernsehens im Kontext von „Web 2.0“
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1: Einleitung
- Kapitel 2: Der Uses-and-Gratifications-Ansatz als theoretischer Bezugsrahmen
- Kapitel 3: Rahmenbedingungen
- Kapitel 3.1: Mediatisierung
- Kapitel 3.2: Virtualisierung
- Kapitel 3.3: Individualisierung
- Kapitel 3.4: Globalisierung
- Kapitel 4: Das „Web 2.0“ und seine User
- Kapitel 4.1: Definition von „Web 2.0“
- Kapitel 4.1.1: Wie aus dem Internet „Web 2.0“ wurde
- Kapitel 4.1.2: „Web 2.0“ – Ein neues Medium?
- Kapitel 4.1.3: Phänotypen und ihre Charakteristika
- Kapitel 4.1.3.1: User Generated Content-Applikationen
- Kapitel 4.1.3.2: Social Software
- Kapitel 4.1.3.3: Virtuelle Welten
- Kapitel 4.2: Nutzung des „Web 2.0“
- Kapitel 4.1: Definition von „Web 2.0“
- Kapitel 5: Das Fernsehen und seine Zuschauer
- Kapitel 5.1: Evolution des Mediums Fernsehen
- Kapitel 5.2: Nutzung des Fernsehens
- Kapitel 6: „TV 2.0“ - Neue Anforderungen an ein altes Medium?
- Kapitel 6.1: „Web 2.0“ als funktionale Alternative zum Fernsehen?
- Kapitel 6.1.1: Funktion: Information
- Kapitel 6.1.2: Funktion: Unterhaltung
- Kapitel 6.1.3: Funktionen: Entspannung, Eskapismus und Zeitvertreib
- Kapitel 6.2: Wie reagiert das Fernsehen auf „Web 2.0“?
- Kapitel 6.1: „Web 2.0“ als funktionale Alternative zum Fernsehen?
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit den Begriffen „Web 2.0“, „TV 2.0“, „User Generated Content“, „Social Software“, „Interaktivität“, „Mediatisierung“, „Virtualisierung“, „Individualisierung“, „Globalisierung“ und „Uses-and-Gratifications-Ansatz“. Die Arbeit untersucht die Auswirkungen dieser Entwicklungen auf das Fernsehen und die Fernsehnutzung.
Häufig gestellte Fragen
Was bedeutet der Begriff „TV 2.0“?
TV 2.0 beschreibt die Konvergenz von klassischem Fernsehen und den interaktiven Möglichkeiten des Web 2.0, wie User Generated Content und soziale Vernetzung.
Welche Web 2.0 Phänotypen beeinflussen das Medium Fernsehen?
Dazu gehören Video-Plattformen (wie YouTube), Weblogs, Podcasts, Social Networking-Plattformen und Wikis.
Ist das Web 2.0 eine funktionale Alternative zum Fernsehen?
Die Arbeit untersucht dies anhand der Funktionen Information, Unterhaltung sowie Entspannung und Eskapismus.
Wie reagieren Fernsehanstalten auf die Konkurrenz durch das Internet?
Es gibt drei typische Reaktionsschemata: Konfrontation, Instrumentalisierung sowie die Integration und Adaption von Web-Inhalten.
Was ist der „Uses-and-Gratifications-Ansatz“?
Dieser theoretische Rahmen erklärt, warum Nutzer bestimmte Medien wählen, um spezifische Bedürfnisse und Belohnungen (Gratifikationen) zu erhalten.
Welche gesellschaftlichen Rahmenbedingungen fördern den Medienwandel?
Zentrale Faktoren sind die Mediatisierung, Virtualisierung, Individualisierung und Globalisierung unserer Gesellschaft.
- Quote paper
- Diplom-Medienwirt Martin Stachel (Author), 2007, 'TV 2.0'. Neue Anforderungen an ein altes Medium, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/93232