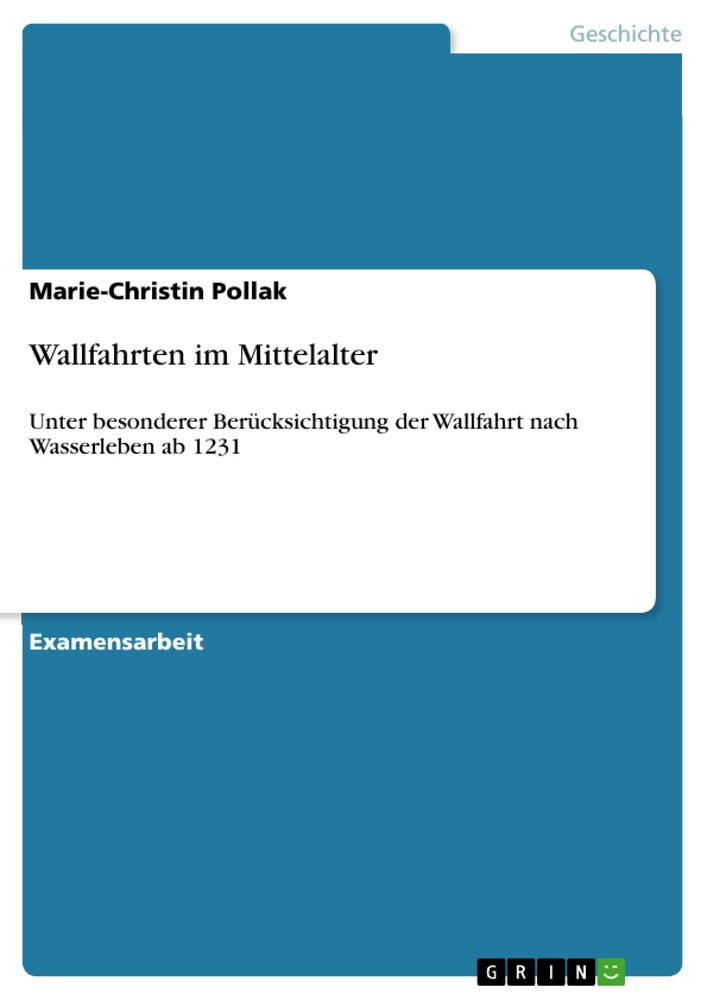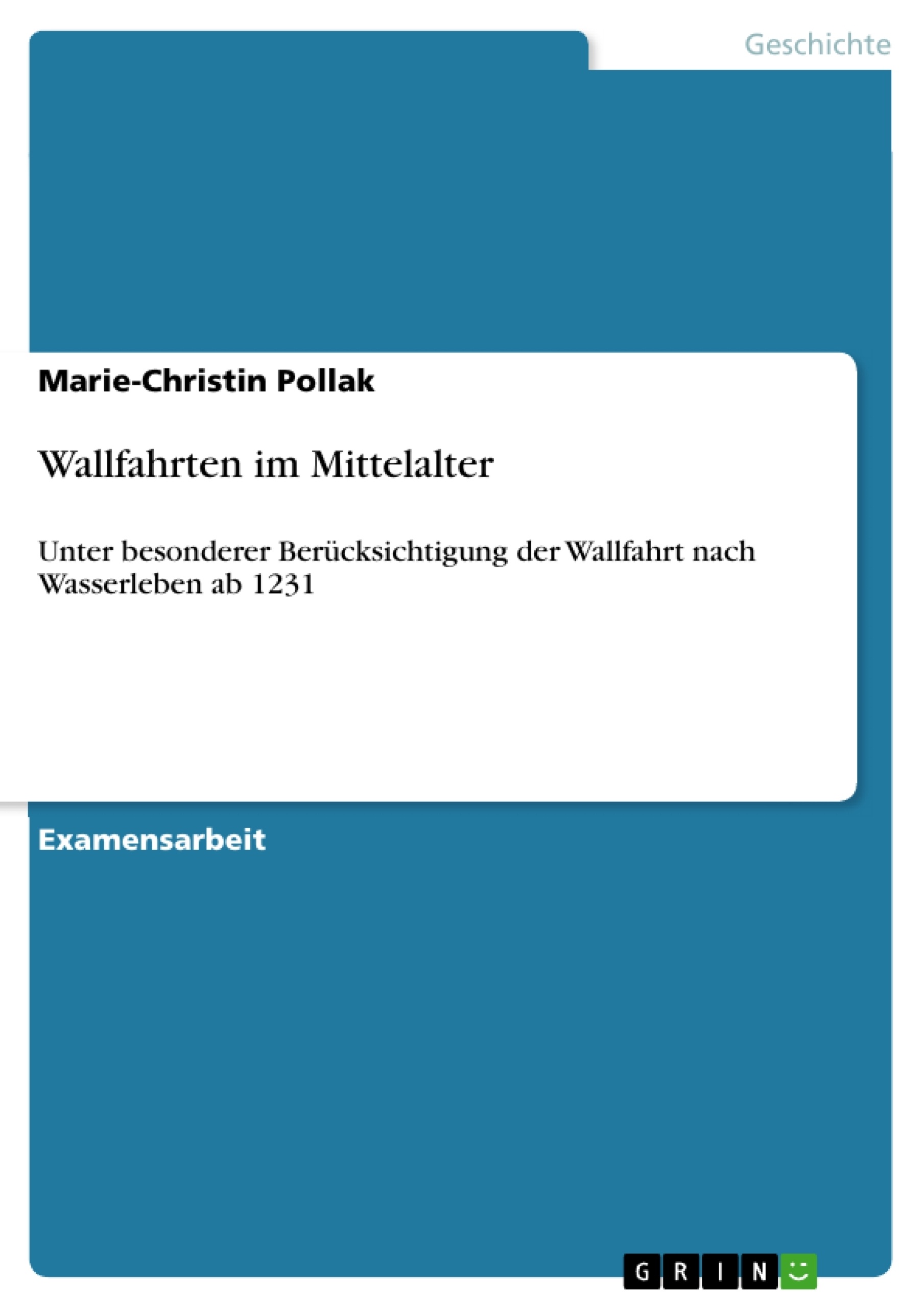Heute gehört für die meisten Menschen das Reisen selbstverständlich zum Leben dazu. Wahrscheinlich kann sich gegenwärtig kaum jemand vorstellen, dass die Menschen des so genannten ‚dunklen Mittelalters’ zu tausenden unterwegs waren. Sie reisten jedoch in den seltensten Fällen aus Vergnügen. Sie verließen ihr Zuhause um zum Beispiel die heiligen Stätten ihrer Zeit aus dem einen oder anderen Grund aufzusuchen. Sie gingen auf Wallfahrt. Diese Form des Reisens ist zwar kein spezifisches Phänomen des Mittelalters, doch zu dieser Zeit erfuhr es eine Hochzeit und es bildeten sich Praktiken, Verhaltensweisen und Prinzipien aus, die heute als typisch für das gesamte Mittelalter gelten.
In dieser Arbeit werden verschiedene Aspekte der mittelalterlichen Wallfahrt besprochen. Manche Themen können auf Grund ihrer Komplexität oder ihres Umfangs allerdings nur überblicksweise dargestellt werden. Die Wallfahrtskritik zum Beispiel wird genau aus diesen Gründen nur punktuell eingefügt.
Besondere Aufmerksamkeit wird im Folgenden den Motiven und Gründen für das Pilgern und somit gleichzeitig den unterschiedlichen Arten von Wallfahrten geschenkt, denn es erscheint mir von Bedeutung zu klären, warum sich so viele Menschen des Mittelalters auf lange und gefährliche Reisen begaben ohne zu wissen, ob sich ihre Anliegen erfüllen würden und ob sie jemals ihre Heimat wieder erreichen würden. Allerdings merkt Norbert Ohler zu diesem Thema an, „dass [g]emessen an der Zahl der Pilger […] in den Quellen eher selten davon die Rede [ist], was die Wallfahrer veranlasste, sich für eine bestimmte heilige Stätte zu entscheiden und damit gegen andere“ . Trotzdem erfolgt im Kapitel ‚Motive und Gründe für eine Wallfahrt’ eine Aufstellung der in der Literatur als gängig angenommenen Beweggründe.
Des Weiteren beinhaltet diese Arbeit einen Versuch der Definition des Begriffes Wallfahrt und einen Überblick über die historische Entwicklung des Wallfahrtswesens. Neben den bereits erwähnten Motiven kommen auch die Pilger, ihre Ziele und die Pilgerreise im Allgemeinen zur Sprache. Von besonderer Bedeutung für das Wallfahrtswesen sind Ablässe und Reliquien weshalb beide Themen in eigenen Kapiteln dargelegt werden.
Die drei großen Wallfahrtsorte des Mittelalters werden nur kurz angesprochen. Als spezielles Beispiel wird zum Abschluss die Wallfahrt nach Wasserleben ab 1231 untersucht.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Wallfahrten im Mittelalter
- 2.1 Der Begriff „Wallfahrt“
- 2.2 Einführung in die Geschichte der christlichen Wallfahrt bis zum Ausgang des Mittelalters
- 2.3 Aspekte der Wallfahrt des Mittelalters
- 2.3.1 Der Pilger
- 2.3.2 Äußere Merkmale des Pilgers
- 2.3.2.1 Die Pilgerzeichen
- 2.3.3 Zeitpunkt der Pilgerreise
- 2.3.4 Die Pilgerreise
- 2.3.5 Ziele der Pilger
- 2.3.5.1 Die peregrinationes maiores im Spätmittelalter
- 2.3.6 Motive und Gründe für eine Wallfahrt
- 2.3.6.1 Überblick über Entwicklung und Gestalt des Ablasswesens
- 2.3.6.2 Reliquien und Reliquienverehrung
- 3. Die Wallfahrt nach Wasserleben ab 1231
- 3.1 Der Harz als Wallfahrtslandschaft
- 3.2 Wasserleben als Wallfahrtsort
- 3.2.1 Literatur zur Wallfahrt nach Wasserleben
- 3.2.2 Quellen zur Geschichte des Klosters Wasserleben und der Legende vom Heiligen Blut zu Wasserleben
- 3.2.3 Einführung in die Geschichte der Ortschaft Wasserleben
- 3.2.4 Die Legende des Heiligen Blutes zu Wasserleben
- 3.2.5 Das Kloster in Wasserleben
- 3.3 Fazit
- 4. Nachwort
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht verschiedene Aspekte mittelalterlicher Wallfahrten, mit besonderem Fokus auf die Motive und Gründe für das Pilgern. Sie beleuchtet die historische Entwicklung des Wallfahrtswesens, definiert den Begriff „Wallfahrt“, und betrachtet die Pilger, ihre Ziele und die Pilgerreise selbst. Ablässe und Reliquien werden als besonders wichtige Aspekte des Wallfahrtswesens behandelt. Abschließend wird die Wallfahrt nach Wasserleben ab 1231 als Fallbeispiel untersucht.
- Definition und historische Entwicklung des Begriffs „Wallfahrt“
- Motive und Gründe für mittelalterliche Wallfahrten
- Die Rolle von Ablässen und Reliquien im Wallfahrtswesen
- Charakterisierung der Pilger und ihrer Reisen
- Fallstudie: Die Wallfahrt nach Wasserleben ab 1231
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema der mittelalterlichen Wallfahrten ein und beschreibt den Kontext der Arbeit. Sie betont die Bedeutung der Motive und Gründe für das Pilgern und die Herausforderungen der Quellenlage. Die Arbeit skizziert ihren Aufbau und die Schwerpunkte der Untersuchung, wobei die Wallfahrt nach Wasserleben als spezifisches Beispiel herausgestellt wird. Die Einleitung verweist auf die komplexe und umfangreiche Forschungsliteratur zum Thema und betont die Auswahl der verwendeten Quellen.
2. Wallfahrten im Mittelalter: Dieses Kapitel bietet einen umfassenden Überblick über das Phänomen der Wallfahrt im Mittelalter. Es beginnt mit einer detaillierten Auseinandersetzung mit der Definition des Begriffs „Wallfahrt“, wobei die unterschiedlichen religiösen Interpretationen (katholisch und protestantisch) berücksichtigt werden. Anschließend wird die Geschichte der christlichen Wallfahrt bis zum Ende des Mittelalters nachgezeichnet. Der Schwerpunkt liegt auf Aspekten wie dem Pilger selbst, seinen Merkmalen (einschließlich Pilgerzeichen), dem Zeitpunkt und den Zielen der Pilgerreise, sowie den Motiven und Gründen für Wallfahrten. Besondere Aufmerksamkeit wird dabei den Themen Ablässe und Reliquienverehrung gewidmet.
3. Die Wallfahrt nach Wasserleben ab 1231: Dieses Kapitel konzentriert sich auf die Wallfahrt nach Wasserleben als ein spezifisches Beispiel für mittelalterliche Wallfahrten. Es untersucht den Harz als Wallfahrtslandschaft und beleuchtet Wasserleben als Wallfahrtsort. Die Analyse stützt sich auf vorhandene Literatur und Quellen zur Geschichte des Klosters Wasserleben und der Legende vom Heiligen Blut. Die Geschichte des Ortes selbst wird ebenso behandelt wie die Legende des Heiligen Blutes und die Bedeutung des Klosters im Kontext der Wallfahrt. Das Kapitel schließt mit einem Fazit, das die Bedeutung der Wallfahrt nach Wasserleben im größeren Kontext des mittelalterlichen Wallfahrtswesens zusammenfasst.
Schlüsselwörter
Mittelalterliche Wallfahrt, Pilger, Motive, Ablässe, Reliquien, Wasserleben, Harz, Heiliges Blut, Kloster, religiöse Mobilität, Peregrinatio.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Mittelalterliche Wallfahrten mit Fokus auf Wasserleben
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert mittelalterliche Wallfahrten, insbesondere die Motive und Gründe für das Pilgern. Sie untersucht die historische Entwicklung des Wallfahrtswesens, den Begriff „Wallfahrt“, die Pilger selbst, ihre Reiseziele und die Pilgerreise an sich. Ein besonderer Fokus liegt auf Ablässen und Reliquien sowie auf der Fallstudie der Wallfahrt nach Wasserleben ab 1231.
Welche Themen werden im Detail behandelt?
Die Arbeit behandelt die Definition und historische Entwicklung des Begriffs „Wallfahrt“, die Motive und Gründe für mittelalterliche Wallfahrten, die Rolle von Ablässen und Reliquien, die Charakterisierung der Pilger und ihrer Reisen und schließlich eine Fallstudie über die Wallfahrt nach Wasserleben ab 1231.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel über Wallfahrten im Mittelalter (einschließlich Definition, Geschichte, Pilger, Motive, Ablässe und Reliquien), ein Kapitel über die Wallfahrt nach Wasserleben ab 1231 (mit Fokus auf den Harz als Wallfahrtslandschaft, Wasserleben als Wallfahrtsort, der Legende vom Heiligen Blut und dem Kloster), und ein Nachwort. Zusätzlich enthält sie ein Inhaltsverzeichnis, eine Zusammenfassung der Kapitel und Schlüsselwörter.
Was wird in der Einleitung behandelt?
Die Einleitung führt in das Thema ein, beschreibt den Kontext der Arbeit, betont die Bedeutung der Motive und Herausforderungen der Quellenlage. Sie skizziert den Aufbau und die Schwerpunkte der Untersuchung, wobei die Wallfahrt nach Wasserleben als Beispiel hervorgehoben wird. Sie verweist auf die Forschungsliteratur und die Auswahl der verwendeten Quellen.
Was beinhaltet das Kapitel über Wallfahrten im Mittelalter?
Dieses Kapitel bietet einen umfassenden Überblick über mittelalterliche Wallfahrten. Es definiert den Begriff „Wallfahrt“, beleuchtet die Geschichte der christlichen Wallfahrt bis zum Ende des Mittelalters, untersucht Aspekte wie den Pilger, seine Merkmale (Pilgerzeichen), den Zeitpunkt und die Ziele der Reise, sowie die Motive (Ablässe und Reliquienverehrung).
Was ist der Fokus des Kapitels über die Wallfahrt nach Wasserleben?
Dieses Kapitel konzentriert sich auf die Wallfahrt nach Wasserleben als Fallbeispiel. Es untersucht den Harz als Wallfahrtslandschaft, Wasserleben als Wallfahrtsort, die relevante Literatur und Quellen (Geschichte des Klosters, Legende vom Heiligen Blut), die Geschichte des Ortes, die Legende des Heiligen Blutes und die Bedeutung des Klosters im Kontext der Wallfahrt. Es schließt mit einem Fazit zur Bedeutung dieser Wallfahrt.
Welche Quellen wurden verwendet?
Die Arbeit stützt sich auf vorhandene Literatur und Quellen zur Geschichte des Klosters Wasserleben und der Legende vom Heiligen Blut. Die genaue Quellenangabe ist im Haupttext der Arbeit zu finden.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Mittelalterliche Wallfahrt, Pilger, Motive, Ablässe, Reliquien, Wasserleben, Harz, Heiliges Blut, Kloster, religiöse Mobilität, Peregrinatio.
- Quote paper
- Marie-Christin Pollak (Author), 2008, Wallfahrten im Mittelalter, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/93310