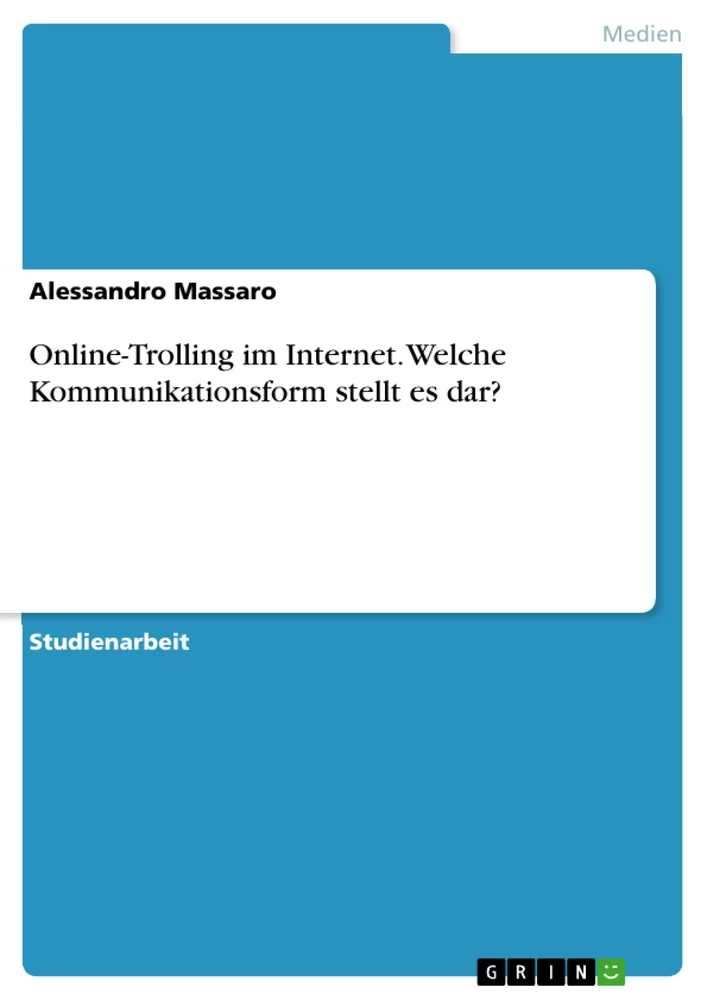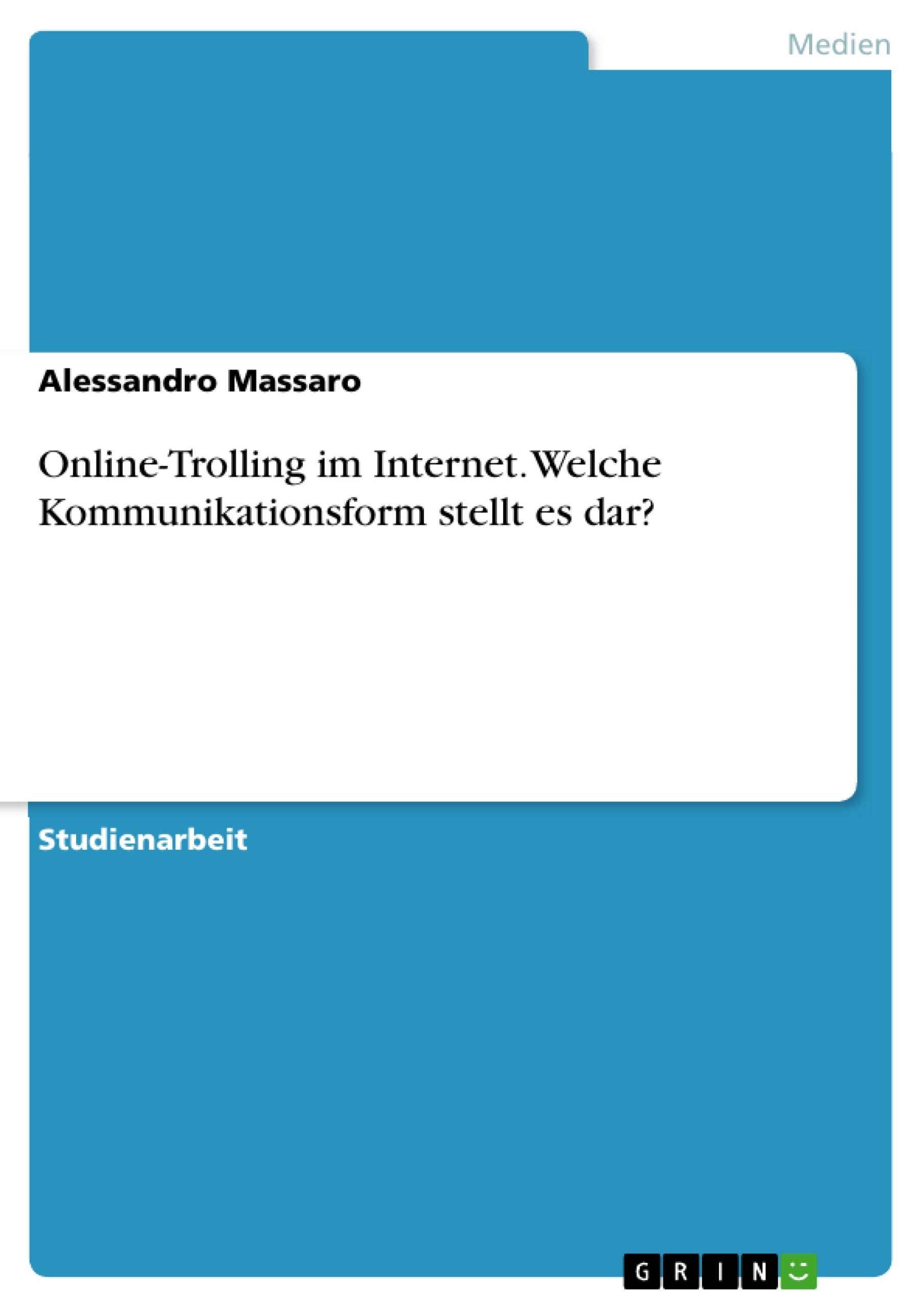Da in Bezug auf Trolling bisher die Erscheinung per se aufgegriffen, sie meistens in einen verhaltenspsychologischen Kontext gesetzt und die Verknüpfung des Trollens mit Kommunikation recht sporadisch und nicht explizit ausgeführt wurde, wird diese Arbeit ebendiesen Bezug zwischen Online-Trolling und Kommunikation genauer herstellen. Die Antwort auf die Frage, was das Phänomen Online-Trolling für eine Kommunikationsform darstellt, soll geboten werden.
Zunächst werden grundsätzlich Aspekte sowie Begriffe der Kommunikation und vor allem der Internet-Kommunikation präsentiert. Es wird eine allgemeine Definition von Kommunikation behandelt. Anschließend werden ausschließlich die Kommunikationsmetaphern von Klaus Krippendorf (1994) thematisiert. Im letzten Abschnitt wird die Internet- beziehungsweise Online-Kommunikation im so betitelten "Web 2.0" respektive "Social Web" umfassender vorangebracht und welche Veränderungen einhergehend mit neuen Gefahren zu klassischen Kommunikationsformen stattgefunden haben.
Anschließend befasst sich der Autor mit Online-Trolling. Nicht nur das Trolling an sich wird erklärt, sondern auch genutzte Methoden mit Beispielen werden vorgestellt. Abschließend folgt Analyse des Internet-Trollings hinsichtlich des Kommunikationsverständnisses. Damit wird eine Relation zwischen Online-Trolling und Kommunikation hergestellt und eine Antwort auf die Fragestellung geboten.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Kommunikation und ihre Ausprägung im Internet
- 2.1. Kommunikation
- 2.2. Kommunikationsmetaphern bei Krippendorf
- 2.3. Online- und Internet-Kommunikation
- 3. Online-Trolling im Internet
- 4. Das Phänomen des Online-Trollings als besondere Kommunikationsart
- 4.1. Kommunikation und Online-Trolling
- 4.2. Metaphern der Kommunikation und Online-Trolling
- 4.3. Online-Trolling als spezielle Ausprägung der Internet-Kommunikation
- 5. Fazit und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht das Phänomen des Online-Trollings im Kontext der Internet-Kommunikation. Ziel ist es, Online-Trolling als Kommunikationsform zu definieren und seine Besonderheiten herauszuarbeiten. Die Arbeit leistet einen Beitrag zur noch spärlichen deutschsprachigen Forschung zu diesem Thema.
- Definition und Abgrenzung von Online-Trolling
- Kommunikationstheoretische Grundlagen und ihre Anwendung auf Online-Trolling
- Analyse von Online-Trolling als spezifische Form der Internet-Kommunikation
- Methoden und Strategien des Online-Trollings
- Bedeutung und Auswirkungen von Online-Trolling
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung begründet die Relevanz der Arbeit angesichts des weit verbreiteten, aber wenig erforschten Phänomens des Online-Trollings, insbesondere im deutschsprachigen Raum. Sie skizziert den Aufbau der Arbeit, der sich auf die Klärung des Verhältnisses zwischen Online-Trolling und Kommunikation konzentriert. Die Arbeit möchte Online-Trolling als Kommunikationsform definieren und eingehend analysieren, im Gegensatz zu bisherigen Ansätzen, die sich eher auf verhaltenspsychologische Aspekte konzentrierten.
2. Kommunikation und ihre Ausprägung im Internet: Dieses Kapitel bietet einen Überblick über Kommunikation und Internet-Kommunikation. Es beginnt mit einer allgemeinen Definition von Kommunikation, basierend auf verschiedenen Autoren, und diskutiert Kommunikationsmetaphern nach Klaus Krippendorf. Der Fokus liegt dann auf der Online-Kommunikation im „Web 2.0“ bzw. „Social Web“, wobei Veränderungen und neue Gefahren im Vergleich zu klassischen Kommunikationsformen beleuchtet werden. Der Abschnitt legt die theoretischen Grundlagen für die spätere Analyse des Online-Trollings.
3. Online-Trolling im Internet: Dieses Kapitel liefert eine umfassende Beschreibung des Phänomens Online-Trolling. Es erläutert nicht nur den Begriff selbst, sondern präsentiert auch verschiedene Methoden und Strategien, die von Online-Trollen verwendet werden, illustriert mit Beispielen. Die Grundlage bildet vor allem englischsprachige Literatur, da diese das Thema Internet-Trolling ausgiebiger behandelt als deutschsprachige Quellen.
4. Das Phänomen des Online-Trollings als besondere Kommunikationsart: In diesem Kapitel erfolgt eine Analyse des Online-Trollings im Lichte des Kommunikationsverständnisses. Es werden die vorherigen Kapitel aufeinander bezogen und die Beziehung zwischen Online-Trolling und allgemeinem Kommunikationsverständnis, Krippendorfs Kommunikationsmetaphern und schließlich der Internet-Kommunikation hergestellt. Das Kapitel zielt darauf ab, Online-Trolling als spezielle Kommunikationsform zu definieren und zu charakterisieren.
Schlüsselwörter
Online-Trolling, Internet-Kommunikation, Kommunikationsmetaphern, Web 2.0, Social Web, Kommunikationstheorie, Online-Verhalten, digitale Kommunikation, Internetaktivität.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Arbeit: Online-Trolling als Kommunikationsform
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese wissenschaftliche Arbeit untersucht das Phänomen des Online-Trollings und analysiert es als spezifische Form der Internet-Kommunikation. Der Fokus liegt auf der Definition von Online-Trolling als Kommunikationsform und der Herausarbeitung seiner Besonderheiten. Die Arbeit schließt eine Lücke in der deutschsprachigen Forschung zu diesem Thema.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel: Einleitung, Kommunikation und ihre Ausprägung im Internet, Online-Trolling im Internet, Das Phänomen des Online-Trollings als besondere Kommunikationsart und Fazit und Ausblick. Jedes Kapitel baut auf den vorherigen auf und trägt zur umfassenden Analyse des Online-Trollings bei.
Welche Ziele verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, Online-Trolling präzise zu definieren und von anderen Formen der Online-Kommunikation abzugrenzen. Sie untersucht die kommunikativen Grundlagen des Online-Trollings und analysiert es mithilfe kommunikationstheoretischer Ansätze. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Beschreibung der Methoden und Strategien von Online-Trollen und deren Auswirkungen.
Welche Kommunikationstheorien werden verwendet?
Die Arbeit bezieht sich auf verschiedene Theorien der Kommunikation, insbesondere auf die Kommunikationsmetaphern nach Klaus Krippendorf. Diese Theorien dienen als Grundlage für die Analyse des Online-Trollings als spezifische Kommunikationsform. Der Vergleich mit klassischen Kommunikationsformen im Kontext des "Web 2.0" bzw. "Social Web" spielt ebenfalls eine Rolle.
Wie wird Online-Trolling in dieser Arbeit definiert und beschrieben?
Online-Trolling wird umfassend beschrieben, inklusive der verwendeten Methoden und Strategien. Es werden Beispiele angeführt und die Arbeit stützt sich dabei sowohl auf deutschsprachige als auch, vor allem wegen des reichhaltigeren Materials, auf englischsprachige Literatur. Die Definition von Online-Trolling erfolgt im Kontext des Kommunikationsverständnisses und seiner Besonderheiten im Internet.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Die Arbeit behandelt die Schlüsselwörter Online-Trolling, Internet-Kommunikation, Kommunikationsmetaphern, Web 2.0, Social Web, Kommunikationstheorie, Online-Verhalten, digitale Kommunikation und Internetaktivität.
Welche Quellen werden verwendet?
Die Arbeit bezieht sich auf eine Kombination aus deutschsprachiger und englischsprachiger Literatur, wobei letztere aufgrund des größeren Forschungsstandes zum Thema Online-Trolling eine wichtigere Rolle spielt.
Was ist das Fazit der Arbeit?
Das Fazit fasst die Ergebnisse der Analyse zusammen und gibt einen Ausblick auf zukünftige Forschungsfragen im Bereich des Online-Trollings. Es wird ein Beitrag zu einer noch spärlichen deutschsprachigen Forschungslandschaft geleistet.
Für wen ist diese Arbeit relevant?
Diese Arbeit ist relevant für Wissenschaftler, Studenten und alle Interessierten, die sich mit den Phänomenen der Internet-Kommunikation, Online-Verhalten und den Auswirkungen von Online-Trolling auseinandersetzen möchten. Sie bietet einen systematischen und wissenschaftlichen Zugang zu einem wichtigen Thema der digitalen Gesellschaft.
- Citation du texte
- Alessandro Massaro (Auteur), 2019, Online-Trolling im Internet. Welche Kommunikationsform stellt es dar?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/933318