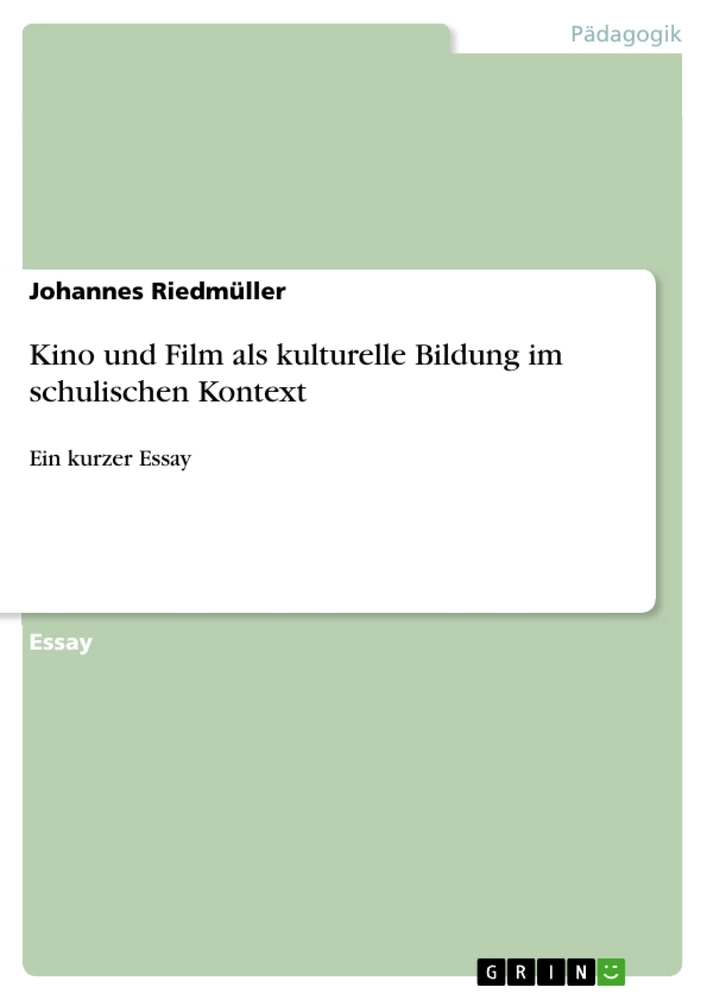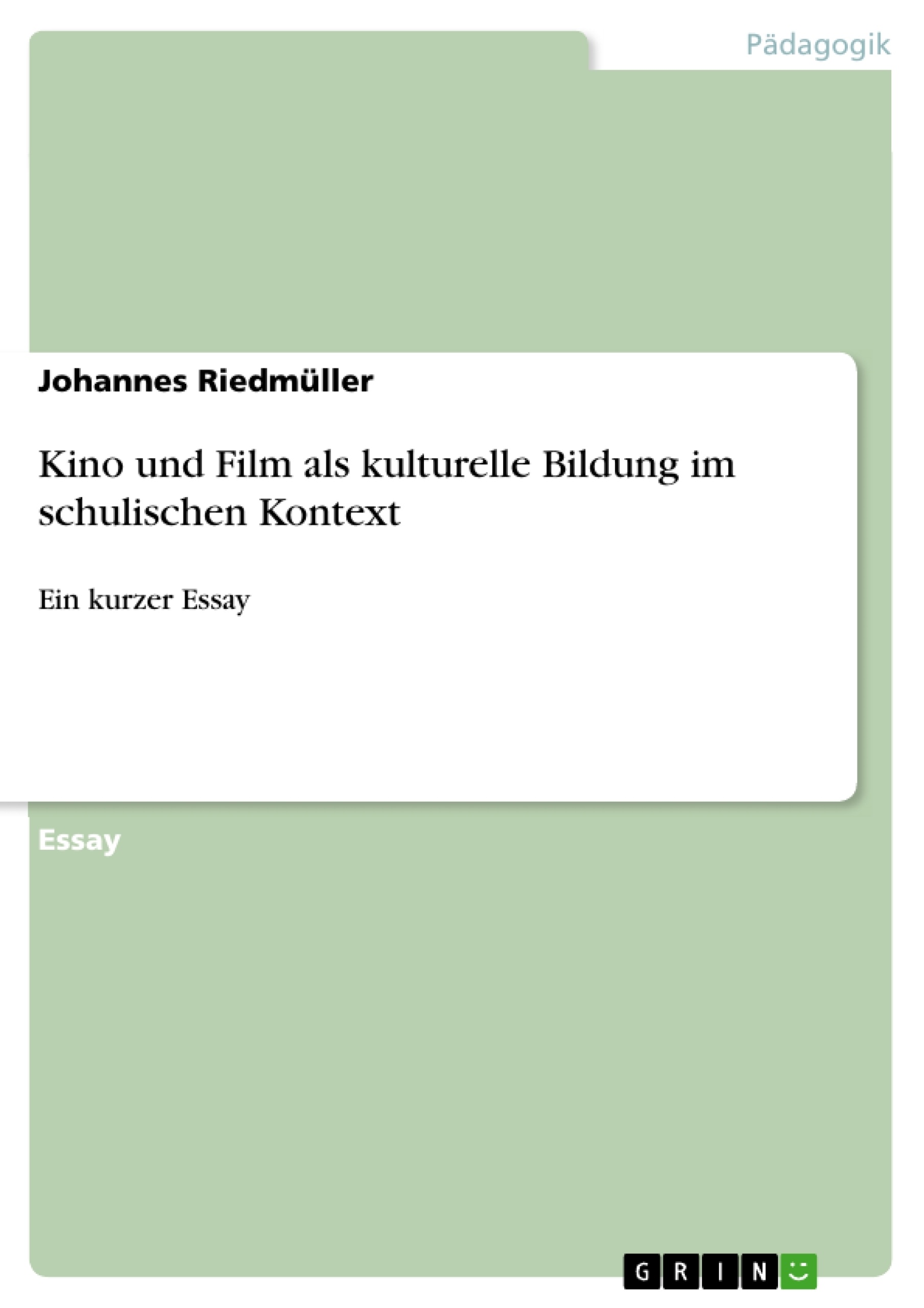Die vorliegende Arbeit widmet sich der Rolle von Film und Kino im Kontext kultureller Bildung. In einem Zeitalter, in dem etablierte Institutionen wie Theater, Museen und Bibliotheken als zentrale Akteure der kulturellen Bildung gelten, scheinen Film und Kino möglicherweise unverdient im Schatten zu stehen. Dabei ist das Kino von Anfang an als Ort für ein breites Publikum konzipiert gewesen und verkörpert eine egalitäre Form der kulturellen Teilhabe. Trotz historischer Vorbehalte und Vorstellungen von "Schmutz und Schund" hat sich das Kino als wichtige kulturelle Institution etabliert.
Die Arbeit beleuchtet die Reaktionen auf das Medium Film und die Institution Kino in verschiedenen historischen Phasen, insbesondere im wilhelminischen Kaiserreich und der Weimarer Republik. Es wird deutlich, dass Film und Kino nicht nur kulturelle, sondern auch gesellschaftliche Veränderungen widerspiegeln und beeinflussen. Dabei wird auch auf die Unterschiede zwischen Programmkinos mit anspruchsvollem Arthouse-Programm und Multiplex-Kinos eingegangen, wobei letztere oft eher als Konsumtempel denn als kulturelle Einrichtungen betrachtet werden.
Besonderes Augenmerk liegt auf der Verbindung zwischen schulischer Bildung und dem Medium Film. Die Schule als Vermittlerin kultureller Bildung steht vor der Herausforderung, Schülerinnen und Schüler mit anspruchsvollen Filmen in Berührung zu bringen, die über die gängigen Blockbuster hinausgehen. Hierbei wird die Frage aufgeworfen, wie die Schule die Brücke zu den Programmkinos schlagen kann, um Schülern eine Begegnung mit ästhetisch anspruchsvollem Film zu ermöglichen.
Die Arbeit hinterfragt auch die gegenwärtige Praxis schulischer Filmbildung, die häufig durch begrenzte Ressourcen und ein instrumentelles Verhältnis zum Film geprägt ist. Es wird diskutiert, inwieweit die Auswahl von Filmen im schulischen Kontext den Ansprüchen kultureller Bildung gerecht wird und wie eine authentische Begegnung mit dem Medium Film gestaltet werden kann.
Abschließend wird darauf hingewiesen, dass Film und Kino nicht gleichzusetzen sind, da es den Film auch außerhalb des Kinos gibt. Dabei wird auf die Herausforderungen eingegangen, die Streaming-Dienste wie Netflix für die Kinobranche darstellen, aber auch die besondere Rezeptionshaltung, die das Kino ermöglicht, im Vergleich zu den Multitasking-Gewohnheiten im heimischen Umfeld.
Inhaltsverzeichnis
- Kino und Film im Rahmen kultureller Bildung
- Film und Kino: Von „Schund“ zu Hochkultur?
- Die Schule als Mittler
- Bergala: Radikalismus als Chance?
- Die Schule und der Film: Ein instrumentelles Verhältnis?
- Film im Wandel: Streaming versus Kino
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Der Text befasst sich mit der Rolle des Kinos und des Films im Kontext kultureller Bildung. Er analysiert, wie das Kino als Institution der kulturellen Bildung wahrgenommen wird und welche Herausforderungen sich im Spannungsfeld von Hochkultur und Populärkultur ergeben. Im Fokus stehen insbesondere die Möglichkeiten und Grenzen des Films im Unterricht.
- Die Wahrnehmung des Films als Medium kultureller Bildung
- Die Bedeutung von Programmkinos für die Begegnung mit anspruchsvollen Filmen
- Die Herausforderung, Schüler*innen für anspruchsvolle Filme zu begeistern
- Das Verhältnis von Schule und Film: Instrumentierung vs. Eigenwert
- Der Wandel des Films: Streaming und die Rezeptionshaltung im Kino
Zusammenfassung der Kapitel
- Der Text beginnt mit einer Einführung in die Thematik und der Feststellung, dass das Kino als Institution kultureller Bildung oft übersehen wird. Der Autor stellt fest, dass das Kino historisch gesehen eine egalitärere Form der Kulturvermittlung war als Theater oder Oper, und dennoch oft mit Unterhaltung und Zerstreuung assoziiert wird.
- Im zweiten Kapitel geht es um die Wahrnehmung des Kinos als Medium kultureller Bildung. Der Autor zeigt, dass es im Bereich des Films eine Trennung zwischen Hochkultur und Populärkultur gibt. Die Programmkinos werden als Orte der Begegnung mit anspruchsvollen Filmen vorgestellt, während Multiplex-Kinos vor allem auf ökonomische Gesichtspunkte ausgerichtet sind.
- Das dritte Kapitel beschäftigt sich mit der Rolle der Schule als Mittler zwischen Schüler*innen und den Programmkinos. Der Autor betont, dass es Aufgabe der Schule ist, Schüler*innen mit anspruchsvollen Filmen vertraut zu machen und deren kulturellen Horizont zu erweitern.
- Im vierten Kapitel wird der französische Filmpädagoge Alain Bergala vorgestellt, der ein radikales Plädoyer für die Begegnung mit anspruchsvoller Kunst vertritt. Er betont die Notwendigkeit, Schüler*innen der Kunst "auszusetzen" und von ihr "erschüttern" zu lassen. Bergala kritisiert den Ansatz, Kunst zu verflachen, um sie "appetitlicher" zu machen.
- Das fünfte Kapitel beleuchtet das instrumentelle Verhältnis, das die Schule oft zum Film pflegt. Der Autor kritisiert die Auswahl von Filmen nach ihrer thematischen Verwertbarkeit und plädiert dafür, dem Film einen Eigenwert zuzusprechen.
- Das sechste Kapitel befasst sich mit dem Wandel des Films im Kontext von Streaming-Diensten wie Netflix. Der Autor stellt fest, dass die Rezeptionshaltung im Kino eine andere ist als beim Streaming und betont die Bedeutung des Kinos als Ort der konzentrierten Rezeption.
Schlüsselwörter
Kulturelle Bildung, Kino, Film, Programmkinos, Multiplex-Kinos, Hochkultur, Populärkultur, Alain Bergala, Streaming, Rezeption, konzentrierte Rezeption.
Häufig gestellte Fragen
Welche Rolle spielt das Kino in der kulturellen Bildung?
Kino wird oft als Ort der Unterhaltung unterschätzt, bietet aber eine egalitäre Form der kulturellen Teilhabe. Es ermöglicht die Begegnung mit ästhetisch anspruchsvollen Werken jenseits von Blockbustern und fördert die Medienkompetenz.
Was unterscheidet Programmkinos von Multiplex-Kinos?
Programmkinos (Arthouse) fokussieren auf künstlerischen Anspruch und kulturelle Vermittlung, während Multiplex-Kinos oft als "Konsumtempel" primär ökonomische Interessen verfolgen und populärkulturelle Massenware zeigen.
Wie kritisiert die Arbeit den schulischen Umgang mit Filmen?
Es wird ein oft "instrumentelles Verhältnis" kritisiert: Filme werden im Unterricht häufig nur nach ihrer thematischen Verwertbarkeit ausgewählt, anstatt den ästhetischen Eigenwert des Mediums Film zu würdigen.
Wer ist Alain Bergala und was ist seine These?
Alain Bergala ist ein Filmpädagoge, der dafür plädiert, Schüler der Kunst radikal "auszusetzen". Er lehnt eine Verflachung von Inhalten ab und fordert eine echte, erschütternde Begegnung mit anspruchsvollem Filmschaffen.
Wie beeinflusst Streaming die Rezeption von Filmen?
Streaming-Dienste wie Netflix fördern Multitasking und flüchtiges Schauen. Das Kino hingegen erzwingt eine konzentrierte Rezeptionshaltung in einem geteilten sozialen Raum, was für die kulturelle Bildung essenziell ist.
- Citation du texte
- Johannes Riedmüller (Auteur), 2019, Kino und Film als kulturelle Bildung im schulischen Kontext, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/933611