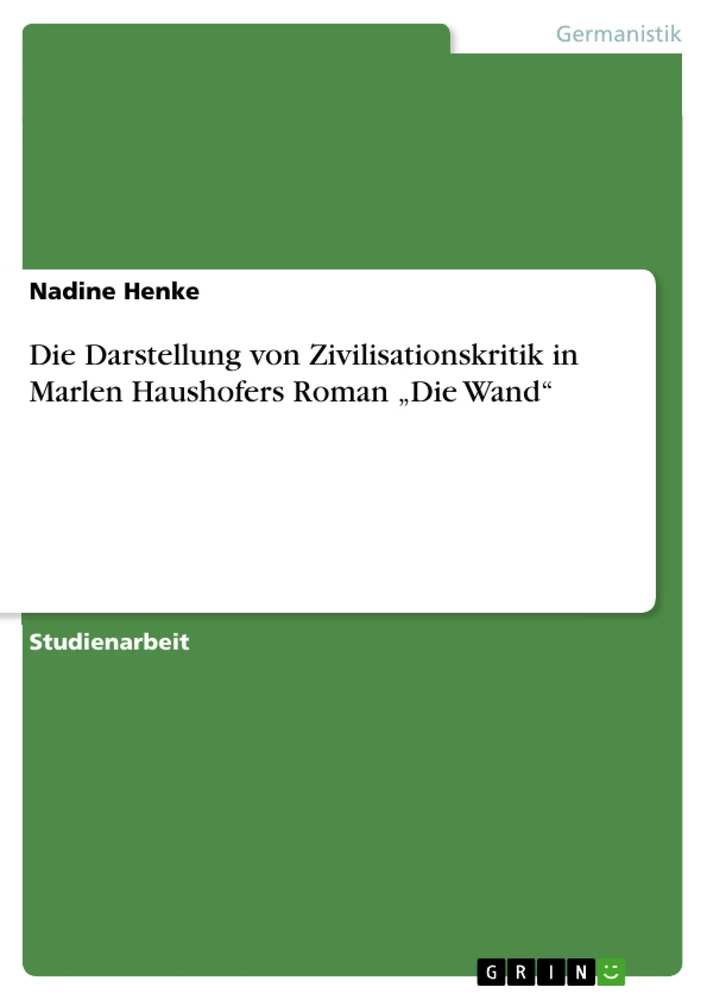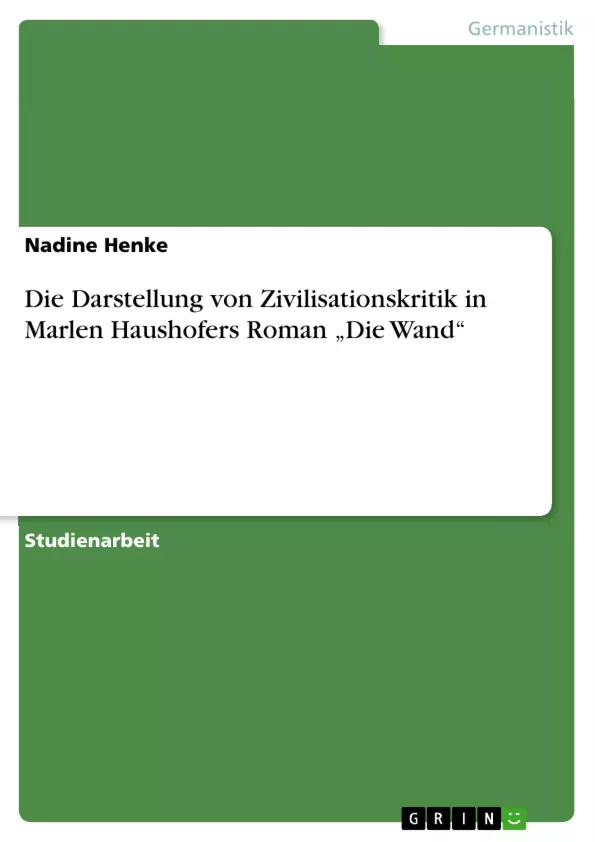In der vorliegenden Arbeit soll genauer eruiert werden, ob die Zivilisationskritik in „Die Wand“ eine absolute ist, wodurch sie repräsentiert wird, welche Ursachen sie hat und inwiefern die Ich-Erzählerin damit stellvertretend für den Menschen in der Moderne gesehen werden kann.
„In meinen Träumen waren die Menschen nie freundlich zu mir, bestenfalls waren sie teilnahmslos […] Aber ich glaube, das ist nicht so besonders merkwürdig, es zeigt nur, was ich immer von Menschen und Tieren erwarte.“
In Marlen Haushofers Roman „Die Wand“ finden sich an vielen Stellen ähnliche Reflektionen der Protagonistin über die Menschen und ihr früheres Leben in der Zivilisation. Die Protagonistin, die durch die Wand unfreiwillig von jeglicher Zivilisation isoliert wurde, fügt sich im Laufe des Romans immer mehr in ihr Schicksal und findet sogar zunehmend Gefallen an ihren neu gewonnenen Freiheiten weitab der Menschen. Mithilfe ihres Hundes Luchs sowie anderen Tieren wie einer Katze und einer Kuh fügt sich die Ich-Erzählerin immer mehr in die Natur ein und wird sich durch diesen Prozess über die kritischen Aspekte der Zivilisation bewusst.
Inhaltsverzeichnis
- Die Wand – Eine kurze thematische Einführung
- Zivilisationskritik in der Moderne – Eine Einordnung des Romans
- Zivilisationskritik bei Haushofer
- Das Leben in der Zivilisation und der Mensch als Feind
- Der technikkritische Diskurs in „Die Wand“
- Sehnsucht nach der Zivilisation? Eine exemplarische Untersuchung des Mediendiskurses in „Die Wand“
- Vollständige Eingliederung in die Natur? – Die Protagonistin als „weiße Krähe“
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Zivilisationskritik in Marlen Haushofers Roman „Die Wand“. Sie analysiert, ob die Kritik im Roman absolut ist, wie sie sich darstellt, welche Ursachen sie hat und inwieweit die Protagonistin als Vertreterin des modernen Menschen angesehen werden kann.
- Die Darstellung des Lebens in der Zivilisation und seine Auswirkungen auf die Protagonistin
- Die Kritik an den technischen Errungenschaften und ihren Folgen
- Die Suche nach Authentizität und Identität in einer entfremdeten Welt
- Die Rolle der Natur als Gegenpol zur Zivilisation
- Die Auswirkungen der Isolation auf die Wahrnehmung der Welt und des Selbst
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1: Dieses Kapitel bietet eine kurze Einführung in die Thematik des Romans „Die Wand“ und die zentralen Gedanken der Protagonistin hinsichtlich ihres früheren Lebens in der Zivilisation.
- Kapitel 2: In diesem Kapitel wird der Roman „Die Wand“ in den Kontext der Zivilisationskritik der Moderne eingeordnet. Es werden die gesellschaftlichen Veränderungen und die damit einhergehende Entfremdung des Menschen von der Gemeinschaft beleuchtet.
- Kapitel 3: Dieses Kapitel untersucht die Zivilisationskritik in „Die Wand“ anhand der Kommentare der Protagonistin zu ihrem früheren Leben und ihrer Wahrnehmung des Menschen als Bedrohung.
- Kapitel 4: Dieser Abschnitt analysiert die Rolle der Natur im Roman und die Frage, ob die Protagonistin eine vollständige Eingliederung in die Natur anstrebt.
Schlüsselwörter
Zivilisationskritik, Moderne, Entfremdung, Identität, Natur, Technik, Isolation, Authentizität, Mutterrolle, Gesellschaft, Mensch, Tier, „Die Wand“, Marlen Haushofer
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in Marlen Haushofers Roman „Die Wand“?
Der Roman handelt von einer Frau, die durch eine unsichtbare Wand plötzlich von der Zivilisation isoliert wird und allein in der Natur überleben muss.
Wie äußert sich die Zivilisationskritik im Roman?
Die Kritik zeigt sich in der Entfremdung der Protagonistin von ihrem früheren Leben, der Ablehnung technischer Errungenschaften und der Wahrnehmung des Menschen als potenzieller Feind.
Findet die Protagonistin eine vollständige Eingliederung in die Natur?
Die Arbeit untersucht diesen Prozess kritisch und bezeichnet die Protagonistin als „weiße Krähe“ – ein Wesen, das weder ganz zur Zivilisation noch ganz zur Natur gehört.
Welche Rolle spielen Tiere in Haushofers Werk?
Tiere wie der Hund Luchs, die Katze und die Kuh werden zu den wichtigsten Bezugspunkten der Protagonistin und ermöglichen ihr eine neue Form der Identität fernab menschlicher Gesellschaft.
Ist die Isolation für die Ich-Erzählerin nur negativ?
Nein, sie findet im Laufe der Zeit Gefallen an der neu gewonnenen Freiheit und nutzt die Isolation zur Reflexion über die negativen Aspekte der Moderne.
- Arbeit zitieren
- Nadine Henke (Autor:in), 2019, Die Darstellung von Zivilisationskritik in Marlen Haushofers Roman „Die Wand“, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/933760