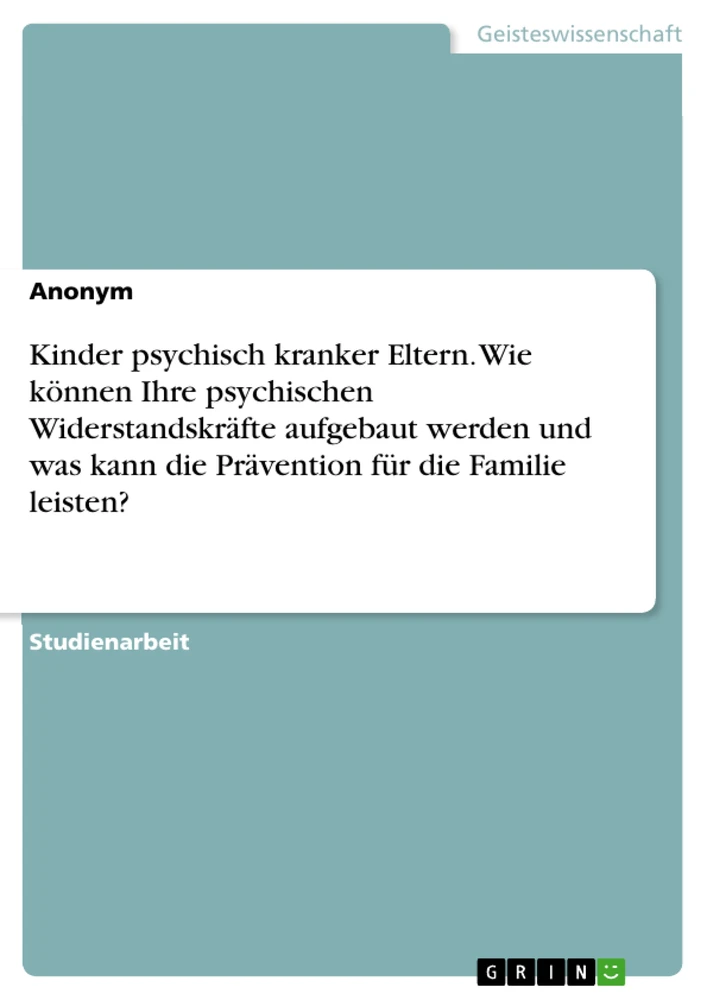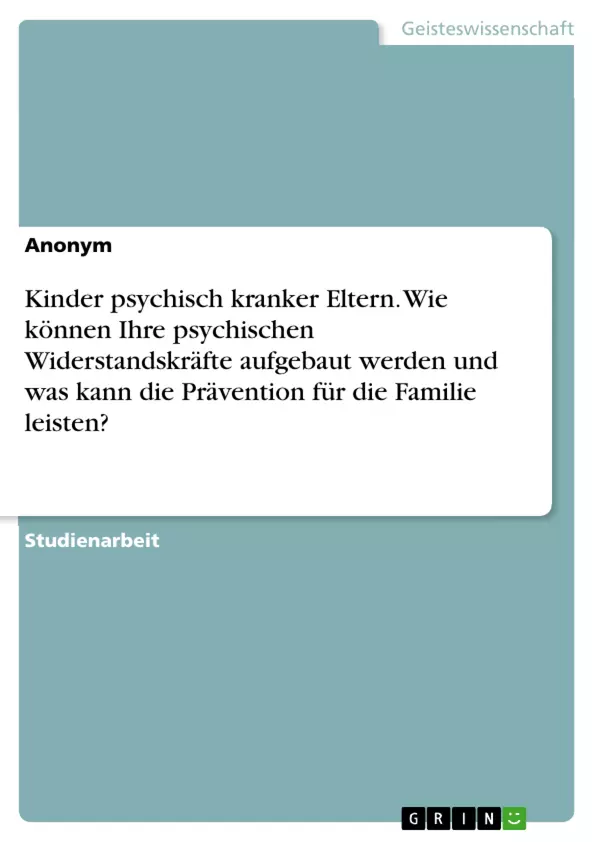Eine psychische Erkrankung kann nicht nur viele Beeinträchtigungen für die Betroffenen mit sich bringen. Die Kinder psychisch kranker Menschen sind neben den Partner*innen am stärksten von möglichen Veränderungen in der eigenen Lebenssituation betroffen. Die folgende Arbeit soll einen genaueren Einblick in die Thematik ermöglichen. Im Fokus liegen die betroffenen Kinder und die möglichen Ressourcen, um die Schwierigkeiten bewältigen zu können. Im Mittelpunkt dieser Arbeit steht die Frage, wie sich eine mögliche Widerstandskraft seitens der betroffenen Kinder entwickeln kann und welche verschiedenen Faktoren einen Einfluss auf diesen Prozess ausüben. Zusätzlich wird die Wichtigkeit von Präventionsmaßnahmen für betroffene Familien veranschaulicht.
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
1.1 Problemstellung
1.2 Zielsetzung und Forschungsfrage
1.3 Aufbau der Arbeit
1.4. Theoretische Fundierung
2. Überblick der häufigsten psychischen Störungen
2.1 Affektive Störungen
2.2 Emotional instabile Persönlichkeitsstörung
2.3 Schizophrenie
3. Lebenswelt von Kindern psychisch kranker Eltern
3.1 Desorientierung
3.2 Schuldgefühle
3.3 Soziale Isolierung
3.4 Verantwortungsübernahme (Parentifizierung)
4. Resilienz und Schutzfaktoren
4.1 Resilienz
4.2 Risikofaktoren
4.3 Längsschnittstudien
4.4 Die Kauai-Längsschnittstudie
4.4.1 Emmy Werner
4.4.2 Durchführung und zentrale Befunde
4.4.3 Schutzfaktoren der Kauai-Studie
4.5 Schutzfaktoren
4.5.1 Personale Schutzfaktoren
4.5.2 Familiäre Schutzfaktoren
4.5.3 Soziale Schutzfaktoren
4.6 Resiliente Kinder im Vergleich zu nicht-resilienten Kindern
5. Prävention
5.1 Präventive Maßnahmen
5.2 „KIPKEL“
6. Fazit
7. Literaturverzeichnis
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 1.1 Problemstellung
- 1.2 Zielsetzung und Forschungsfrage
- 1.3 Aufbau der Arbeit
- 1.4. Theoretische Fundierung
- 2. Überblick der häufigsten psychischen Störungen
- 2.1 Affektive Störungen
- 2.2 Emotional instabile Persönlichkeitsstörung
- 2.3 Schizophrenie
- 3. Lebenswelt von Kinder psychisch kranker Eltern
- 3.1 Desorientierung
- 3.2 Schuldgefühle
- 3.3 Soziale Isolierung
- 3.4 Verantwortungsübernahme (Parentifizierung)
- 4. Resilienz und Schutzfaktoren
- 4.1 Resilienz
- 4.2 Risikofaktoren
- 4.3 Längsschnittstudien
- 4.4 Die Kauai-Längsschnittstudie
- 4.4.1 Emmy Werner
- 4.4.2 Durchführung und zentrale Befunde
- 4.4.3 Schutzfaktoren der Kauai-Studie
- 4.5 Schutzfaktoren
- 4.5.1 Personale Schutzfaktoren
- 4.5.2 Familiäre Schutzfaktoren
- 4.5.3 Soziale Schutzfaktoren
- 4.6 Resiliente Kinder im Vergleich zu nicht-resilienten Kindern
- 5. Prävention
- 5.1 Präventive Maßnahmen
- 5.2 ,,KIPKEL"
- 6. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit widmet sich der besonderen Situation von Kindern, die mit mindestens einem psychisch kranken Elternteil leben. Sie soll ein tieferes Verständnis für die Herausforderungen dieser Kinder ermöglichen und die Bedeutung von Ressourcen zur Bewältigung der Schwierigkeiten hervorheben.
- Die Auswirkungen psychischer Erkrankungen der Eltern auf das Leben der Kinder
- Die Entwicklung von Widerstandsfähigkeit (Resilienz) bei betroffenen Kindern
- Die Analyse von Schutzfaktoren, die die Resilienz fördern
- Die Bedeutung von Präventionsmaßnahmen für Familien mit psychisch kranken Eltern
- Die Darstellung der aktuellen Lage und Hilfsmöglichkeiten für betroffene Kinder
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die die Problemstellung und die Forschungsfrage beleuchtet. Anschließend erfolgt ein Überblick über die häufigsten psychischen Störungen, wobei insbesondere die Auswirkungen auf das Alltagsleben der Betroffenen beleuchtet werden. Das dritte Kapitel beschäftigt sich mit der Lebenswelt der Kinder psychisch kranker Eltern, indem verschiedene Belastungsfaktoren aufgezeigt werden.
In Kapitel 4 wird der Fokus auf Resilienz und Schutzfaktoren gelegt. Es werden Risikofaktoren beleuchtet und wichtige Längsschnittstudien, insbesondere die Kauai-Studie, vorgestellt, um die Entstehung von Resilienz und die Wirksamkeit von Schutzfaktoren zu veranschaulichen.
Das fünfte Kapitel behandelt präventive Maßnahmen und stellt das Präventionsprojekt ,,KIPKEL" vor. Abschließend werden in einem Fazit die wichtigsten Erkenntnisse der Arbeit zusammengefasst.
Schlüsselwörter
Die Arbeit fokussiert sich auf die Thematik Kinder psychisch kranker Eltern, Resilienz, Schutzfaktoren, Prävention, psychische Störungen und die Lebenswelt von betroffenen Kindern.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2020, Kinder psychisch kranker Eltern. Wie können Ihre psychischen Widerstandskräfte aufgebaut werden und was kann die Prävention für die Familie leisten?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/934535