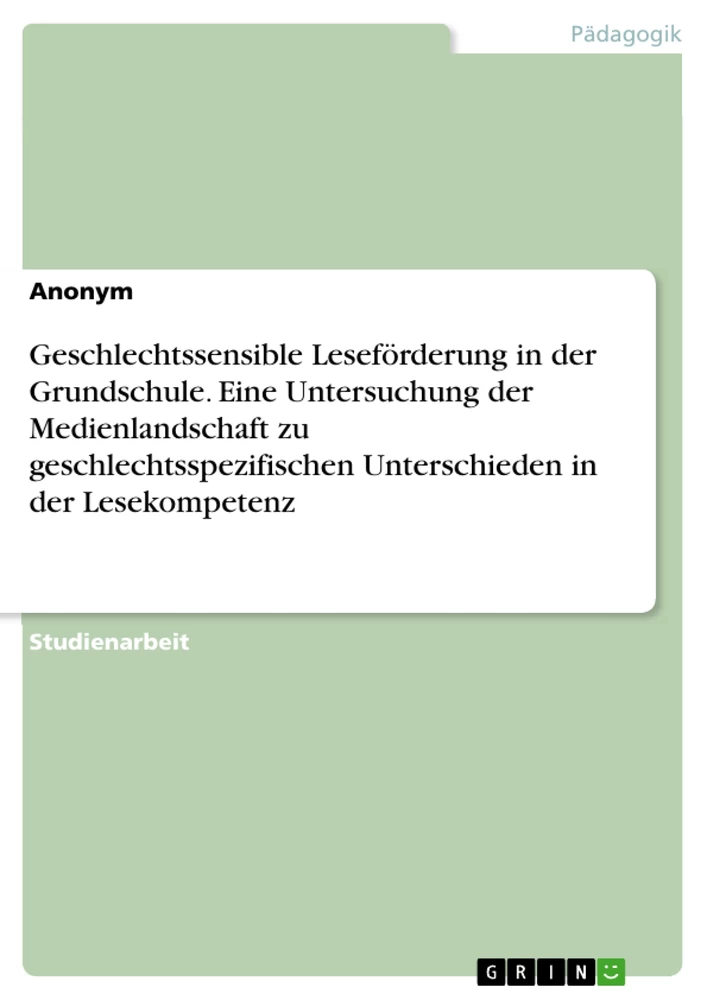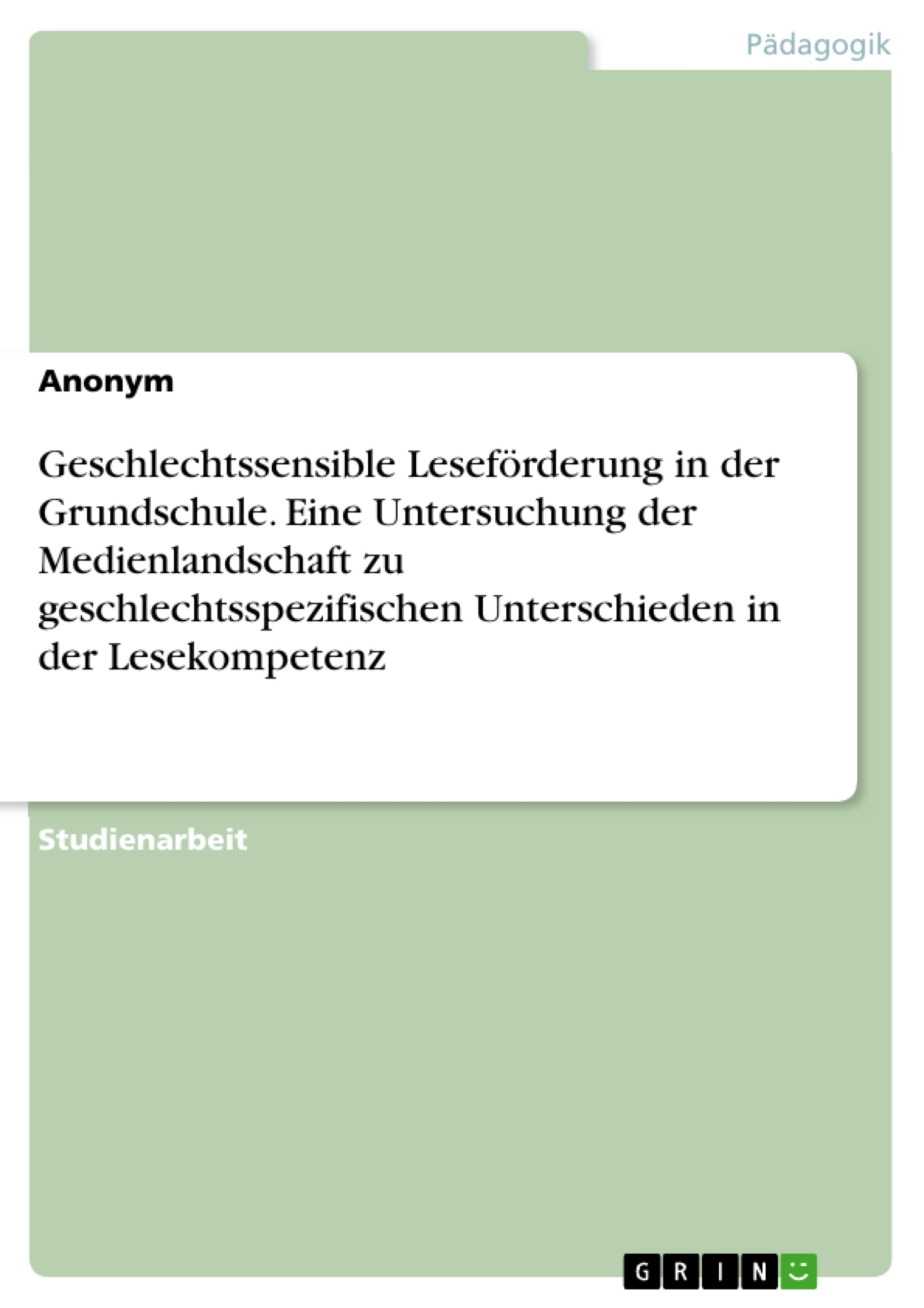In dieser Hausarbeit wird näher auf die geschlechtsspezifischen Unterschiede im Themenspektrum Lesen eingegangen. Zunächst erklärt der Autor wichtige Begriffe und Modelle zur Lesekompetenz und Lesemotivation. Anschließend stellt er vor, wie die lesebezogenen Geschlechtsunterschiede und die daraus folgenden Diskussionen über deren Ursachen in den Populärmedien aufgefasst wurden, und zieht den Vergleich zur wissenschaftlichen Sichtweise. Seine Erkenntnisse nutzt er abschließend, um eine gendersensible Leseförderung vorzustellen und auf das Modell der Lesekompetenz nach Möller und Schiefele zu beziehen.
Egal ob "Echte Kerle lesen nicht!?" oder "Mädchen sind Leseratten und Jungen Büchermuffel?" - was humoristisch klingt, sind Titel wissenschaftlicher Publikationen über das Leseverhalten von Jungen und Mädchen. Deren Inhalt verleitet – anders als ihre Titel - häufig nicht zum Schmunzeln: Sowohl die Lesekompetenz als auch die Lesemotivation von Jungen fällt im Vergleich zu ihren Altersgenossinnen ab. Dabei ist das Lesen eine zentrale Schlüsselfertigkeit im Bildungsprozess jedes Individuums. Woher kommen die gravierenden Unterschiede in den Leseleistungen, wo doch Jungen wie Mädchen dieselben Schulen besuchen und im selben Zeitalter aufwachsen?
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Begriffsklärung
- Lesemotivation
- Erwartungs-Wert-Modell der Lesemotivation
- Unterschiede in der Lesekompetenz
- Empirisch belegte Unterschiede der Lesekompetenz und Lesemotivation
- Verständnis von Lesekompetenz und Lesemotivation in der PISA-Studie
- Relevante Ergebnisse empirischer Studien
- Differenzen der Geschlechter unter der Lupe
- Soziale Rollen/Umgang mit Geschlecht in der Schule
- Neue Medien/Automatisiertes Lesen
- Fazit der Ursachenforschung
- Geschlechtssensible Leseförderung
- Leseförderung im Ökosystem Schule
- Leseförderung im Unterricht
- Modell zur Leseförderung nach Garbe (2014a)
- Baustein 1: Förderung der Leseflüssigkeit durch Lautlese-Verfahren
- Baustein 2: Vermittlung von Lesestrategien
- Baustein 3: Viellese-Verfahren
- Baustein 4: Verfahren der Lese-Animation
- Hinweise zur Lektüreauswahl
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit befasst sich mit geschlechtsspezifischen Unterschieden im Leseverhalten von Jungen und Mädchen in der Grundschule. Ziel ist es, die Ursachen für die beobachteten Unterschiede in der Lesekompetenz und Lesemotivation zu analysieren und anhand der gewonnen Erkenntnisse eine gendersensible Leseförderung zu entwickeln.
- Analyse der wissenschaftlichen Literatur zu geschlechtsspezifischen Unterschieden in der Lesekompetenz und Lesemotivation
- Bewertung des Einflusses von Medien und sozialen Rollen auf das Leseverhalten
- Entwicklung eines Modells für gendersensible Leseförderung
- Anwendung des Erwartungs-Wert-Modells der Lesemotivation auf gendersensible Leseförderung
- Zusammenstellung von praxisrelevanten Informationen zur Umsetzung gendersensibler Leseförderung in der Schule
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema ein und stellt die Forschungsfrage nach den Ursachen für geschlechtsspezifische Unterschiede in der Lesekompetenz. Anschließend werden die Begriffe "Lesemotivation" und "Lesekompetenz" definiert, wobei das Erwartungs-Wert-Modell der Lesemotivation von Möller und Schiefele vorgestellt wird.
Kapitel 3 beschäftigt sich mit empirisch belegten Unterschieden in der Lesekompetenz und Lesemotivation zwischen Jungen und Mädchen. Die Studie PISA und weitere relevante Forschungsarbeiten werden betrachtet, um die Ursachen für diese Unterschiede zu beleuchten. Soziale Rollen, der Umgang mit Geschlecht in der Schule und der Einfluss neuer Medien werden als wichtige Einflussfaktoren analysiert.
Kapitel 4 befasst sich mit der Entwicklung einer gendersensiblen Leseförderung. Die Bedeutung von Leseförderung im Ökosystem Schule und im Unterricht wird hervorgehoben. Ein Modell zur Leseförderung nach Garbe wird vorgestellt, das verschiedene Bausteine für eine effektive Leseförderung umfasst. Die Bausteine umfassen die Förderung der Leseflüssigkeit, die Vermittlung von Lesestrategien, Viellese-Verfahren und die Lese-Animation. Hinweise zur Auswahl geeigneter Lektüre für gendersensible Leseförderung werden ebenfalls gegeben.
Schlüsselwörter
Geschlechtssensible Leseförderung, Lesekompetenz, Lesemotivation, Erwartungs-Wert-Modell, PISA-Studie, Medienlandschaft, soziale Rollen, genderspezifische Unterschiede, neue Medien, Lesestrategien, Viellese-Verfahren, Lese-Animation
- Citar trabajo
- Anonym (Autor), 2017, Geschlechtssensible Leseförderung in der Grundschule. Eine Untersuchung der Medienlandschaft zu geschlechtsspezifischen Unterschieden in der Lesekompetenz, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/934610