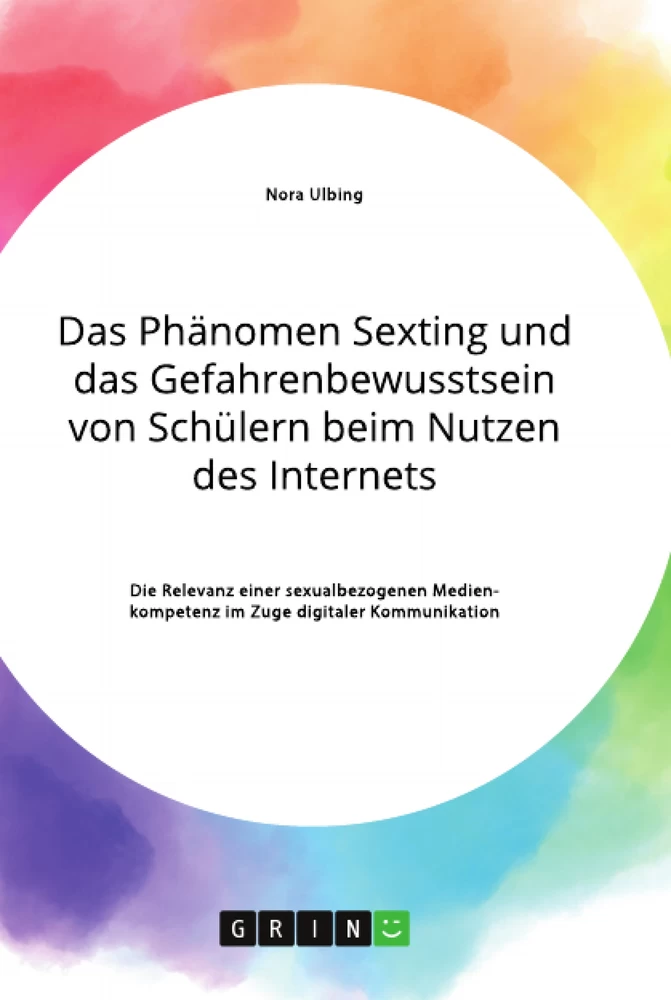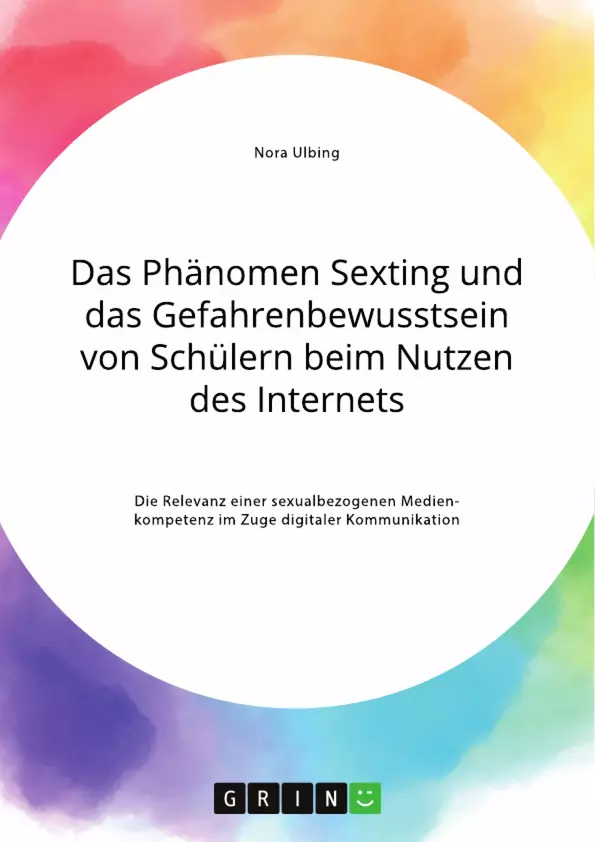Thema der Masterarbeit ist das Phänomen Sexting, das die Relevanz einer sexualbezogenen Medienkompetenz im Kontext digitaler Kommunikation beinhaltet. Die Arbeit gliedert sich in einen theoretischen und einen empirischen Teil.
Der Theorieteil bildet hierbei die Grundlage für die empirische Forschung. Ziel dieser Untersuchung war es, das Gefahrenbewusstsein Heranwachsender im Hinblick auf das Phänomen Sexting zu ergründen. Die Forschungsfrage lautete: „Welches Gefahrenbewusstsein weisen Schülerinnen und Schüler bei sexualbezogener Interaktion mit digitalen Medien auf?“
Mittels leitfadengestützten Interviews und Dilemmata Interviews, die mit der qualitativen Inhaltsanalyse ausgewertet wurden, wurden acht Schülerinnen und Schüler einer Sekundarstufe im Alter von 14-15 Jahren im Hinblick auf die Thematik befragt. Die Antworten der Befragten konnten zeigen, dass das Smartphone heute die Funktion eines multifunktionalen Alltagsbegleiters hat und dass das Phänomen Sexting im Leben Heranwachsender zur Wirklichkeit geworden ist.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Forschungsziel und Forschungsmethode
- Aufbau der Arbeit
- Medientheoretische Einführung
- Sexuelle Sozialisation
- Sexuelle Sozialisation im Kontext sozialer Medien
- Chancen und Risiken für Mädchen im Kontext der Nutzung sozialer Medien und Sex 2.0
- Das Phänomen Sexting
- Sexualbezogene Medienkompetenz
- Gefahrenbewusster Umgang mit Risiken
- Medienpädagogischer Ansatz
- Forschungsstand
- Empirische Untersuchung
- Beschreibung und Begründung der Methode
- Durchführung der Untersuchung
- Darstellung der Ergebnisse
- Nutzung des Smartphones
- Erfahrungen mit Bildern in sozialen Medien
- Kommunikation mit Selfies
- Strategien eines gefahrenbewussten Umgangs
- Erstes Dilemma
- Zweites Dilemma
- Persönliche Erfahrung
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Masterarbeit untersucht das Phänomen Sexting und die Relevanz sexualbezogener Medienkompetenz im Kontext digitaler Kommunikation. Ziel ist es, das Gefahrenbewusstsein von Jugendlichen im Hinblick auf Sexting zu ergründen. Die Arbeit kombiniert theoretische Grundlagen mit einer empirischen Untersuchung.
- Sexuelle Sozialisation im digitalen Zeitalter
- Risiken und Chancen der Nutzung sozialer Medien im Kontext von Sexualität
- Das Phänomen Sexting: Definition, Verbreitung und Folgen
- Sexualbezogene Medienkompetenz als Schutzfaktor
- Gefahrenbewusstsein und Strategien von Jugendlichen im Umgang mit Sexting
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik Sexting und die Bedeutung von Medienkompetenz ein. Sie formuliert die Forschungsfrage und beschreibt den Aufbau der Arbeit. Das Forschungsziel wird klar definiert und die gewählte Methodik wird kurz skizziert, um den Rahmen der Untersuchung zu setzen.
Medientheoretische Einführung: Dieses Kapitel liefert den theoretischen Hintergrund, indem es die sexuelle Sozialisation im Allgemeinen und im Kontext digitaler Medien beleuchtet. Es analysiert Chancen und Risiken für Jugendliche, insbesondere Mädchen, die soziale Medien nutzen. Das Phänomen Sexting wird definiert und eingeordnet, sowie der Begriff der sexualbezogenen Medienkompetenz erläutert. Schließlich wird ein medienpädagogischer Ansatz vorgestellt, der den Umgang mit den Herausforderungen von Sexting adressiert. Die Kapitelteile bauen aufeinander auf und schaffen ein umfassendes Verständnis der theoretischen Basis der Forschungsarbeit.
Forschungsstand: Dieses Kapitel präsentiert eine Übersicht des bestehenden Forschungsstands zum Thema Sexting und sexualbezogener Medienkompetenz. Es dient als Grundlage für die eigene empirische Untersuchung und zeigt, welche Fragen bereits behandelt wurden und welche Forschungslücken die vorliegende Arbeit zu schließen versucht. Die kritische Auseinandersetzung mit existierenden Studien ermöglicht die Einordnung der eigenen Arbeit in den wissenschaftlichen Diskurs.
Empirische Untersuchung: Dieses Kapitel beschreibt die durchgeführte qualitative Studie mit leitfadengestützten und Dilemmata-Interviews. Die Methodik wird detailliert erläutert, die Durchführung beschrieben, und die Ergebnisse werden präsentiert und interpretiert. Die Analyse der Daten konzentriert sich auf die Nutzung von Smartphones, Erfahrungen mit Bildern in sozialen Medien, Kommunikation mit Selfies und Strategien im Umgang mit Sexting-Dilemmas. Die Ergebnisse geben Aufschluss über das Gefahrenbewusstsein und die Handlungskompetenzen der befragten Jugendlichen.
Schlüsselwörter
Sexting, Medienkompetenz, sexuelle Sozialisation, digitale Kommunikation, Jugendliche, Gefahrenbewusstsein, qualitative Forschung, Smartphone, soziale Medien, Risiken, Schutzfaktoren.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Masterarbeit: Sexting und Sexualbezogene Medienkompetenz
Was ist der Gegenstand dieser Masterarbeit?
Die Masterarbeit untersucht das Phänomen Sexting und die Bedeutung sexualbezogener Medienkompetenz im Kontext der digitalen Kommunikation, insbesondere bei Jugendlichen. Der Fokus liegt auf dem Gefahrenbewusstsein der Jugendlichen im Umgang mit Sexting.
Welche Forschungsmethode wurde angewendet?
Die Arbeit kombiniert theoretische Grundlagen mit einer empirischen Untersuchung. Die empirische Untersuchung besteht aus qualitativen, leitfadengestützten Interviews und Dilemmata-Interviews.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themen: sexuelle Sozialisation im digitalen Zeitalter, Risiken und Chancen sozialer Medien im Kontext von Sexualität, Definition, Verbreitung und Folgen von Sexting, sexualbezogene Medienkompetenz als Schutzfaktor und Gefahrenbewusstsein sowie Strategien von Jugendlichen im Umgang mit Sexting.
Wie ist die Arbeit aufgebaut?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, eine medientheoretische Einführung, einen Forschungsstand, eine empirische Untersuchung und ein Fazit. Die Einleitung definiert die Forschungsfrage und den methodischen Ansatz. Die medientheoretische Einführung beleuchtet die relevanten Theorien. Der Forschungsstand präsentiert bestehende Forschungsergebnisse. Die empirische Untersuchung beschreibt die Methodik, Durchführung und Ergebnisse der Studie. Das Fazit fasst die Ergebnisse zusammen.
Welche Ergebnisse wurden erzielt?
Die Ergebnisse der empirischen Untersuchung basieren auf der Analyse der Daten aus den Interviews. Sie geben Aufschluss über die Nutzung von Smartphones, Erfahrungen mit Bildern in sozialen Medien, Kommunikation mit Selfies und Strategien im Umgang mit Sexting-Dilemmas. Die Ergebnisse beleuchten das Gefahrenbewusstsein und die Handlungskompetenzen der befragten Jugendlichen.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Sexting, Medienkompetenz, sexuelle Sozialisation, digitale Kommunikation, Jugendliche, Gefahrenbewusstsein, qualitative Forschung, Smartphone, soziale Medien, Risiken, Schutzfaktoren.
Was ist das Ziel der Arbeit?
Das Ziel der Arbeit ist es, das Gefahrenbewusstsein von Jugendlichen im Hinblick auf Sexting zu ergründen und die Relevanz sexualbezogener Medienkompetenz in diesem Kontext aufzuzeigen.
Welche theoretischen Grundlagen werden verwendet?
Die Arbeit stützt sich auf medientheoretische Ansätze zur sexuellen Sozialisation und digitalen Kommunikation. Sie beleuchtet Chancen und Risiken der Mediennutzung im Kontext von Sexualität und definiert den Begriff der sexualbezogenen Medienkompetenz.
- Arbeit zitieren
- Nora Ulbing (Autor:in), 2019, Das Phänomen Sexting und das Gefahrenbewusstsein von Schülern beim Nutzen des Internets. Die Relevanz einer sexualbezogenen Medienkompetenz im Zuge digitaler Kommunikation, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/935028