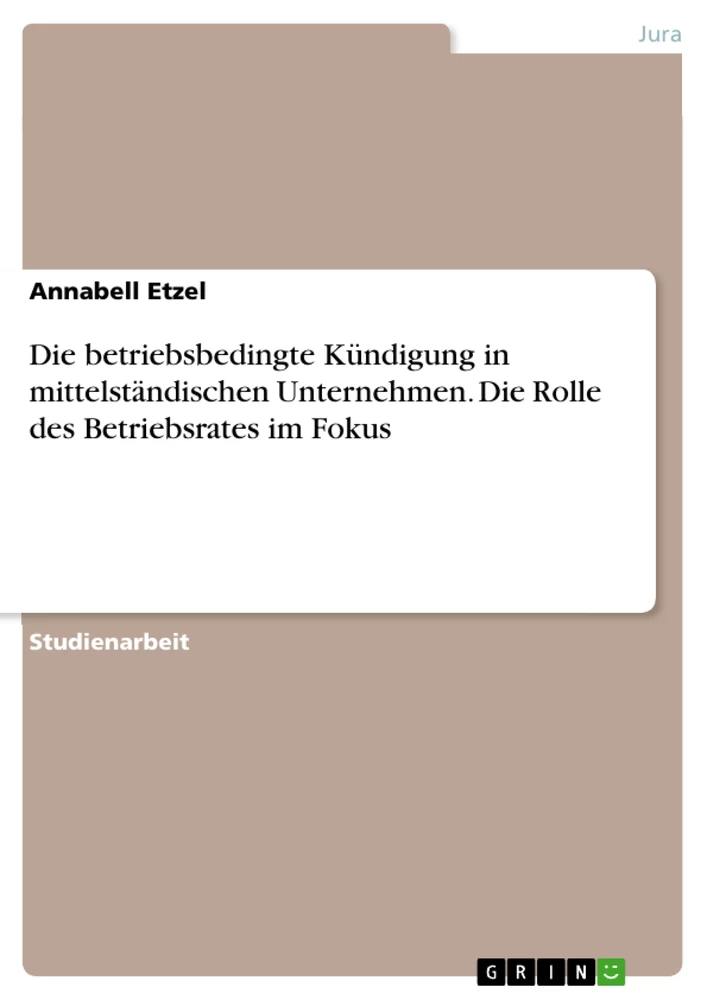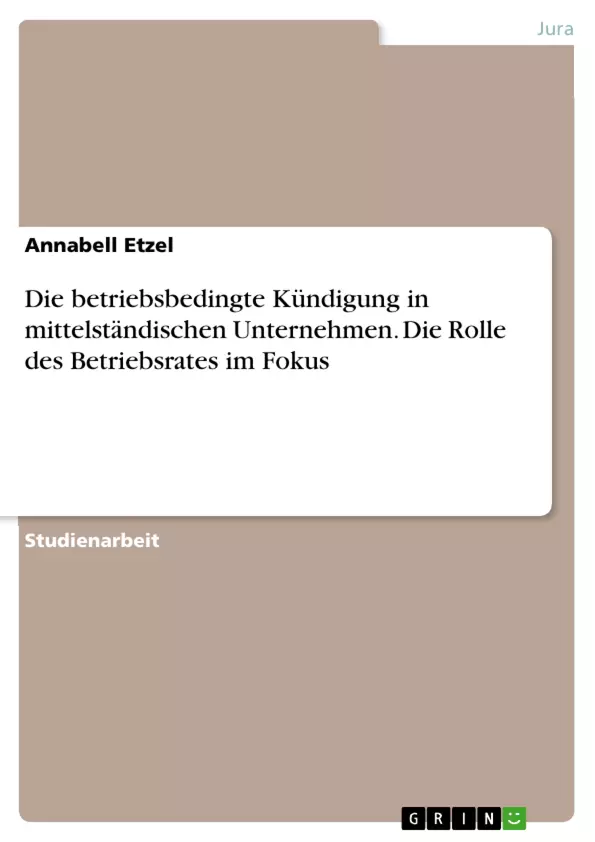Das Ziel ist es, die Praxistauglichkeit der rechtlichen Vorgaben zu beurteilen - wird dem Allgemeinwohl Genüge getan? Dazu wird ein Fallbeispiel aus der Rechtssprechung des Landesarbeitsgerichts (LAG) Köln aus dem Jahr 2019 herangezogen. Im Vorfeld dessen werden Grundlagen geschaffen, indem die Gesetzeslage in Bezug auf Kündigungen allgemein und präziser auf den konkreten Fall der betriebsbedingten Kündigung hin erläutert wird. Diese Kategorie macht den größten Anteil - etwa 2/3 aller arbeitsgeberseitigen ausgesprochenen Kündigung aus. Die Handlungsfreiheit, die ein Unternehmen in diesem Bereich innehat, wird in mancherlei Hinsicht eingegrenzt - diese Mechanismen werden beschrieben.
Inhaltsverzeichnis
- EINLEITUNG
- Problemstellung
- Ziel und Aufbau des Assignments
- DIE BETRIEBSBEDINGTE KÜNDIGUNG
- Rechtliche Grundlagen im Zusammenhang mit einer betriebsbedingten Kündigung
- Begriffserläuterung Kündigung und rechtlicher Rahmen
- Das Kündigungsschutzgesetz fordert der Kündigung eine soziale Rechtfertigung ab
- Grundlagen der Begründung betriebsbedingter Kündigungen
- Vorgaben zur Sozialauswahl und die Rolle des Betriebsrats im Kündigungsverfahren
- Kritische Reflexion der Praxistauglichkeit anhand eines Fallbeispiels aus der Rechtsprechung
- Eckdaten einer Kündigungsschutzklage in Köln
- Innerbetriebliche Umstrukturierung aufgrund von Auftragsrückgang
- Die Fehlerhaftigkeit der Sozialauswahl
- Praxistauglichkeit der rechtlichen Rahmenbedingungen
- FAZIT
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Das Assignment untersucht die Praxistauglichkeit der rechtlichen Vorgaben zur betriebsbedingten Kündigung im Hinblick auf das Allgemeinwohl. Hierzu wird ein Fallbeispiel aus der Rechtsprechung des Landesarbeitsgerichts Köln aus dem Jahr 2019 analysiert. Der Fokus liegt auf der Frage, ob die gesetzlich vorgegebenen Rahmenbedingungen in der Praxis effektiv sind und ob sie dem Prinzip des Allgemeinwohls gerecht werden.
- Rechtliche Grundlagen der betriebsbedingten Kündigung
- Rolle des Kündigungsschutzgesetzes
- Anforderungen an die Sozialauswahl
- Praxisrelevanz des Betriebsrats im Kündigungsverfahren
- Bewertung der rechtlichen Vorgaben anhand eines Fallbeispiels
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung beleuchtet die Bedeutung des Arbeitsplatzes und die Spannungen zwischen sozialer Rücksichtnahme und wirtschaftlicher Flexibilität in Deutschland. Die Kapitel 2.1 und 2.1.1 erläutern den rechtlichen Rahmen der Kündigung, die rechtlichen Vorgaben und die Bedeutung des Kündigungsschutzgesetzes. Kapitel 2.1.2 und 2.1.3 fokussieren auf die sozialen Rechtfertigungsgründe und die Anforderungen an die Begründung einer betriebsbedingten Kündigung. Die Kapitel 2.1.4, 2.2, 2.2.1 und 2.2.2 gehen auf die Rolle des Betriebsrats, die Eckdaten des Fallbeispiels und die Umstrukturierung im Unternehmen ein. Kapitel 2.2.3 und 2.2.4 befassen sich mit der fehlerhaften Sozialauswahl und der Bewertung der Praxistauglichkeit der rechtlichen Rahmenbedingungen.
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselwörter des Textes sind betriebsbedingte Kündigung, Kündigungsschutzgesetz, Sozialauswahl, Betriebsrat, Allgemeinwohl, Rechtssprechung, Fallbeispiel, Rechtsprechung des Landesarbeitsgerichts Köln, Praxistauglichkeit, Mittelständisches Unternehmen, Auftragsrückgang, Rationalisierung, Flexibilisierung, Rechtlicher Rahmen, soziale Marktwirtschaft.
- Quote paper
- Annabell Etzel (Author), 2020, Die betriebsbedingte Kündigung in mittelständischen Unternehmen. Die Rolle des Betriebsrates im Fokus, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/935502