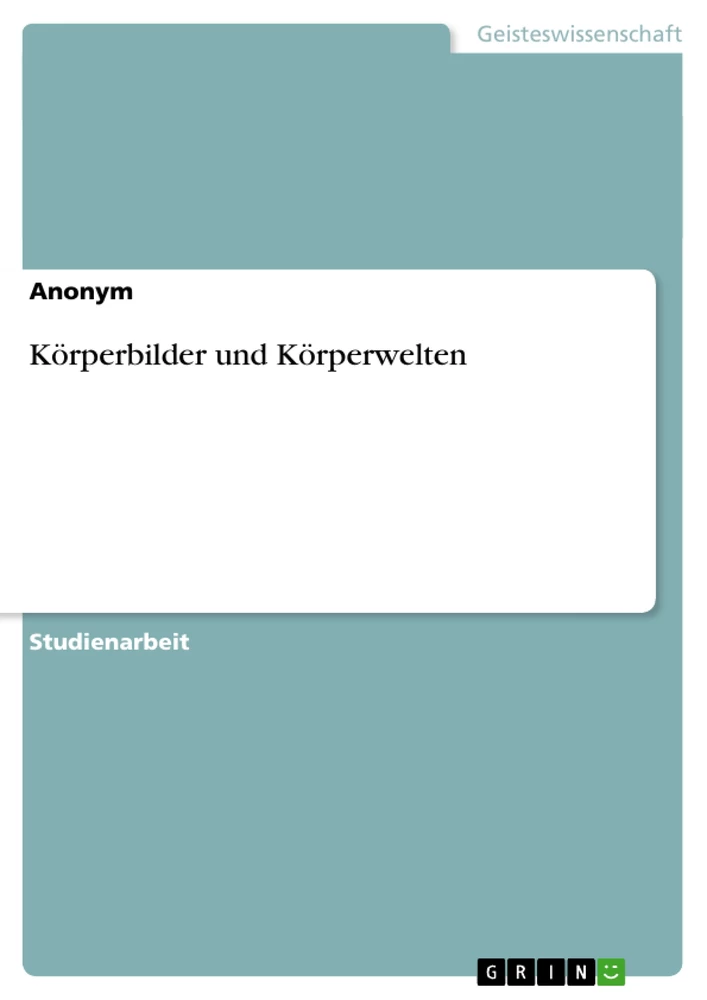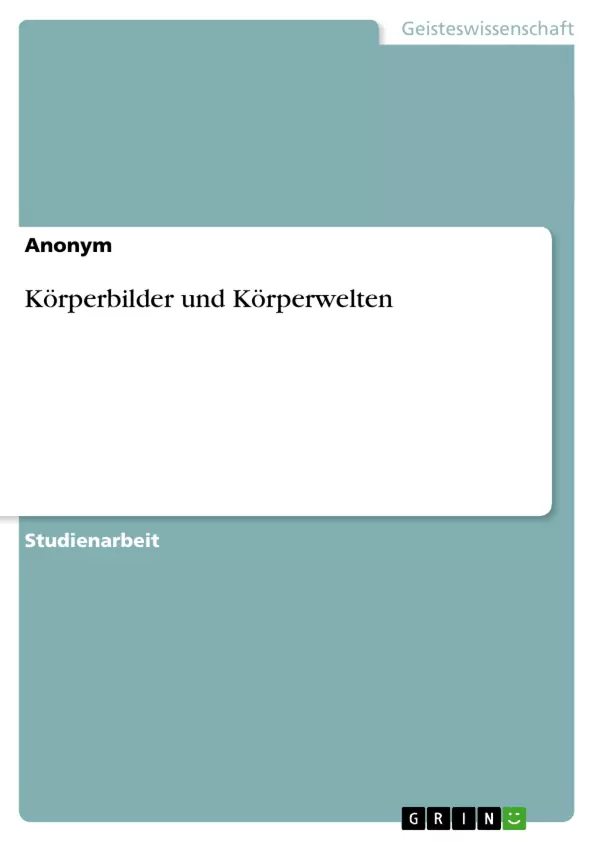In dieser Arbeit möchte ich zunächst klären, was man unter Körperbildern versteht. In der Psychologie wird häufig der Begriff „Körperschema“ gebraucht. So ist weiter der Unterschied zwischen Körperbild und Körperschema zu klären.
Im Laufe der Menschheitsgeschichte hat es verschiedene Körperbilder, unterschiedliche Auffassungen von Körper und Körperlichkeit gegeben. Diese unterschiedlichen Umgänge mit dem Körper möchte ich beschreiben um anschließend die unserer heutigen Gesellschaft zu nennen.
Des Weiteren werde ich mich mit dem kindlichen Körperbild beschäftigen. Es ist zu fragen, wie sich ein solches Bild entwickelt, und wie es erkranken kann. Gerade in den letzten zehn Jahren haben die Zahlen der gestörten Körperbilder zugenommen. Besonders bemerkbar macht sich diese Tatsache durch die Zahl der Essgestörten. Nun sind nicht nur viele Jugendliche essgestört, sondern, mittlerweile auch Kinder. Ich werde ergründen, warum Menschen bereits in so jungen Jahren erkranken und in diesem Zusammenhang eine dieser, unter dem Begriff „Essstörung“ gefassten Krankheiten genauer untersuchen. Das Körperschema eines jeden ähnelt den anderen seines Alters auf dem gleichen Teil der Welt in hohem Maße. So spezifiziert das Körperschema eine Person als Vertreter seiner Gattung. Das Körperbild hingegen ist bei jedem Menschen individuell. Das Körperbild ist völlig unbewusst, wohingegen das Körperschema durchaus teils bewusst sein kann. Das Körperbild ist durch die Geschichte des einzelnen geprägt. Erlebte Empfindungen, Eindrücke und Gefühle schreiben sich in den Körper ein und prägen das Körperbild, werden vom Körperbild getragen. Kleine Kinder entwickeln ihr Körperbild, noch bevor sie ihren Narzissmus entwickelt haben, noch bevor sie „ich“ sagen können. Auch gelähmte Kinder, also physisch eingeschränkte Kinder, entwickeln ein eigenes Körperbild, nehmen sich in ihrem Körper durch Bewegung war, obwohl ihr Körperschema stark beschädigt ist. So wird die Unabhängigkeit zwischen beiden deutlich. Ein Mensch mit einem verletzten Körperschema muss nicht ein beschädigtes Körperbild haben. Umgekehrt hat ein verletztes Körperbild nicht zwangsläufig die Schädigung des Körperschemas zur Folge.
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- II. Hauptteil
- 1. Definitionen Körperbild und Körperschema
- 2. Geschichte und Entwicklung des Körperbildes
- 2.1 Das Körperbild der Antike
- 2.2 Körperbilder im Mittelalter
- 2.3 Die Körperbilder der Neuzeit
- 2.4 Körperbilder in der heutigen Gesellschaft
- 3. Das kindliche Körperbild
- 3.1 Die Phasen der Kastration
- 3.2 Essstörung bei Kindern und Jugendlichen
- 3.3 Fettsucht bei Kindern
- III. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Entwicklung und die verschiedenen Ausprägungen von Körperbildern im Laufe der Geschichte und in der heutigen Gesellschaft. Ein besonderes Augenmerk liegt auf dem kindlichen Körperbild und den damit verbundenen Problemen wie Essstörungen und Fettsucht. Ziel ist es, ein Verständnis für die Komplexität des Körperbildes und dessen Einfluss auf die individuelle Wahrnehmung und das Wohlbefinden zu entwickeln.
- Definition und Abgrenzung von Körperbild und Körperschema
- Historische Entwicklung des Körperbildes von der Antike bis in die Neuzeit
- Das Körperbild in der heutigen Gesellschaft
- Das kindliche Körperbild und seine Entwicklung
- Essstörungen und Fettsucht im Kindes- und Jugendalter
Zusammenfassung der Kapitel
I. Einleitung: Die Einleitung skizziert die zentralen Fragestellungen der Arbeit. Sie erläutert die Notwendigkeit, die Begriffe "Körperbild" und "Körperschema" zu definieren und voneinander abzugrenzen. Weiterhin wird die Absicht formuliert, die historische Entwicklung von Körperbildern nachzuzeichnen und das kindliche Körperbild mit seinen potenziellen Störungen im Fokus zu betrachten. Die steigende Anzahl von Essstörungen bei Kindern und Jugendlichen wird als Anlass für eine detailliertere Untersuchung genannt.
II. Hauptteil: Der Hauptteil gliedert sich in drei Abschnitte. Zuerst werden Körperbild und Körperschema definiert und ihre Unterschiede herausgearbeitet: Das Körperschema ist artspezifisch, das Körperbild hingegen individuell und durch persönliche Erfahrungen geprägt. Im zweiten Abschnitt wird die Geschichte des Körperbildes von der Antike bis in die Gegenwart behandelt. Die Antike wird durch eine ambivalenten Haltung zum Körper und die Aussetzung von Kindern charakterisiert, während das Mittelalter vom Einfluss des Mönchtums und einem zunehmenden Fokus auf Enthaltsamkeit geprägt war. Der letzte Abschnitt untersucht das kindliche Körperbild, wobei die Entwicklungsphasen, Essstörungen und Fettsucht bei Kindern und Jugendlichen im Detail beleuchtet werden.
Schlüsselwörter
Körperbild, Körperschema, Antike, Mittelalter, Neuzeit, kindliches Körperbild, Essstörung, Fettsucht, Körperwahrnehmung, historische Entwicklung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Entwicklung und Ausprägungen von Körperbildern
Was ist der Inhalt dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Entwicklung und verschiedenen Ausprägungen von Körperbildern im Laufe der Geschichte und in der heutigen Gesellschaft. Ein besonderes Augenmerk liegt auf dem kindlichen Körperbild und den damit verbundenen Problemen wie Essstörungen und Fettsucht. Die Arbeit beinhaltet eine Einleitung, einen Hauptteil mit Definitionen, historischer Entwicklung und Betrachtung des kindlichen Körperbildes, sowie ein Fazit.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themen: Definition und Abgrenzung von Körperbild und Körperschema; Historische Entwicklung des Körperbildes von der Antike bis in die Neuzeit (Antike, Mittelalter, Neuzeit, heutige Gesellschaft); Das kindliche Körperbild und seine Entwicklung; Essstörungen und Fettsucht im Kindes- und Jugendalter.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit ist in drei Hauptteile gegliedert: Einleitung, Hauptteil und Fazit. Der Hauptteil unterteilt sich in Abschnitte zu Definitionen von Körperbild und Körperschema, der historischen Entwicklung des Körperbildes und dem kindlichen Körperbild mit Fokus auf Essstörungen und Fettsucht. Die Einleitung skizziert die zentralen Fragestellungen, während das Fazit die Ergebnisse zusammenfasst.
Was sind die wichtigsten Ergebnisse der Arbeit bezüglich des Körperbildes in der Geschichte?
Die Arbeit beschreibt eine ambivalente Haltung zum Körper in der Antike, den Einfluss des Mönchtums und die Betonung von Enthaltsamkeit im Mittelalter und die Entwicklung des Körperbildes in der Neuzeit und der heutigen Gesellschaft. Die Entwicklung wird als komplex und von verschiedenen kulturellen und gesellschaftlichen Faktoren beeinflusst dargestellt.
Wie wird das kindliche Körperbild behandelt?
Der kindliche Körperbild wird im Detail untersucht, inklusive der Entwicklungsphasen, Essstörungen und Fettsucht bei Kindern und Jugendlichen. Die steigende Anzahl von Essstörungen wird als Anlass für eine detailliertere Untersuchung genannt. Die Arbeit beschreibt die Phasen der Kastration, Essstörungen und Fettsucht bei Kindern als relevante Aspekte des kindlichen Körperbildes.
Welche Schlüsselbegriffe sind relevant für diese Arbeit?
Die wichtigsten Schlüsselbegriffe sind: Körperbild, Körperschema, Antike, Mittelalter, Neuzeit, kindliches Körperbild, Essstörung, Fettsucht, Körperwahrnehmung, historische Entwicklung.
Wie werden Körperbild und Körperschema definiert und abgegrenzt?
Das Körperschema wird als artspezifisch definiert, während das Körperbild als individuell und durch persönliche Erfahrungen geprägt beschrieben wird. Die Arbeit betont den Unterschied zwischen diesen beiden Begriffen.
- Arbeit zitieren
- Anonym (Autor:in), 2005, Körperbilder und Körperwelten, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/93626