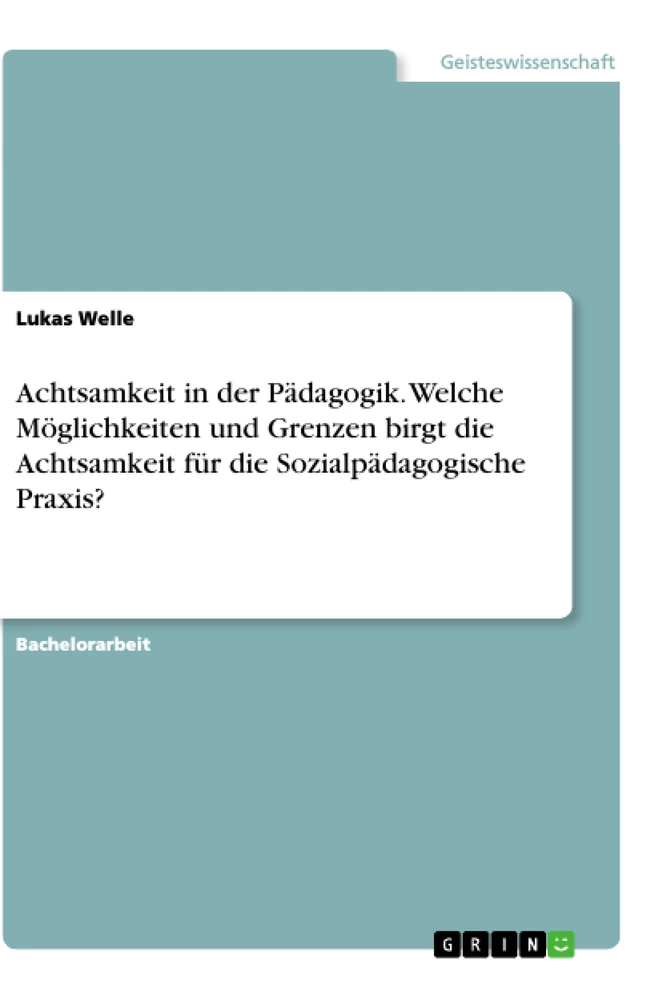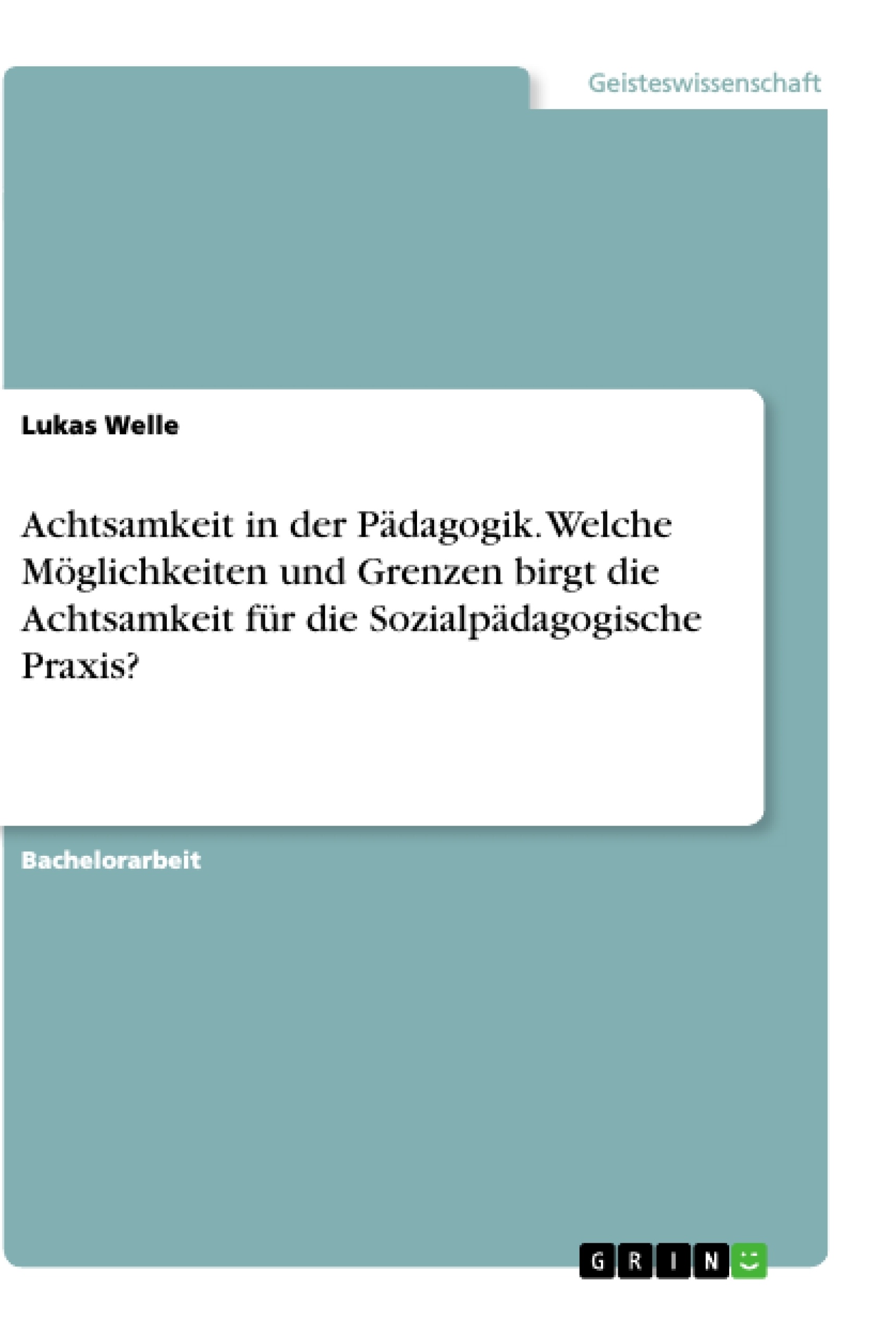Bei der vorliegenden Bachelorarbeit handelt es sich um eine kritische Auseinandersetzung des aufkommenden Achtsamkeitshypes im Zusammenhang mit der (Sozial-) pädagogischen Praxis. Es wird erläutert, was es mit der
"Achtsamkeit" auf sich hat, wieso dieser Hype besteht und welche gesellschaftlichen Folgen hieraus resultieren. Anschließend wird beleuchtet, inwiefern die Achtsamkeit (Mindfulness) einen Einfluss auf die Sozialpädagogische Praxis hat und welche Möglichkeiten und Grenzen daraus resultieren.
Wir leben im Jahre 2020 in einer schnelllebigen, technisierten und ökonomisierten Gesellschaft. In einem Alltag, der uns mit ausdifferenzierten Bereichen konfrontiert und unterschiedliche Rollenanforderungen an uns stellt, der nicht selten einen sehr hohen Handlungsdruck fordert und einfordert, dass man sich durch seine Tätigkeiten entfremdet. Daher hat der Autor den Eindruck, dass es für Ihn selbst und für die meisten anderen Menschen, in vielen Situationen sehr schwierig ist vollkommen geistesgegenwärtig zu sein. Dass also die Fähigkeit mit seiner ungeteilten Aufmerksamkeit im Hier und Jetzt zu bleiben, allgemein in unserer Gesellschaft immer mehr schwindet. So ist ein Pädagoge/ eine Pädagogin bspw. von Gedanken oder Gefühlen des privaten Lebens, oder auch von den Belastungen des beruflichen Alltags abgelenkt, anstatt bewusst die Situation, die Lage des Heranwachsenden und die eigene Konstitution in diesem Moment wahrzunehmen, was den pädagogischen Blick und den Bezug zu den Kindern oder Jugendlichen, doch auch den klaren Blick auf die Gesamtsituation, samt ihrer inklusiven Eigenarten, Möglichkeiten, Risiken und Grenzen aber auch Schönheiten verschwimmen lässt. Achtsamkeit im Sinne von Fürsorge (Care) und die Achtsamkeit im Sinne von Mindfulness sind Grundvoraussetzungen für pädagogische Arbeit, welche in der Praxis, aufgrund innerpsychischer und äußerer Strukturen nicht immer gegeben sind. Seiner Auffassung nach stellt die Achtsamkeitspraxis (Mindfulness) eine Antwortmöglichkeit dar, die eine umfassende Hilfestellung für SozialarbeiterInnen/SozialpädagogInnen anbietet und zur Professionalisierung Sozialer Arbeit beiträgt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- 1. Grundlegendes zur Achtsamkeit
- 1.1 - Geschichte und Entwicklung von Achtsamkeit
- 1.2 - Klärung des Gegenstandbereichs von Achtsamkeit
- 1.3 Achtsamkeitstraining
- 1.3.1 - Formen formaler Achtsamkeit
- 1.4 - Gesundheitliche Folgen der Achtsamkeitspraxis
- 1.4.1 - Der, Autopilotmodus'
- 1.4.2 - Stressreduktion durch Achtsamkeit - Mit Bezug auf das MBSR- Programm
- 2. Einblicke in Gesellschaftliche Diskurse um Achtsamkeit
- 2.1 Therapeutisierung der Gesellschaft
- 2.1.1 - Das Beispiel der Positiven Psychologie
- 2.1.2 - die Ökonomisierung der Positiven Psychologie
- 2.2 - Achtsamkeit im Kontext der Optimierung des Selbst
- 2.2.1 Achtsamkeit und Moral – Kalte Achtsamkeit
- 2.3 Zunehmender Druck in der Sozialpädagogischen Praxis
- 2.3.1 - Sozialkulturelle Rahmenbedingung: Wirtschaftliche Verwobenheit
- 2.3.2 Therapeutisierung der Sozialen Arbeit - Am Beispiel der Jugendhilfe
- 2.3.3 Stressoren und Belastungen in der Sozialpädagogischen Praxis
- 2.4 - Achtsamkeit - Eine naive Anpassung an bestehende Verhältnisse?
- 3. Achtsamkeit in der sozialpädagogischen Praxis
- 3.1 Klärung und Gegenstand
- 3.1.1 Pädagogik
- 3.1.2 Sozialpädagogik/ Soziale Arbeit
- 3.2 Sozialpädagogisches Handeln und Achtsamkeit
- 3.2.1 Achtsamkeit in der Lebensweltorientierung
- 3.2.2 Achtsamkeit in der Beziehungsarbeit
- 4. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Frage, welche Möglichkeiten und Grenzen die Achtsamkeit (Mindfulness) für die Sozialpädagogische Praxis bietet. Sie analysiert die Geschichte und Entwicklung der Achtsamkeit, klärt den Gegenstandsbereich und beschreibt die verschiedenen Formen des Achtsamkeitstrainings. Zudem werden die gesundheitlichen Folgen der Achtsamkeitspraxis und deren Auswirkungen auf Stressreduktion beleuchtet.
- Die Relevanz der Achtsamkeit im Kontext der aktuellen gesellschaftlichen Entwicklungen, insbesondere der Therapeutisierung und Ökonomisierung.
- Die Herausforderungen der Achtsamkeitspraxis im Spannungsfeld zwischen Selbstoptimierung und moralischer Verantwortung.
- Die Anwendungsmöglichkeiten und Grenzen der Achtsamkeit in der Sozialpädagogischen Praxis, insbesondere in der Lebensweltorientierung und Beziehungsarbeit.
- Die kritische Auseinandersetzung mit der Achtsamkeit als Instrumentarium zur Anpassung an bestehende gesellschaftliche Verhältnisse.
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik der Achtsamkeit in der Sozialpädagogischen Praxis ein und skizziert den aktuellen gesellschaftlichen Kontext. Kapitel 1 beleuchtet die grundlegenden Aspekte der Achtsamkeit, darunter ihre Geschichte, den Gegenstandsbereich und die verschiedenen Formen des Achtsamkeitstrainings. Kapitel 2 analysiert die gesellschaftlichen Diskurse um die Achtsamkeit, insbesondere im Hinblick auf die Therapeutisierung und Ökonomisierung der Gesellschaft.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den Schlüsselbegriffen Achtsamkeit (Mindfulness), Sozialpädagogik, Lebensweltorientierung, Beziehungsarbeit, Therapeutisierung, Ökonomisierung, Selbstoptimierung, Stressreduktion, und gesellschaftliche Diskurse.
Häufig gestellte Fragen
Was bedeutet Achtsamkeit im Kontext der Sozialpädagogik?
Achtsamkeit (Mindfulness) wird als Fähigkeit verstanden, im Hier und Jetzt präsent zu sein. Sie dient als Hilfsmittel für Fachkräfte, um Belastungen besser zu bewältigen und den pädagogischen Blick zu schärfen.
Welche Kritik gibt es am aktuellen „Achtsamkeitshype“?
Kritiker warnen vor einer „Therapeutisierung“ und „Ökonomisierung“ der Achtsamkeit, bei der sie lediglich zur Selbstoptimierung oder zur naiven Anpassung an schwierige Arbeitsbedingungen genutzt wird.
Wie hilft Achtsamkeit bei Stressreduktion?
Durch Programme wie MBSR (Mindfulness-Based Stress Reduction) lernen Praktizierende, den „Autopilotmodus“ zu verlassen und bewusster mit Stressoren umzugehen.
Was ist „kalte Achtsamkeit“?
Dieser Begriff beschreibt eine Achtsamkeitspraxis, die rein technisch zur Leistungssteigerung eingesetzt wird, ohne ethische oder moralische Verantwortung zu berücksichtigen.
Welche Rolle spielt Achtsamkeit in der Beziehungsarbeit?
Achtsamkeit ermöglicht eine tiefere Präsenz in der Interaktion mit Kindern und Jugendlichen, was die Qualität der pädagogischen Beziehung und die Wahrnehmung der Bedürfnisse des Gegenübers verbessert.
- Quote paper
- Lukas Welle (Author), 2020, Achtsamkeit in der Pädagogik. Welche Möglichkeiten und Grenzen birgt die Achtsamkeit für die Sozialpädagogische Praxis?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/936313