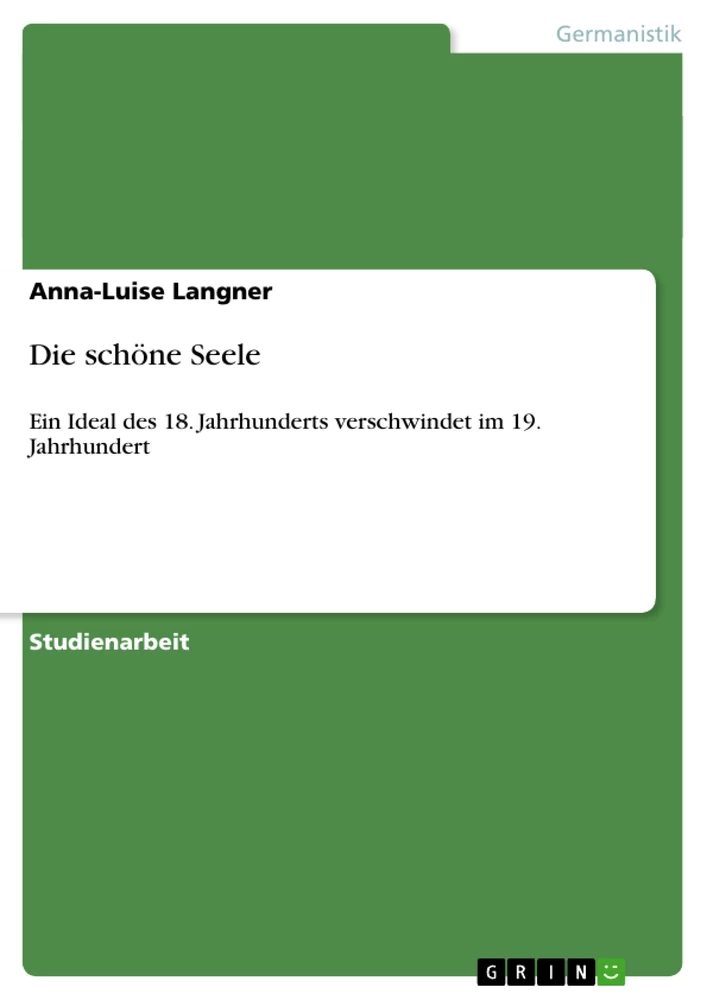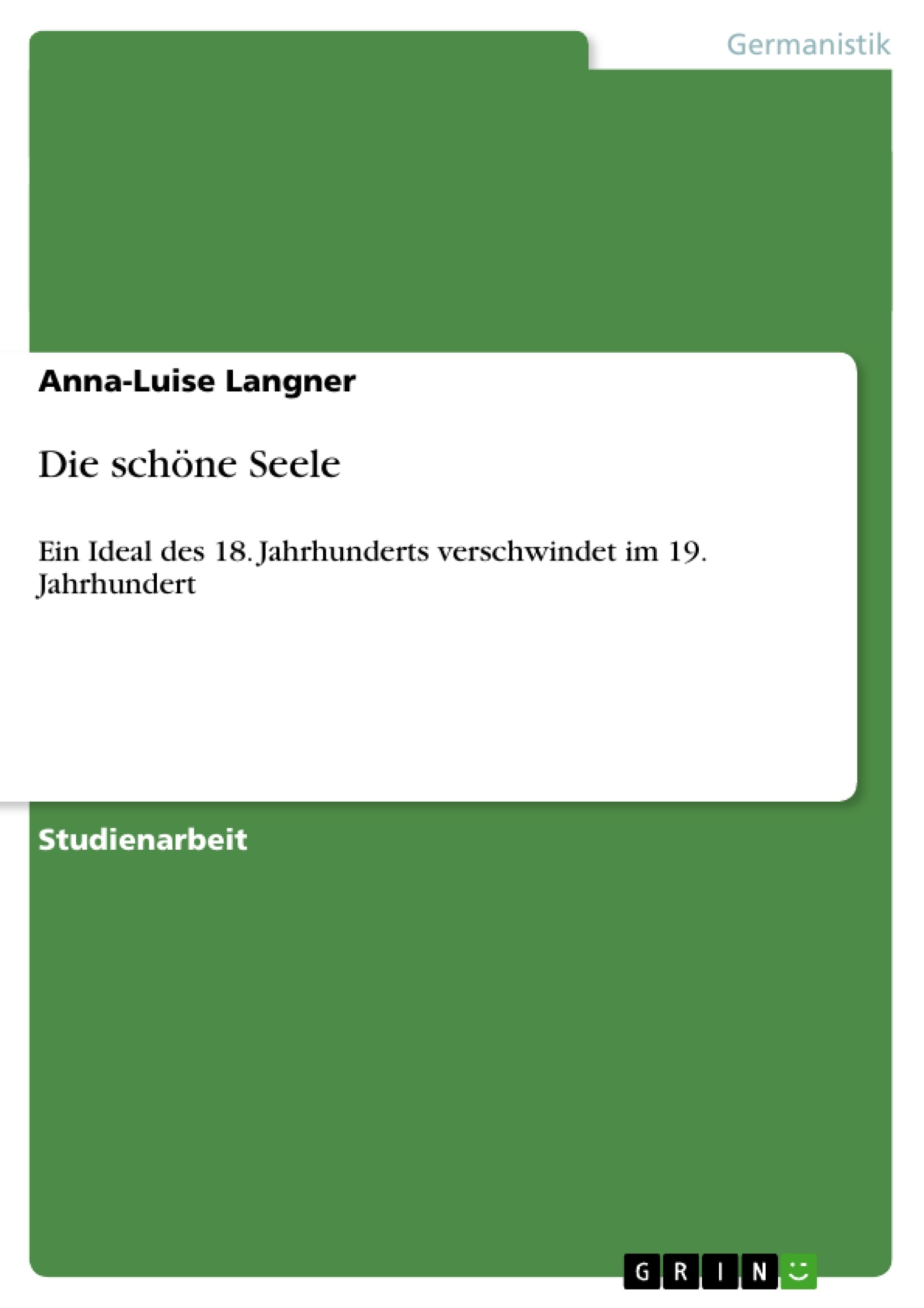Im Folgenden möchte ich mich dem Ideal der „schönen Seele“ im 18. Jahrhundert sowie seinem Verlust im 19. Jahrhundert widmen. Anhand der Aufklärung untersuche ich zunächst, in welchen literarischen Strömungen und Werken die schöne Seele im 18. Jahrhundert präsent ist. Mit der Definition der schönen Seele in Schillers ästhetischen Schriften erfährt das Ideal seinen Höhepunkt in der Klassik. Deshalb analysiere ich Schillers „Über Anmuth und Würde“ hinsichtlich der Konzeption der schönen Seele sowie Goethes „Bekenntnisse einer schönen Seele“ als literarische Darstellung derselben. Abschließend werde ich den Wandel Anfang des 19. Jahrhunderts thematisieren, wo das Konzept der „schönen Seele“ verschwindet bzw. als gescheitert gilt. Dies wird vor allem anhand von Kleist nachgewiesen, wobei die Philosophie des 19. Jahrhunderts mit Hegel und Nietzsche ebenfalls mit einbezogen wird.
Dieses in der Forschung viel untersuchte Thema kann philosophisch, literaturwissenschaftlich oder auch gesellschaftspsychologisch angegangen werden. Ich werde philosophisch-ästhetische Strömungen in die Betrachtung der „schönen Seele“ mit einbeziehen, mich aber hauptsächlich der literaturwissenschaftlichen Darstellung und Analyse widmen. Daher werden die allgemeinen gesellschaftlichen Umstände sowie der feministische Standpunkt der Literaturwissenschaft nur eingangs eine Rolle spielen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die schöne Seele aus feministischer Sicht
- Die schöne Seele in der Aufklärung
- Die schöne Seele im Rokoko
- Die schöne Seele in der Empfindsamkeit
- Die schöne Seele als Aufklärungskritik
- Die schöne Seele in der Klassik
- Schiller und die schöne Seele
- Goethe und die schöne Seele
- Der Verlust der schönen Seele
- Kleist und die schöne Seele
- Absage an die schöne Seele
- Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit befasst sich mit dem Ideal der „schönen Seele“ im 18. Jahrhundert und seinem Verlust im 19. Jahrhundert. Die Arbeit analysiert die Präsenz des Konzepts in verschiedenen literarischen Strömungen und Werken des 18. Jahrhunderts, untersucht den Höhepunkt des Ideals in Schillers „Über Anmuth und Würde“ und Goethes „Bekenntnisse einer schönen Seele“, und beleuchtet schließlich den Wandel im 19. Jahrhundert, wo das Konzept der „schönen Seele“ als gescheitert gilt, insbesondere anhand von Kleists Werken.
- Die Entwicklung des Konzepts der „schönen Seele“ in der Aufklärung
- Die Rolle der „schönen Seele“ im Rokoko und in der Empfindsamkeit
- Die ästhetische Konzeption der „schönen Seele“ bei Schiller und Goethe
- Der Verlust des Ideals im 19. Jahrhundert anhand von Kleist
- Die philosophischen und literarischen Strömungen, die den Wandel des Ideals beeinflussen
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung definiert den Begriff der „schönen Seele“ und stellt die Forschungsfrage nach seinem Verlust im 19. Jahrhundert.
- Die „schöne Seele“ aus feministischer Sicht: Dieses Kapitel beleuchtet die gesellschaftlichen Veränderungen im 18. Jahrhundert und die daraus resultierenden Möglichkeiten für Frauen in der literarischen Öffentlichkeit.
- Die schöne Seele in der Aufklärung: Dieses Kapitel untersucht die verschiedenen Facetten der „schönen Seele“ im Kontext der Aufklärung, einschließlich ihrer Präsenz im Rokoko und in der Empfindsamkeit.
- Die schöne Seele in der Klassik: Dieses Kapitel analysiert die ästhetische Konzeption der „schönen Seele“ bei Schiller und Goethes „Bekenntnisse einer schönen Seele“.
- Der Verlust der schönen Seele: Dieses Kapitel thematisiert den Wandel Anfang des 19. Jahrhunderts, wo das Konzept der „schönen Seele“ verschwindet bzw. als gescheitert gilt, insbesondere anhand von Kleist.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den zentralen Begriffen der „schönen Seele“, der Aufklärung, der Empfindsamkeit, der Klassik, der Literaturgeschichte, dem Ideal der Tugendhaftigkeit, der Philosophie, der Ästhetik, der Gender Studies und der Literaturkritik.
- Citation du texte
- Anna-Luise Langner (Auteur), 2007, Die schöne Seele, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/93644