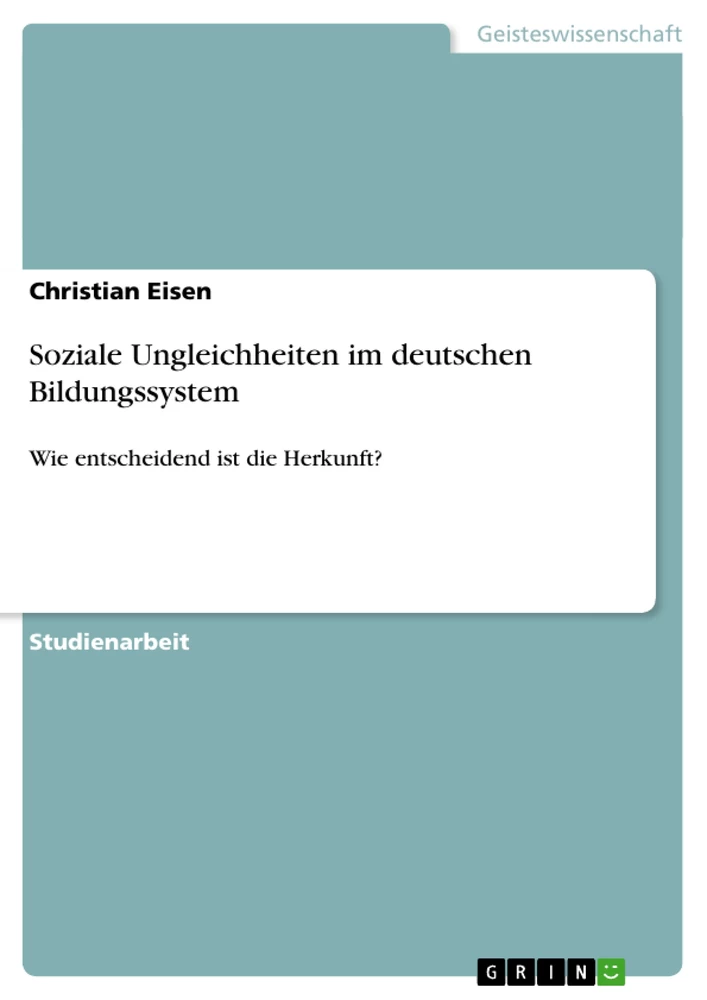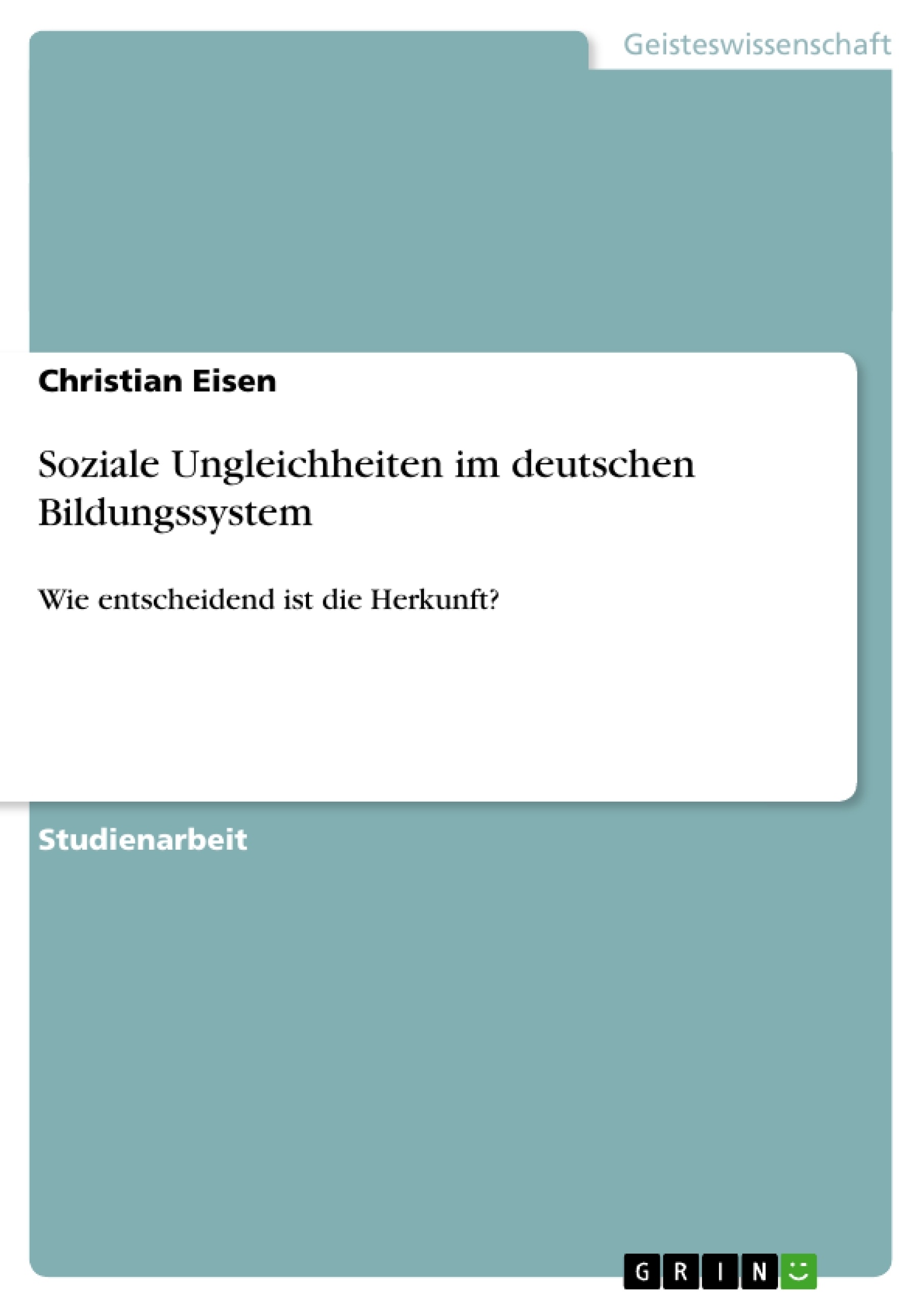„Jeder junge Mensch hat ein Recht auf Förderung seiner Entwicklung und auf Erziehung zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit.“ Soweit die Theorie. Doch in der Praxis wird die angesprochene Verwirklichung durch soziale Ungleichheiten und Armut behindert. Das Bildungswesen in Deutschland ist wie in fast keinem anderen Land sehr starken sozialen Selektionsprozessen unterworfen. Die Kinderarmut hat in den letzten Jahren immer weiter zugenommen, so dass die sozialen Unterschiede größer geworden sind. Schon die Bildungsexpansion in den 60er Jahren hatte es sich zur Aufgabe gemacht, die sozialen Ungleichheiten im Bildungswesen zu beseitigen – allerdings vergeblich. Die letzten PISA- Ergebnisse haben dies noch einmal sehr deutlich bestätigt. Doch wie entscheidend ist die soziale Herkunft wirklich? Können die Mechanismen der sozialen Selektion nicht überwunden werden, um allen Kindern die gleichen Chancen zu ermöglichen? Nach wie vor spielen die soziale und ethnische Herkunft eine große Rolle, was die Bildungschancen der Kinder betrifft.
Ein weiteres Problem ist die Reproduktion von Bildungsungleichheit. Diese „Weitervererbung“ der Bildungschancen ist erschreckend hoch. Kinder aus Familien mit einem höheren sozialen Status haben vergleichsweise größere Chancen, das Gymnasium zu besuchen als Kinder aus unteren sozialen Schichten. Das macht sich vor allem in den ausgesprochenen Schulempfehlungen am Ende der Klasse 4 bemerkbar. Kinder mit höherem sozialen Status bekommen häufiger Gymnasialempfehlungen als Kinder aus anderen Schichten. Viele Ganztagsschulen haben es sich mittlerweile zur Aufgabe gemacht, diese Chancenungleichheit zu beseitigen. Die deutsch-italienische Gesamtschule in Wolfburg ist nur ein Beispiel, das im vierten Kapitel dieser Arbeit vorgestellt wird.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Soziale Selektion im Bildungswesen
- 2.1 Kinderarmut und sozialer Status
- 2.2 Bildungsexpansion
- 3. Das deutsche Bildungssystem
- 3.1 Benachteiligte Gruppen
- 3.1.1 Ungleichheit nach sozialer Herkunft
- 3.1.2 Ungleichheit nach ethnischer Herkunft
- 3.2 Reproduktion von Bildungsungleichheit
- 3.3 Schulempfehlungen
- 4. Ganztagsschulen als Versuch sozialer Überwindung
- 4.1 Nutzung der Ganztagsangebote
- 4.2 Ganztagsschulen als Integrationsort - Die deutsch-italienische Gesamtschule in Wolfsburg
- 5. Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht den Einfluss sozialer Herkunft auf den Bildungserfolg im deutschen Bildungssystem. Ziel ist es, die Mechanismen sozialer Selektion aufzuzeigen und die Frage zu beleuchten, inwieweit Ganztagsschulen als Mittel zur Überwindung sozialer Ungleichheiten dienen können.
- Soziale Ungleichheit im deutschen Bildungssystem
- Der Zusammenhang zwischen Kinderarmut und Bildungserfolg
- Die Rolle der Bildungsexpansion in den 60er Jahren
- Reproduktion von Bildungsungleichheit durch Schulempfehlungen
- Ganztagsschulen als Ansatz zur sozialen Integration
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung stellt die zentrale Forschungsfrage nach dem Einfluss der sozialen Herkunft auf den Bildungserfolg im deutschen Bildungssystem dar. Sie verweist auf den Widerspruch zwischen dem Anspruch auf gleiche Bildungschancen und der Realität sozialer Ungleichheit und benennt Kinderarmut und die Reproduktion von Bildungsungleichheit als zentrale Probleme. Die Arbeit kündigt die Untersuchung von Ganztagsschulen als mögliche Lösung an.
2. Soziale Selektion im Bildungswesen: Dieses Kapitel untersucht den starken Zusammenhang zwischen Kinderarmut und sozialer Selektion im Bildungssystem. Es zeigt auf, wie Kinder aus benachteiligten Familienverhältnissen einem erhöhten Armutsrisiko ausgesetzt sind, was sich negativ auf ihre Bildungschancen und späteren Lebensverläufe auswirkt. Der soziale Status der Eltern, insbesondere des Vaters, und deren Bildungsabschluss werden als entscheidende Faktoren für den Bildungserfolg des Kindes hervorgehoben. Die Bildungsexpansion der 60er Jahre wird als gescheiterter Versuch zur Minderung sozialer Ungleichheit analysiert.
3. Das deutsche Bildungssystem: Dieses Kapitel beschreibt die Benachteiligung verschiedener Gruppen im deutschen Bildungssystem. Es wird auf die ungleichen Bildungschancen aufgrund sozialer und ethnischer Herkunft eingegangen, wobei die Rolle von Schulempfehlungen und die Reproduktion von Bildungsungleichheit besonders hervorgehoben werden. Es wird angedeutet, dass schulische Leistungen nicht immer objektiv bewertet werden und auch nicht-schulische Faktoren eine Rolle spielen.
4. Ganztagsschulen als Versuch sozialer Überwindung: Das Kapitel präsentiert Ganztagsschulen als einen Ansatz zur Überwindung sozialer Ungleichheiten im Bildungssystem. Es beleuchtet die Nutzung von Ganztagsangeboten und stellt die deutsch-italienische Gesamtschule in Wolfsburg als Beispiel für eine integrative Schule vor, die versucht, Chancengleichheit zu fördern. Der Fokus liegt auf der Rolle von Ganztagsschulen als Integrationsorte.
Schlüsselwörter
Soziale Ungleichheit, Bildungssystem, Kinderarmut, soziale Selektion, Bildungsexpansion, Schulempfehlungen, Ganztagsschule, Integration, soziale Herkunft, ethnische Herkunft, Bildungschancen.
Häufig gestellte Fragen zur Hausarbeit: Soziale Selektion und Bildungserfolg
Was ist das zentrale Thema der Hausarbeit?
Die Hausarbeit untersucht den Einfluss der sozialen Herkunft auf den Bildungserfolg im deutschen Bildungssystem. Sie beleuchtet die Mechanismen sozialer Selektion und analysiert, inwieweit Ganztagsschulen zur Überwindung sozialer Ungleichheiten beitragen können.
Welche Aspekte der sozialen Selektion werden behandelt?
Die Arbeit behandelt den starken Zusammenhang zwischen Kinderarmut und sozialer Selektion, die Rolle des sozialen Status der Eltern (insbesondere des Vaters) und deren Bildungsabschluss für den Bildungserfolg des Kindes. Die gescheiterte Bildungsexpansion der 60er Jahre wird ebenfalls analysiert.
Welche Rolle spielt das deutsche Bildungssystem in der Hausarbeit?
Die Hausarbeit beschreibt die Benachteiligung verschiedener Gruppen im deutschen Bildungssystem aufgrund sozialer und ethnischer Herkunft. Die Rolle von Schulempfehlungen und die Reproduktion von Bildungsungleichheit werden besonders hervorgehoben. Die Arbeit deutet an, dass schulische Leistungen nicht immer objektiv bewertet werden und auch nicht-schulische Faktoren eine Rolle spielen.
Wie werden Ganztagsschulen im Kontext sozialer Ungleichheit betrachtet?
Ganztagsschulen werden als Ansatz zur Überwindung sozialer Ungleichheiten präsentiert. Die Arbeit beleuchtet die Nutzung von Ganztagsangeboten und untersucht am Beispiel der deutsch-italienischen Gesamtschule in Wolfsburg, wie integrative Schulen Chancengleichheit fördern können.
Welche konkreten Forschungsfragen werden in der Einleitung gestellt?
Die Einleitung formuliert die zentrale Forschungsfrage nach dem Einfluss der sozialen Herkunft auf den Bildungserfolg. Sie thematisiert den Widerspruch zwischen dem Anspruch auf gleiche Bildungschancen und der Realität sozialer Ungleichheit, benennt Kinderarmut und die Reproduktion von Bildungsungleichheit als zentrale Probleme und kündigt die Untersuchung von Ganztagsschulen als mögliche Lösung an.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Hausarbeit?
Schlüsselwörter sind: Soziale Ungleichheit, Bildungssystem, Kinderarmut, soziale Selektion, Bildungsexpansion, Schulempfehlungen, Ganztagsschule, Integration, soziale Herkunft, ethnische Herkunft, Bildungschancen.
Welche Kapitel beinhaltet die Hausarbeit und worum geht es in diesen?
Die Hausarbeit umfasst folgende Kapitel: 1. Einleitung: Einführung in die Thematik und Forschungsfrage. 2. Soziale Selektion im Bildungswesen: Zusammenhang zwischen Kinderarmut und Bildungserfolg. 3. Das deutsche Bildungssystem: Benachteiligung verschiedener Gruppen und Reproduktion von Ungleichheit. 4. Ganztagsschulen als Versuch sozialer Überwindung: Ganztagsschulen als Ansatz zur sozialen Integration. 5. Zusammenfassung: Zusammenfassung der Ergebnisse.
- Citation du texte
- Christian Eisen (Auteur), 2008, Soziale Ungleichheiten im deutschen Bildungssystem, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/93655