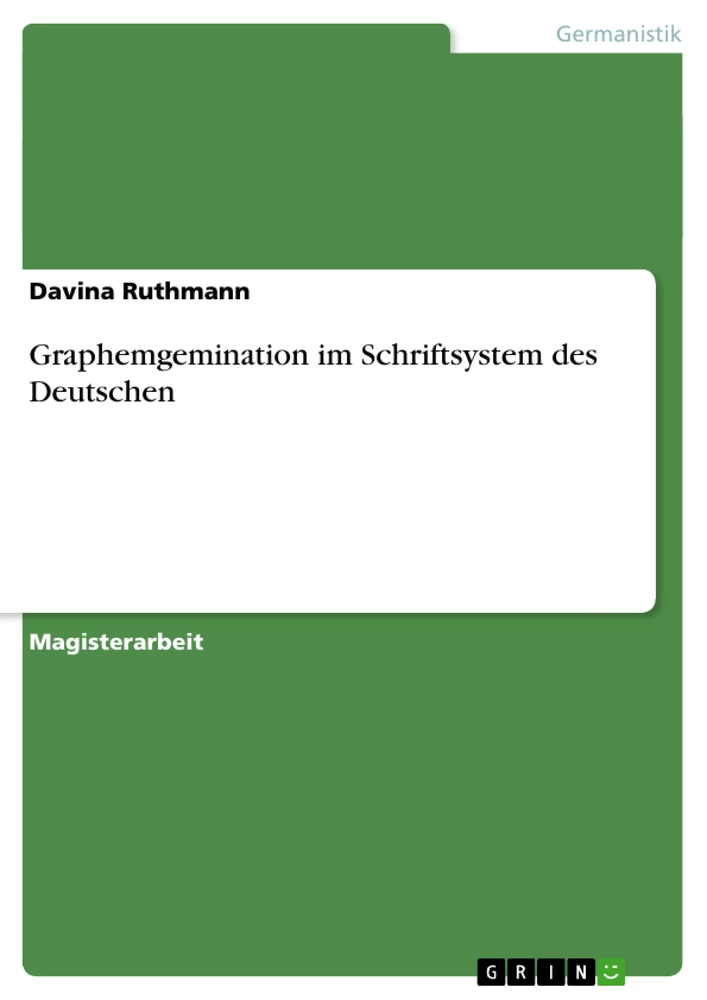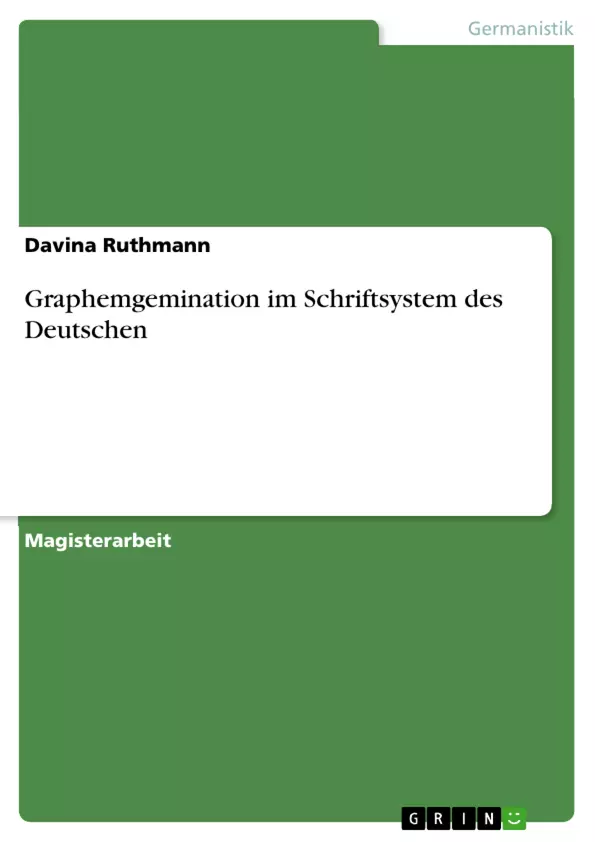Auszug aus dem Gutachten: "Frau Ruthmann (im folgenden R) untersucht in ihrer exzellenten Magisterarbeit eines der umstrittensten Phänomene des deutschen Schriftsystems: die Gemination von Konsonantengraphemen, der keine phonologische Doppelkonsonanz entspricht, also Schreibungen wie <schnell>, <bellen>, <virtuell> usw. Genauer gesagt diskutiert, vergleicht und bewertet sie die drei wichtigsten Ansätze zur Beschreibung und Erklärung dieses Phänomens, die sich vor allem dadurch unterscheiden, welche phonologischen Eigenschaften als Auslöser für die Konsonantengraphemgemination (im folgenden KGG) betrachtet werden. Sie kommt zu dem Ergebnis, daß einer der Ansätze, die silbenschnittbasierte Erklärung, den anderen beiden vorzuziehen ist. Da dieses Ergebnis auf der Grundlage einer außerordentlich sorgfältigen, umfassenden und fairen Diskussion der Vor- und Nachteile der drei Positionen zustande kommt, kann es als gesichert gelten. Damit bringt R die Forschung zum deutschen Schriftsystem ein gutes Stück voran, denn bisher war es eher eine Geschmacksfrage (oder eine der Solidarität mit bestimmten Personen oder Lagern), welche Theorie der KGG man bevorzugte."
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einführung
- 2. Der segmentbasierte Erklärungsansatz
- 2.1 Vorbemerkungen
- 2.2 Zur sogenannten Vokalopposition im Deutschen (Teil I)
- 2.3 Die Regularitäten der Graphemgemination
- 2.3.1 Restriktionen für Graphemgemination
- 2.4 Der Segmentansatz in orthographischen Regeltexten
- 2.5 Fremdwortintegration und segmentbasierter Ansatz
- 2.6 Bestimmung des Geltungsbereichs der Geminationsregel
- 2.6.1 Beschränkung auf Stamm- oder Wurzelmorpheme
- 2.6.2 Beschränkung auf Autosemantika
- 2.7 Ausnahmen und Problemfälle
- 2.7.1 Wörter mit undurchsichtiger morphologischer Struktur
- 2.7.1.1 Unikale Morpheme
- 2.7.1.2 Unproduktive Suffixe
- 2.7.2 Ausspracheschwankungen
- 2.7.3 Akzentwechsel
- 2.7.4 Vokalisch erweiterte Pluralformen mit Geminate
- 2.7.5 Fremdwortschreibungen
- 2.7.5.1 Simplex statt Geminate
- 2.7.5.2 Geminate statt Simplex
- 2.7.6 Graphemgeminaten an Morphemgrenzen
- 2.7.6.1 Graphemgeminaten als Assimilationsprodukte
- 2.7.1 Wörter mit undurchsichtiger morphologischer Struktur
- 3. Der silbengelenkbasierte Erklärungsansatz
- 3.1 Vorbemerkungen
- 3.2 Silbische Schreibungen
- 3.3 Zur sogenannten Vokalopposition im Deutschen (Teil II)
- 3.4 Die Repräsentation von Silbengelenken
- 3.4.1 Die Kernsilbe als minimale Silbenstruktur
- 3.4.2 Ambisyllabizität als Folge zweier silbenstruktureller Bedingungen
- 3.5 Silbengelenke: Graphematische Entsprechung
- 3.5.1 Graphemgeminaten und Stützformen
- 3.5.2 Kopierregel anstelle von Stützformen
- 3.5.3 Der Geltungsbereich der Geminationsregel im Gelenkansatz
- 3.6 Der Silbengelenkansatz in orthographischen Regeltexten
- 3.6.1 Der Regelvorschlag von Augst / Eisenberg
- 3.6.2 Die Tradition des silbenbasierten Ansatzes in der Orthographie
- 3.6.3 Silbentrennung
- 3.6.3.1 Syllabierung, Gelenkschreibung und Intuition
- 3.7 Fremdwortintegration und silbengelenkbasierter Ansatz
- 3.8 Ausnahmen und Problemfälle
- 3.8.1 Die Suche nach vokalisch erweiterten Stützformen
- 3.8.2 Das morphematische Prinzip in Anglizismen
- 3.8.3 Silbengelenke zwischen Nebenton- und Reduktionssilben
- 4. Der silbenschnittbasierte Erklärungsansatz
- 4.1 Vorbemerkungen
- 4.2 Tradition des Silbenschnittkonzepts
- 4.3 Zur sogenannten Vokalopposition im Deutschen (Teil III)
- 4.3.1 Das phonetische Korrelat der Silbenschnittopposition
- 4.3.2 Das phonologische Konzept des Silbenschnitts
- 4.4 Die Repräsentation der Silbenschnittopposition
- 4.5 Silbenschnitt: Graphematische Entsprechung
- 4.5.1 Das doppelte Konsonantengraphem als „Bremszeichen“
- 4.5.2 Graphemgeminate und Implosionsposition
- 4.6 Ausnahmen und Problemfälle
- 4.7 Die Silbenschnittopposition am Schriftanfang
- 5. Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Magisterarbeit untersucht die Graphemgemination im deutschen Schriftsystem. Ziel ist es, verschiedene Erklärungsansätze zu analysieren und zu vergleichen. Die Arbeit beleuchtet die komplexen Beziehungen zwischen Phonologie und Orthographie im Deutschen.
- Der segmentbasierte Ansatz zur Erklärung der Graphemgemination
- Der silbengelenkbasierte Ansatz zur Erklärung der Graphemgemination
- Der silbenschnittbasierte Ansatz zur Erklärung der Graphemgemination
- Ausnahmen und Problemfälle der Graphemgemination
- Vergleich der verschiedenen Erklärungsansätze
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einführung: Dieses Kapitel führt in das Thema der Graphemgemination im Deutschen ein. Es beschreibt das phonographische Prinzip und die komplexen Beziehungen zwischen Schrift und Laut im Deutschen. Es wird deutlich gemacht, dass das deutsche Schriftsystem nicht rein phonemisch ist, sondern auch silbenstrukturelle, morphologische und syntaktische Informationen berücksichtigt. Das Kapitel legt den Grundstein für die folgenden Kapitel, die verschiedene Erklärungsansätze für die Graphemgemination untersuchen.
2. Der segmentbasierte Erklärungsansatz: Dieses Kapitel analysiert den segmentbasierten Ansatz zur Erklärung der Graphemgemination. Es untersucht die Regularitäten der Graphemgemination und deren Restriktionen. Ein besonderes Augenmerk liegt auf der Integration von Fremdwörtern und der Bestimmung des Geltungsbereichs der Geminationsregel. Das Kapitel beschreibt ausführlich Ausnahmen und Problemfälle, die mit dem segmentbasierten Ansatz nicht vollständig erklärt werden können, was die Notwendigkeit alternativer Ansätze unterstreicht.
3. Der silbengelenkbasierte Erklärungsansatz: Dieses Kapitel widmet sich dem silbengelenkbasierten Ansatz. Es erklärt die Rolle von Silbengelenken in der Schreibung und untersucht die graphematische Entsprechung von Silbengelenken. Der Geltungsbereich der Geminationsregel im Rahmen dieses Ansatzes wird detailliert analysiert, zusammen mit Ausnahmen und Problemfällen, die durch diesen Ansatz erklärt werden können, und solchen, die weiterhin ungeklärt bleiben.
4. Der silbenschnittbasierte Erklärungsansatz: Dieses Kapitel präsentiert den silbenschnittbasierten Ansatz zur Erklärung der Graphemgemination. Es beleuchtet die Tradition dieses Konzepts und analysiert die Repräsentation der Silbenschnittopposition auf graphischer Ebene. Die Rolle des doppelten Konsonantengraphems als "Bremszeichen" und die Implosionsposition werden ausführlich diskutiert. Auch hier werden Ausnahmen und Problemfälle im Kontext dieses Ansatzes untersucht.
Schlüsselwörter
Graphemgemination, Deutsches Schriftsystem, Phonologie, Orthographie, Segmentansatz, Silbengelenkansatz, Silbenschnittansatz, Graphem-Phonem-Korrespondenz, Morphologie, Fremdwörter, Ausnahmen, Problemfälle.
Häufig gestellte Fragen zur Magisterarbeit: Graphemgemination im Deutschen
Was ist der Gegenstand der Magisterarbeit?
Die Magisterarbeit untersucht die Graphemgemination (Doppelkonsonanz) im deutschen Schriftsystem. Sie analysiert und vergleicht verschiedene Erklärungsansätze für dieses orthographische Phänomen und beleuchtet die komplexen Beziehungen zwischen Phonologie und Orthographie im Deutschen.
Welche Erklärungsansätze für die Graphemgemination werden betrachtet?
Die Arbeit untersucht drei Hauptansätze: den segmentbasierten Ansatz, den silbengelenkbasierten Ansatz und den silbenschnittbasierten Ansatz. Jeder Ansatz wird detailliert beschrieben und anhand von Beispielen und Ausnahmen erläutert.
Was ist der segmentbasierte Ansatz?
Der segmentbasierte Ansatz erklärt die Graphemgemination auf der Ebene einzelner Sprachlaute (Segmente). Er untersucht die Regularitäten und Restriktionen der Doppelkonsonanz und betrachtet die Integration von Fremdwörtern. Dieser Ansatz stößt jedoch bei vielen Ausnahmen und Problemfällen an seine Grenzen.
Was ist der silbengelenkbasierte Ansatz?
Der silbengelenkbasierte Ansatz betrachtet die Silbenstruktur als Grundlage für die Erklärung der Graphemgemination. Er konzentriert sich auf die Rolle von Silbengelenken (der Übergang zwischen Silben) und deren graphematische Repräsentation. Auch dieser Ansatz kann nicht alle Fälle vollständig erklären.
Was ist der silbenschnittbasierte Ansatz?
Der silbenschnittbasierte Ansatz basiert auf dem Konzept des Silbenschnitts, also der Grenze zwischen zwei Silben. Er erklärt die Doppelkonsonanz als „Bremszeichen“ am Silbenende. Die Arbeit analysiert die phonologischen und graphischen Aspekte dieses Ansatzes und diskutiert seine Grenzen.
Welche Rolle spielen Ausnahmen und Problemfälle?
Ausnahmen und Problemfälle spielen eine zentrale Rolle in der Arbeit. Sie dienen dazu, die Stärken und Schwächen der verschiedenen Erklärungsansätze aufzuzeigen und die Komplexität des deutschen Schriftsystems zu verdeutlichen. Die Arbeit analysiert detailliert Wörter mit undurchsichtiger morphologischer Struktur, Ausspracheschwankungen, Akzentwechsel und Fremdwortschreibungen.
Wie werden die verschiedenen Ansätze verglichen?
Die Arbeit vergleicht die drei Ansätze systematisch, um ihre jeweiligen Vor- und Nachteile herauszuarbeiten. Der Vergleich zeigt, dass kein einzelner Ansatz alle Fälle der Graphemgemination vollständig erklären kann, und unterstreicht die Notwendigkeit einer ganzheitlicheren Betrachtungsweise.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel: eine Einleitung, drei Kapitel zu den einzelnen Erklärungsansätzen (segmentbasiert, silbengelenkbasiert, silbenschnittbasiert) und ein Schlusskapitel. Jedes Kapitel beinhaltet eine detaillierte Analyse des jeweiligen Ansatzes, inklusive Ausnahmen und Problemfällen.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Graphemgemination, Deutsches Schriftsystem, Phonologie, Orthographie, Segmentansatz, Silbengelenkansatz, Silbenschnittansatz, Graphem-Phonem-Korrespondenz, Morphologie, Fremdwörter, Ausnahmen, Problemfälle.
Für wen ist diese Arbeit relevant?
Diese Arbeit ist relevant für Linguisten, Orthographen, Germanisten und alle, die sich für die Komplexität des deutschen Schriftsystems interessieren. Sie bietet einen umfassenden Überblick über verschiedene Erklärungsansätze zur Graphemgemination und trägt zum Verständnis der Interaktion zwischen Phonologie und Orthographie bei.
- Citation du texte
- Davina Ruthmann (Auteur), 2008, Graphemgemination im Schriftsystem des Deutschen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/93676