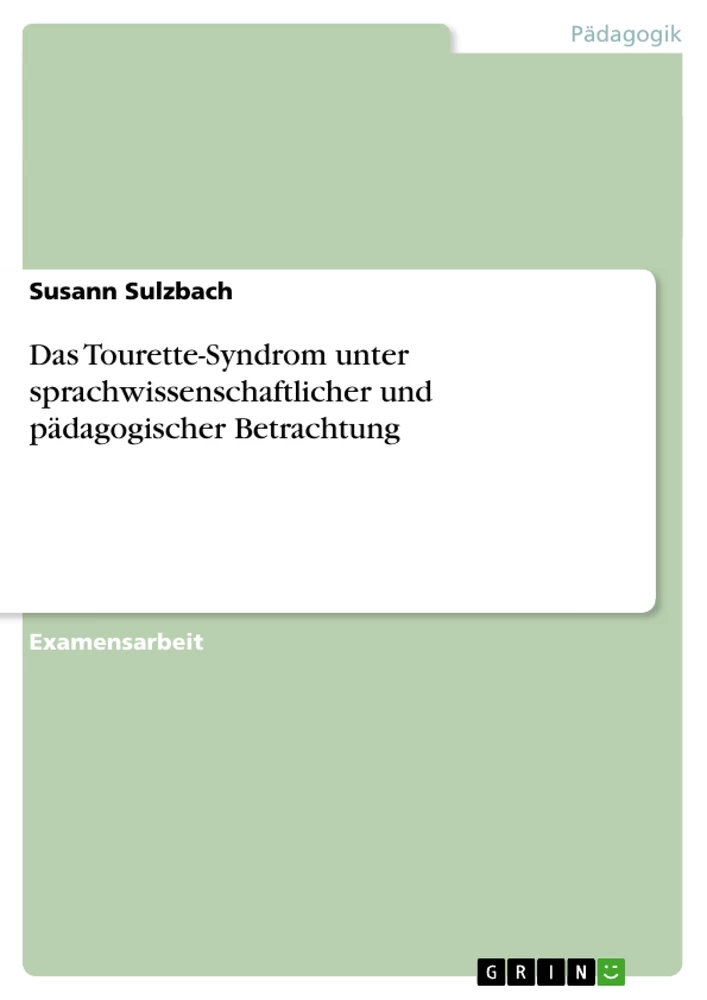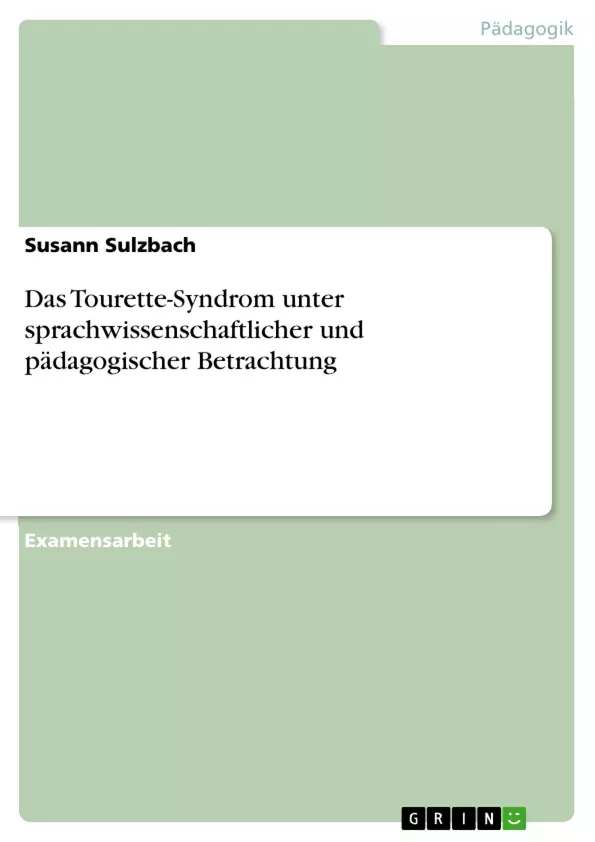Die Examensarbeit beschäftigt sich mit dem Tourette-Syndrom, wobei der Blickwinkel aus sprachlichen und förderpädagogischen Perspektiven erfolgt. Zielstellung meiner Arbeit ist, ein möglichst umfassendes Bild zum Tourette-Syndrom und somit einen Teil Aufklärungsarbeit zu leisten.
In der Arbeit werden zum Ersten geschichtliche Hintergründe sowie Paradigmenwechsel bei der Betrachtung des Syndroms im Laufe der Vergangenheit vorgestellt. Weiterhin werden differentialdiagnostisch das Störungsbild und der Krankheitsverlauf dargelegt. Auf vokale Tics und wissenschaftliche Studien in diesem Zusammenhang (syntaktische und andere sprachliche Aspekte) wird vertiefend eingegangen. Thematisiert werden außerdem Nebenerscheinungen des TS, wie z.B. ADHS, Depressionen, Auto-Aggressionen, Lernstörungen u.v.m. , sowie die aktuellen Ätiologiehypothesen der Erkrankung. Therapieansätze werden vorgestellt.
Ein großer Teil der Arbeit widmet sich der pädagogischen Arbeit mit TS-Kindern und stellt konkrete Handlungsmöglichkeiten für den Unterricht vor. Eine kritische Einschätzung der Maßnahmen wird vorgenommen. Zu diesem Kapitel gehören eine Fallbetrachtung und Meinungen von Betroffenen aus einem Tourette-Forum.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Historischer Blick auf das Tourette-Syndrom
- 3. Das Tourette-Syndrom – eine kurze Wesensbestimmung
- 3.1. Definition von Tics
- 3.2. Hauptmerkmale des Tourette-Syndroms
- 4. Differenzierte Betrachtung der Symptome unter sprachlicher Akzenturierung
- 4.1. Motorische Tics
- 4.1.1. Einfache motorische Tics
- 4.1.2. Komplexe motorische Tics
- 4.1.3. Häufigkeiten motorischer Tics
- 4.2. Vokale Tics - der sprachliche Aspekt des Tourette-Syndroms
- 4.2.1. Einfache vokale Tics
- 4.2.2. Komplexe vokale Tics
- 4.2.3. Koprolalie
- 4.2.4. Echolalie und Palilalie
- 4.2.5. Syntaktisches Auftreten der vokalen Tics
- 4.2.6. Abweichungen der sprachlichen Fähigkeiten bei Tourette-Patienten als Ansatzpunkt für sprachheilpädagogische Maßnahmen
- 4.2.7. Stottern und Tourette
- 4.1. Motorische Tics
- 5. Krankheitsverlauf
- 6. Begleiterscheinungen des Tourette-Syndroms und ihre sprachliche Dimension
- 6.1. Sprachliche und andere Zwänge, Zwangshandlungen und Zwangsgedanken
- 6.2. Depressivität, Aggressivität und selbstdestruktives Verhalten aufgrund ,andersartiger' Kommunikationsvoraussetzungen
- 6.3. Hyperkinetisches Syndrom
- 6.4. Lese-Rechtschreib-Schwäche und andere Lernstörungen
- 6.5. Überdurchschnittliche motorische, sprachliche und künstlerische Fähigkeiten
- 7. Ätiologie
- 7.1. Genetische Dispositionen
- 7.2. Organische Faktoren
- 7.2.1. Auffälligkeiten der subkortikalen Strukturen, insbesondere der Basalganglien
- 7.2.2. Imbalance der Neurotransmitter
- 7.2.3. Hirnanatomische Veränderungen und Auffälligkeiten im EEG
- 7.3. Modellvorstellungen zur Tic-Entstehung
- 8. Diagnostik unter förderpädagogischen und klinischen Gesichtspunkten
- 9. Behandlung des Tourette-Syndroms
- 9.1. Medikamentöse Behandlung
- 9.2. Verhaltenstherapeutische Behandlung, insbesondere das Habit Reversal Training
- 10. Fallbeispiel
- 10.1. Beschreibung des Vorgehens
- 10.2. Allgemeine Angaben zum Kind
- 10.3. Vorgeschichte und Umfeld
- 10.3.1. Informationen aus schriftlichen Quellen (Schülerakte) zum Störungsbild
- 10.3.2. Auswertung der Beobachtungen
- 10.3.3. Auswertung der Fragebögen der Mutter und der Klassenlehrerin
- 11. Förderpädagogische Interventionen bei Kindern mit Tourette-Syndrom
- 11.1. Schulerfahrungen von Personen mit TS
- 11.2. Die ,richtige' Schulform
- 11.3. Vorschläge zum (förder)pädagogischen Umgang mit dem Tourette-Syndrom
- 11.3.1. Leitlinien für den Unterricht bezüglich Aufmerksamkeitsproblemen, sprachlicher und schriftsprachlicher Einschränkungen
- 11.3.2. Maßnahmen bei vokalen Tics und sprachlichen Problemen
- 11.3.3. Schriftliche Leistungsüberprüfungen und Hausaufgaben
- 11.4. Vorschläge zum (förder)pädagogischen Umgang mit anderen Auffälligkeiten, die im Zusammenhang mit dem TS stehen
- 11.4.1. Anregungen zu Interventionen bei Aufmerksamkeitsstörungen
- 11.4.2. Anregungen zu Interventionen bei Zwangssymptomen
- 11.4.3. Anregungen zu Interventionen bei aggressivem Verhalten aufgrund gestörter Impulskontrolle
- 11.4.4. Einblicke in förderpädagogische Maßnahmen bei Lernstörungen und Leistungsschwächen, Sprechstörungen und Leseschwächen
- 11.5. Kritische Betrachtung der Maßnahmen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese wissenschaftliche Arbeit untersucht das Tourette-Syndrom (TS) aus sprachwissenschaftlicher und pädagogischer Perspektive. Ziel ist es, ein umfassendes Verständnis des TS und seiner Auswirkungen auf betroffene Kinder zu entwickeln, um daraus förderpädagogische Interventionen abzuleiten.
- Sprachliche Manifestationen des Tourette-Syndroms (vorkale und motorische Tics)
- Begleiterscheinungen des TS und deren Einfluss auf Lernen und Entwicklung
- Ätiologie des TS und aktuelle Forschungsansätze
- Diagnostik und Behandlung des TS
- Entwicklung förderpädagogischer Maßnahmen für Kinder mit TS im schulischen Kontext
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema Tourette-Syndrom ein und skizziert den Aufbau und die Zielsetzung der Arbeit. Sie verdeutlicht die Relevanz des Themas für die Sprachbehindertenpädagogik und die Notwendigkeit einer differenzierten Betrachtungsweise.
2. Historischer Blick auf das Tourette-Syndrom: Dieses Kapitel bietet einen Überblick über die historische Entwicklung des Verständnisses und der Behandlung des Tourette-Syndroms. Es zeigt die Wandlungen in der Wahrnehmung der Erkrankung von der Stigmatisierung bis hin zu einem differenzierten medizinisch-pädagogischen Ansatz auf.
3. Das Tourette-Syndrom – eine kurze Wesensbestimmung: Dieses Kapitel liefert eine prägnante Definition des Tourette-Syndroms, beschreibt die Kernsymptome – Tics – und differenziert zwischen einfachen und komplexen motorischen und vokalen Tics. Es legt den Grundstein für die detailliertere Betrachtung der Symptome in den folgenden Kapiteln.
4. Differenzierte Betrachtung der Symptome unter sprachlicher Akzenturierung: Dieses Kapitel analysiert detailliert die motorischen und vokalen Tics des Tourette-Syndroms, wobei der sprachliche Aspekt im Fokus steht. Es beleuchtet Phänomene wie Koprolalie, Echolalie und Palilalie und diskutiert deren Auswirkungen auf die sprachlichen Fähigkeiten der Betroffenen. Der Zusammenhang mit Stottern wird ebenfalls behandelt. Die Beschreibung der Tics umfasst sowohl einfache als auch komplexe Formen und deren Häufigkeiten.
5. Krankheitsverlauf: Dieses Kapitel beschreibt den typischen Verlauf des Tourette-Syndroms, von den ersten Symptomen im Kindesalter bis hin zum möglichen Verlauf im Erwachsenenalter. Es wird aufgezeigt, wie sich die Symptome im Laufe der Zeit verändern und welche Faktoren den Verlauf beeinflussen können.
6. Begleiterscheinungen des Tourette-Syndroms und ihre sprachliche Dimension: Dieses Kapitel widmet sich den häufigen Begleiterscheinungen des Tourette-Syndroms, wie Zwängen, Depressionen, Aggressivität, Aufmerksamkeitsstörungen und Lernstörungen. Der Schwerpunkt liegt auf der sprachlichen Dimension dieser Begleiterscheinungen und wie sie sich auf die Kommunikation und den Alltag der Betroffenen auswirken.
7. Ätiologie: Dieses Kapitel befasst sich mit den Ursachen des Tourette-Syndroms. Es beleuchtet genetische Dispositionen, organische Faktoren wie Auffälligkeiten in den Basalganglien und ein Ungleichgewicht der Neurotransmitter, sowie aktuelle Modellvorstellungen zur Entstehung von Tics.
8. Diagnostik unter förderpädagogischen und klinischen Gesichtspunkten: Dieses Kapitel beschreibt die diagnostischen Verfahren zur Erkennung des Tourette-Syndroms, sowohl aus klinischer als auch aus förderpädagogischer Sicht. Es erläutert die Wichtigkeit einer ganzheitlichen Diagnostik, die sowohl die medizinischen als auch die pädagogischen Aspekte berücksichtigt.
9. Behandlung des Tourette-Syndroms: Dieses Kapitel stellt verschiedene Behandlungsansätze für das Tourette-Syndrom vor, darunter medikamentöse Therapien und verhaltenstherapeutische Methoden wie das Habit-Reversal-Training. Es bewertet die Wirksamkeit der verschiedenen Ansätze und diskutiert deren Vor- und Nachteile.
10. Fallbeispiel: Dieses Kapitel präsentiert ein detailliertes Fallbeispiel eines Kindes mit Tourette-Syndrom. Es beschreibt das Vorgehen bei der Datenerhebung und -auswertung und illustriert die komplexen Zusammenhänge zwischen den Symptomen, den Begleiterscheinungen und den Auswirkungen auf den Alltag des Kindes.
11. Förderpädagogische Interventionen bei Kindern mit Tourette-Syndrom: Dieses Kapitel entwickelt konkrete Vorschläge für den förderpädagogischen Umgang mit Kindern, die am Tourette-Syndrom leiden. Es liefert Leitlinien für den Unterricht, Maßnahmen zur Bewältigung von vokalen Tics und sprachlichen Problemen, sowie Vorschläge zum Umgang mit Aufmerksamkeitsstörungen, Zwangssymptomen und aggressivem Verhalten. Es integriert die Erkenntnisse aus den vorherigen Kapiteln.
Schlüsselwörter
Tourette-Syndrom, Tics (motorisch, vokal), Koprolalie, Echolalie, Palilalie, Sprachentwicklung, Sprachbehinderung, Förderpädagogik, Begleiterscheinungen, Diagnostik, Behandlung, Verhaltenstherapie, Habit-Reversal-Training, Aufmerksamkeitsstörungen, Zwänge, Aggressivität, Lernstörungen, Ätiologie, Neurotransmitter, Basalganglien.
Häufig gestellte Fragen zum Tourette-Syndrom
Was ist der Inhalt dieses Dokuments?
Dieses Dokument bietet eine umfassende Übersicht zum Tourette-Syndrom (TS), betrachtet aus sprachwissenschaftlicher und pädagogischer Perspektive. Es beinhaltet ein Inhaltsverzeichnis, die Zielsetzung und Themenschwerpunkte, Zusammenfassungen der einzelnen Kapitel, sowie Schlüsselwörter. Der Fokus liegt auf den sprachlichen Manifestationen des TS, den Begleiterscheinungen, der Diagnostik, Behandlung und der Entwicklung förderpädagogischer Interventionen für betroffene Kinder im schulischen Kontext.
Welche Themen werden im Einzelnen behandelt?
Das Dokument behandelt folgende Themengebiete: Historischer Überblick zum TS, Definition und Wesensbestimmung des TS, detaillierte Analyse motorischer und vokaler Tics (inkl. Koprolalie, Echolalie, Palilalie und deren Auswirkungen auf die Sprache), Krankheitsverlauf, Begleiterscheinungen (Zwangsstörungen, Depressionen, Aggressivität, Lernstörungen etc.), Ätiologie (genetische Faktoren, organische Faktoren, Neurotransmitter), Diagnostik (klinisch und förderpädagogisch), Behandlung (medikamentös und verhaltenstherapeutisch), ein Fallbeispiel und schließlich ausführliche Vorschläge für förderpädagogische Interventionen im schulischen Kontext (Umgang mit Aufmerksamkeitsproblemen, sprachlichen Einschränkungen, vokalen Tics, Zwängen, aggressivem Verhalten und Lernstörungen).
Welche sprachlichen Aspekte des Tourette-Syndroms werden beleuchtet?
Der Schwerpunkt liegt auf der Analyse vokaler Tics, insbesondere Koprolalie (unwillkürliches Ausstoßen von Schimpfwörtern), Echolalie (Wiederholung von gehörten Worten oder Sätzen) und Palilalie (Wiederholung eigener Worte oder Sätze). Das Dokument untersucht auch den Einfluss von Tics auf die allgemeine Sprachentwicklung und Sprachfähigkeit betroffener Kinder, sowie den Zusammenhang zwischen Stottern und Tourette-Syndrom. Die syntaktischen Auffälligkeiten im Zusammenhang mit vokalen Tics werden ebenfalls betrachtet. Die sprachlichen Schwierigkeiten werden als Ansatzpunkt für sprachheilpädagogische Maßnahmen diskutiert.
Welche Begleiterscheinungen des Tourette-Syndroms werden diskutiert?
Neben den Tics werden häufige Begleiterscheinungen wie Zwänge (Zwangshandlungen und Zwangsgedanken), Depressionen, Aggressivität, selbstdestruktives Verhalten, Aufmerksamkeitsstörungen, Hyperkinetisches Syndrom, Lese-Rechtschreib-Schwäche und andere Lernstörungen sowie auch überdurchschnittliche Fähigkeiten in motorischen, sprachlichen und künstlerischen Bereichen behandelt. Der Einfluss dieser Begleiterscheinungen auf die Kommunikation und den Alltag der Betroffenen wird hervorgehoben.
Welche Behandlungsansätze werden vorgestellt?
Das Dokument beschreibt sowohl medikamentöse Behandlungsansätze als auch verhaltenstherapeutische Methoden, insbesondere das Habit-Reversal-Training (HRT). Die Wirksamkeit und die Vor- und Nachteile der verschiedenen Ansätze werden diskutiert.
Welche förderpädagogischen Interventionen werden vorgeschlagen?
Das Dokument bietet konkrete Vorschläge für den Umgang mit Kindern mit Tourette-Syndrom im schulischen Kontext. Es beinhaltet Leitlinien für den Unterricht, Maßnahmen zur Bewältigung von vokalen Tics und sprachlichen Problemen, sowie Anregungen zu Interventionen bei Aufmerksamkeitsstörungen, Zwangssymptomen, aggressivem Verhalten und Lernstörungen. Die Vorschläge berücksichtigen die verschiedenen Aspekte des TS und seiner Begleiterscheinungen.
Welche Zielsetzung verfolgt das Dokument?
Das Ziel ist es, ein umfassendes Verständnis des Tourette-Syndroms und seiner Auswirkungen auf betroffene Kinder zu entwickeln und daraus fundierte förderpädagogische Interventionen abzuleiten. Das Dokument soll dazu beitragen, die sprachlichen und pädagogischen Herausforderungen im Umgang mit Kindern mit TS zu verstehen und zu bewältigen.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt?
Schlüsselwörter sind: Tourette-Syndrom, Tics (motorisch, vokal), Koprolalie, Echolalie, Palilalie, Sprachentwicklung, Sprachbehinderung, Förderpädagogik, Begleiterscheinungen, Diagnostik, Behandlung, Verhaltenstherapie, Habit-Reversal-Training, Aufmerksamkeitsstörungen, Zwänge, Aggressivität, Lernstörungen, Ätiologie, Neurotransmitter, Basalganglien.
- Citar trabajo
- Susann Sulzbach (Autor), 2006, Das Tourette-Syndrom unter sprachwissenschaftlicher und pädagogischer Betrachtung, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/93691