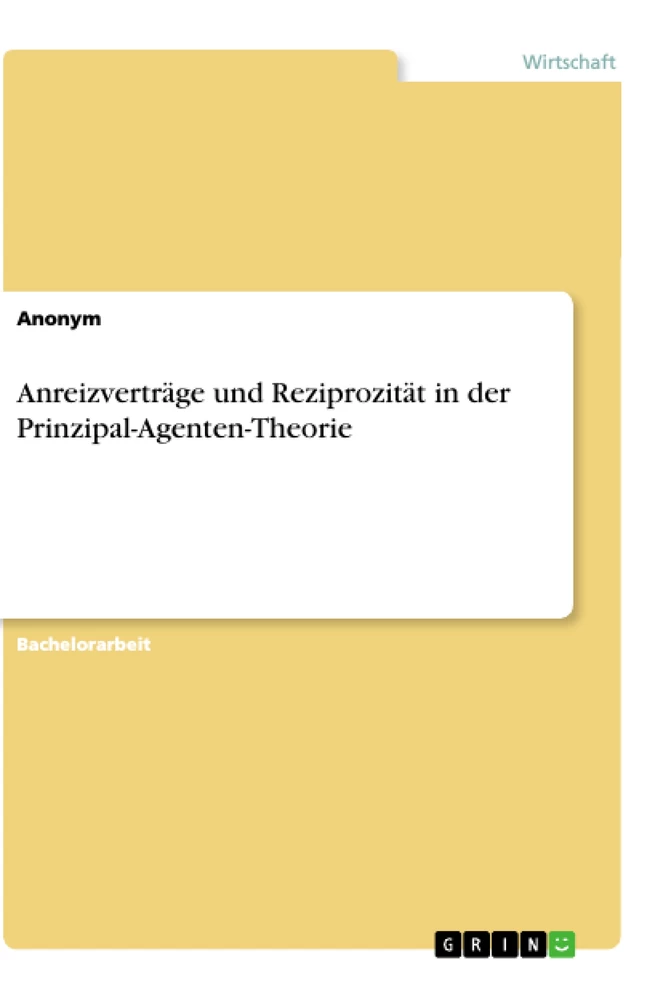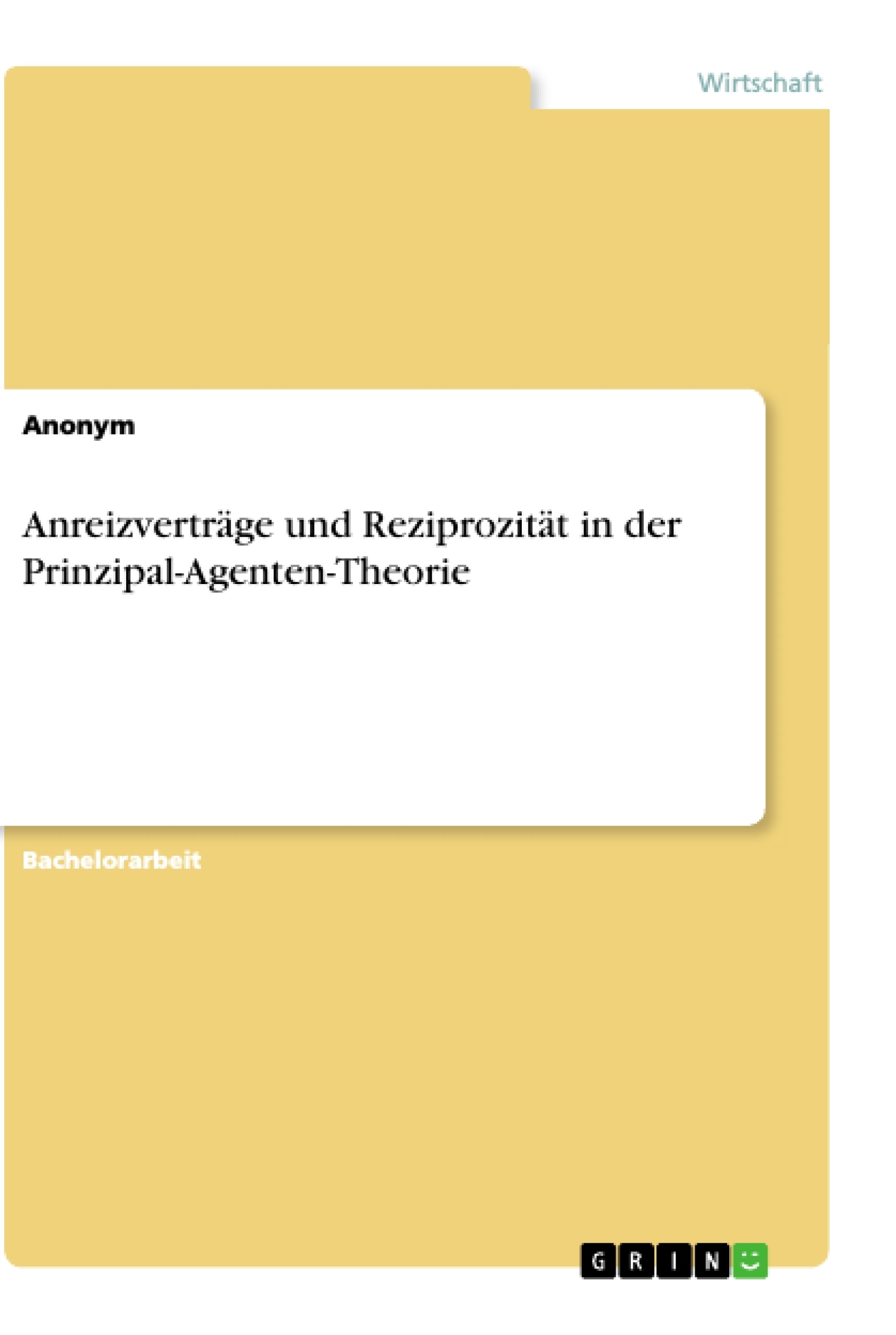Ziel dieser Arbeit ist es zu untersuchen, inwiefern durch die Modellierung sozialer Interaktionen zwischen zwei homogenen, risikoneutralen Agenten und einem risikoneutralen Prinzipal gerade dann Effizienz erreicht werden kann, wenn die Agenten nicht alleinigen Nutzen aus monetären Anreizen ziehen, sondern auch auf zwischenmenschliche Anreize reagieren. Dabei werden zwei verschiedene Ansätze näher betrachtet. Zunächst wird das Papier von Dur und Sol mit dem Titel „Social interaction, co-worker altruism, and incentives“ näher beleuchtet, das davon ausgeht, dass nur eine Mischung aus individuellen und Team-bzw. Turnieranreizen dafür sorgt, dass effiziente Grade der Anstrengung und Outputmengen durch die Agenten implementiert werden. Somit wäre soziale Interaktion notwendig, um First-best zu erreichen. Im Gegensatz zu Dur und Sol machen Kandel und Lazear in ihrem Papier „Peer pressure and partnerships“ deutlich, dass Teamarbeit nicht immer zu besseren zwischenmenschlichen Beziehungen und zu effizienteren Outputmengen führt, denn Teamarbeit ist anfällig für Free-Riding, das mit einem Effizienzverlust einhergeht. Um dem entgegenzuwirken, kann das Team Gruppendruck aufbauen und bei Verstößen Sanktionen gegen Leistungsverweigerer verhängen. Dieser Druckaufbau sorgt jedoch für ein wenig vertrauensvolles Miteinander und ein unangenehmes Arbeitsklima. Beide Modelle sind also – ohne explizit Reziprozität zu benennen – Beispiele für reziprokes Verhalten zwischen Agenten. Im weiteren Verlauf der Arbeit werden empirische Belege für beide Ansätze untersucht, um zu zeigen, dass positive soziale Interaktion wie bei Dur und Sol und negative soziale
Interaktion wie bei Kandel und Lazear parallel auftreten. Grundlage für die Analyse sind dabei besonders die Papiere von Dohmen et al. mit dem Titel „Homo reciprocans: Survey evidence on behavioral outcomes“ sowie von Franzen und Pointner mit dem Titel „Fairness und Reziprozität im Diktatorspiel“, die aufzeigen, dass Individuen beide Verhaltensweisen an den Tag legen, wobei Dohmen et al. zusätzlich darauf eingeht, welche Personengruppen eher zu dem einen oder dem anderen Verhalten neigen. Das Modell von Dur und Sol steht ebenso wie das Modell von Kandel und Lazear exemplarisch für eine breite wissenschaftliche Literatur, die es zum Thema Reziprozität in Arbeitnehmerbeziehungen gibt. So veröffentlichen Gui und Stanca einen Überblick über den aktuellen Forschungsstand.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Das Modell von Dur und Sol (2010)
- 2.1 Notation und Modellannahmen
- 2.2 First-best Vertrag
- 2.3 Second-best Vertrag
- 3 Das Modell von Kandel und Lazear (1992)
- 4 Empirie
- 5 Fazit
- A Mathematische Beweise
- A.1 Ergänzungen zu Gleichung (11)
- A.2 Ergänzungen zu Lemma 1: Gleichungen (12) und (13)
- A.3 Ergänzungen zu Gleichungen (14) und (15)
- A.4 Ergänzungen zu Gleichung (16)
- A.5 Ergänzungen zu Gleichung (17)
- A.6 Wiederholtes Gefangenendilemma und soziale Interaktion
- A.7 Bedingungen für ein einziges eindeutiges Gleichgewicht mit sozialer Interaktion
- A.8 Ergänzungen zu Gleichungen (21) und (22)
- A.9 Ergänzungen zu Gleichungen (26) ...
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht, wie Effizienz durch die Modellierung sozialer Interaktionen zwischen zwei homogenen, risikoneutralen Agenten und einem risikoneutralen Prinzipal erreicht werden kann, insbesondere wenn die Agenten nicht nur aus monetären Anreizen Nutzen ziehen, sondern auch auf zwischenmenschliche Anreize reagieren. Dabei werden zwei verschiedene Ansätze von Dur und Sol (2010) sowie Kandel und Lazear (1992) analysiert, die unterschiedliche Perspektiven auf die Rolle sozialer Interaktion und Reziprozität im Arbeitskontext bieten.
- Die Bedeutung von Reziprozität in der Ökonomie und Personalökonomik
- Effizienzsteigerung durch soziale Interaktion und Reziprozität
- Das Zusammenspiel von individuellen und Teamanreizen
- Die Rolle von Gruppendruck und Sanktionen in der Teamarbeit
- Empirische Belege für positive und negative soziale Interaktion
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel führt in die Thematik der Reziprozität und deren Bedeutung in der Ökonomie ein. Es wird der Begriff "Homo Reciprocans" eingeführt, der den reziprok handelnden Menschen beschreibt und im Gegensatz zum klassischen "Homo Oeconomicus" steht.
Kapitel zwei analysiert das Modell von Dur und Sol (2010), welches die Bedeutung von Teamanreizen und sozialer Interaktion für die Erreichung eines effizienten Grades der Anstrengung und Outputmenge betont. Kapitel drei hingegen untersucht das Modell von Kandel und Lazear (1992), welches die Problematik von Free-Riding in Teams und die Notwendigkeit von Gruppendruck und Sanktionen hervorhebt.
Schlüsselwörter
Reziprozität, Homo Reciprocans, Teamanreize, soziale Interaktion, Gruppendruck, Free-Riding, Effizienz, Anreizverträge, Personalökonomik.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2020, Anreizverträge und Reziprozität in der Prinzipal-Agenten-Theorie, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/936986