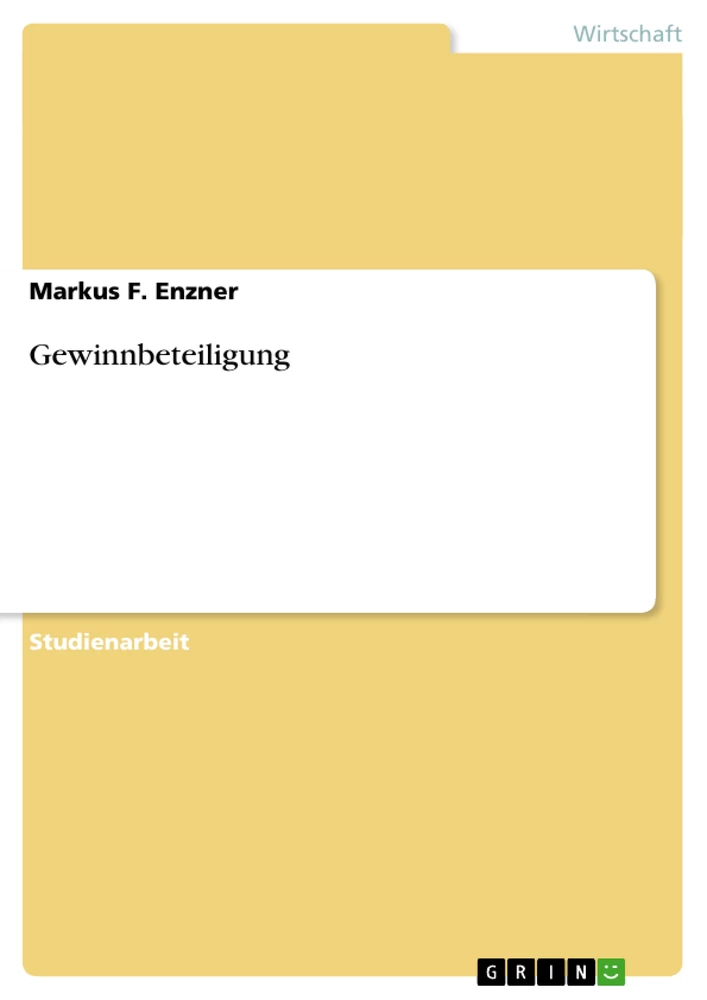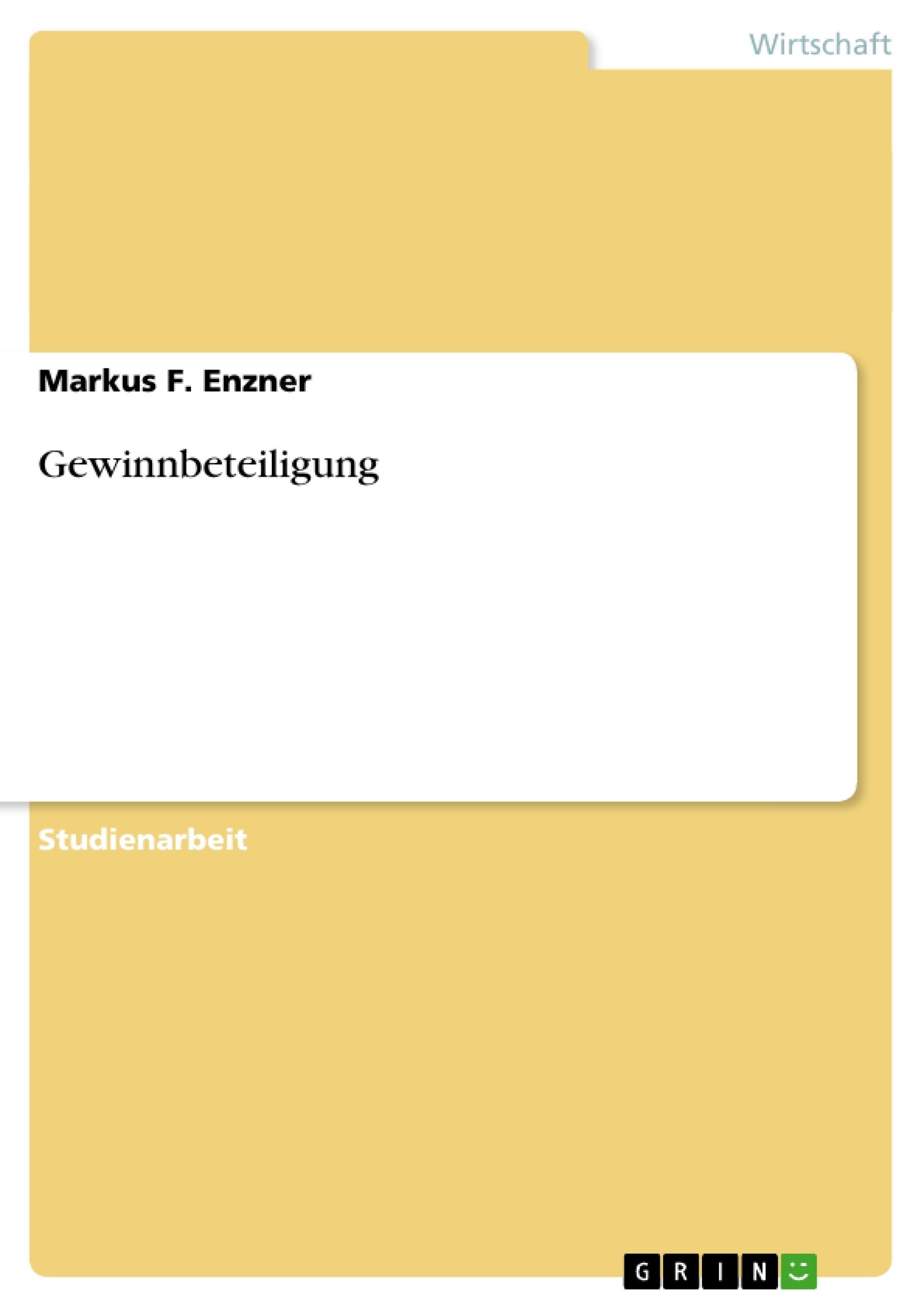Sowohl in Deutschland (v. Thünen 1850), als auch in den USA (Gilman 1891) existiert der
Gedanke Mitarbeiter am Erfolg eines Unternehmens zu beteiligen, seit weit über 100
Jahren.
Der deutsche Agrarwissenschaftler und Nationalökonom Johann Heinrich von Thünen war
der Meinung, dass die Arbeiter auf seinem Gut in Mecklenburg-Schwerin nicht nur den
Mindestlohn für ihre Arbeitskraft, sondern auch einen weiteren Anteil aus dem
produzierten Gut erhalten sollten. Dieses erste Gewinnbeteiligungsmodell beinhaltete, dass
jeder Gutsarbeiter ein halbes Prozent der jährlichen Überschüsse die einen festgelegten
Schwellenwert überschritten, erhielt. Der Erfolg gab von Thünen recht: Sein Gut war in
der Lage Überschüsse zu erwirtschaften und die jährlichen Gewinnanteile verbesserten die
soziale Lage der Angestellten deutlich. (Strotmann 2002, diverse Onlinequellen s. Anhang)
Der Grundgedanke, dass ein zufriedener Arbeiter in der Lage ist, mehr zu leisten spielt
auch heute noch eine große Rolle, was sich sowohl am großen (internationalen)
Forschungsinteresse, als auch an der Verbreitung von Gewinnbeteiligungsvereinbarungen
in den Unternehmen begründen lässt.
Aus Sicht der Unternehmung sind die positiven Aspekte der Gewinnbeteiligung („profit
sharing“, PS) ein höheres Anstrengungsniveau und eine dadurch induzierte, höhere
Produktivität der Mitarbeiter, eine höhere Identifikation der Belegschaft mit dem
Unternehmen, Kostenreduktionen aufgrund geringerer Fluktuation und verringerter
Fehlzeiten der Mitarbeiter. Des Weiteren versprechen sich Unternehmen sowohl
Rekrutierung, als auch längerfristige Bindung qualifizierter Arbeitnehmer an das
Unternehmen, sowie flexiblere Arbeitskosten da sich die Entlohnung der Mitarbeiter
stärker an die wirtschaftliche Lage des Unternehmens knüpfen lässt.
(Carstensen/Gerlach/Hübler, 1995)
Die positiven Effekte für die Arbeitnehmer aus einer Beteiligung am Erfolg eines
Unternehmens sind primär in einem höheren, leistungsabhängigen Einkommen zu sehen.
Jedoch spielt auch der psychologische Faktor eine Rolle, nach der erbrachten individuellen
oder kollektiven Leistung entlohnt zu werden und so „die Früchte seiner Arbeit“ direkt und
zeitnah zu ernten.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einführung
- 2. Verbreitung und gesetzliche Rahmenbedingungen
- 2.1. Verbreitung von Gewinnbeteiligungsmodellen in der EU und den USA
- 2.2. Gesetzliche Rahmenbedingungen und Auswirkungen auf die Entwicklung
- 3. Überblick über die wichtigsten theoretischen Überlegungen
- 3.1. Produktivität
- 3.2. Unternehmensgröße
- 3.3. Gewerkschaften und Arbeitnehmervertretung
- 3.4. Regionen
- 3.5. Immaterielle Mitarbeiterbeteiligung („nonpecuniary participation“)
- 4. Empirische Überprüfung
- 4.1. Produktivität
- 4.2. Immaterielle Mitarbeiterbeteiligung („nonpecuniary participation“)
- 4.3. Beschäftigung
- 5. Zusammenfassung und Schlussfolgerung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit bietet einen selektiven Überblick über das Thema „Gewinnbeteiligung“ und fokussiert sich auf die Erkenntnisse für Unternehmen und Arbeitnehmer. Sie untersucht die Verbreitung und Entwicklung von Gewinnbeteiligungsmodellen, beleuchtet die gesetzlichen Rahmenbedingungen und analysiert theoretische Überlegungen sowie empirische Ergebnisse.
- Verbreitung von Gewinnbeteiligungsmodellen in der EU und den USA
- Theoretische Überlegungen zur Gewinnbeteiligung (Produktivität, Unternehmensgröße, Arbeitnehmervertretung etc.)
- Empirische Ergebnisse zu den Auswirkungen von Gewinnbeteiligungsmodellen auf Produktivität und Beschäftigung
- Auswirkungen von materieller und immaterieller Gewinnbeteiligung
- Das Problem der „reverse causality“ im Zusammenhang mit Gewinnbeteiligung
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einführung: Die Einleitung stellt den historischen Kontext der Gewinnbeteiligung vor, beginnend mit den Ideen von Thünen und Gilman. Sie hebt die anhaltende Bedeutung eines zufriedenen und produktiven Arbeiters hervor und skizziert die positiven Aspekte der Gewinnbeteiligung sowohl für Unternehmen (höhere Produktivität, geringere Fluktuation) als auch für Arbeitnehmer (höheres Einkommen, psychologische Faktoren). Der Fokus der Arbeit wird auf die Erkenntnisse für Unternehmen und Arbeitnehmer gelegt. Die Struktur der Arbeit wird kurz erläutert.
2. Verbreitung und gesetzliche Rahmenbedingungen: Dieses Kapitel analysiert die Verbreitung von Gewinnbeteiligungsmodellen in der EU und den USA anhand von Daten der EPOC-Studie und des CRANET-Surveys. Es werden die Unterschiede in der Verbreitung zwischen den Ländern aufgezeigt, wobei Deutschland im Mittelfeld liegt. Die gesetzlichen Rahmenbedingungen und deren Einfluss auf die unterschiedlichen internationalen Ausprägungen von Gewinnbeteiligungssystemen werden beleuchtet. Der Vergleich der Studien zeigt unterschiedliche Ergebnisse hinsichtlich der Verbreitung, was auf methodische Unterschiede zurückzuführen sein kann. Die Bedeutung der gesetzlichen Rahmenbedingungen für die Entwicklung von Gewinnbeteiligungsmodellen wird hervorgehoben.
Schlüsselwörter
Gewinnbeteiligung, Profit Sharing, Produktivität, Beschäftigung, Arbeitnehmerbeteiligung, EU, USA, gesetzliche Rahmenbedingungen, theoretische Überlegungen, empirische Ergebnisse, reverse causality, immaterielle Mitarbeiterbeteiligung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Gewinnbeteiligung - Überblick und Analyse
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit bietet einen umfassenden Überblick über das Thema Gewinnbeteiligung, fokussiert auf die Erkenntnisse für Unternehmen und Arbeitnehmer. Sie untersucht die Verbreitung und Entwicklung von Gewinnbeteiligungsmodellen, die gesetzlichen Rahmenbedingungen und analysiert sowohl theoretische Überlegungen als auch empirische Ergebnisse.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themen: Verbreitung von Gewinnbeteiligungsmodellen in der EU und den USA, theoretische Überlegungen zur Gewinnbeteiligung (Einflussfaktoren wie Produktivität, Unternehmensgröße, Arbeitnehmervertretung etc.), empirische Ergebnisse zu den Auswirkungen auf Produktivität und Beschäftigung, Auswirkungen von materieller und immaterieller Gewinnbeteiligung und das Problem der „reverse causality“ im Zusammenhang mit Gewinnbeteiligung.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit ist in fünf Kapitel gegliedert: 1. Einführung, 2. Verbreitung und gesetzliche Rahmenbedingungen, 3. Überblick über die wichtigsten theoretischen Überlegungen, 4. Empirische Überprüfung und 5. Zusammenfassung und Schlussfolgerung. Jedes Kapitel behandelt spezifische Aspekte des Themas Gewinnbeteiligung.
Welche Quellen werden verwendet?
Die Arbeit bezieht sich auf Daten der EPOC-Studie und des CRANET-Surveys zur Analyse der Verbreitung von Gewinnbeteiligungsmodellen in der EU und den USA. Theoretische Überlegungen und empirische Ergebnisse werden ebenfalls berücksichtigt, wobei die konkreten Quellen im Haupttext der Arbeit detailliert aufgeführt sind.
Welche Schlussfolgerungen werden gezogen?
Die Arbeit fasst die Ergebnisse der Analyse der Verbreitung, der gesetzlichen Rahmenbedingungen, der theoretischen Überlegungen und der empirischen Ergebnisse zusammen. Konkrete Schlussfolgerungen und ihre Implikationen für Unternehmen und Arbeitnehmer werden im Kapitel „Zusammenfassung und Schlussfolgerung“ dargelegt. Die Arbeit hebt die Bedeutung der gesetzlichen Rahmenbedingungen und der methodischen Unterschiede in den verwendeten Studien hervor.
Welche Schlüsselwörter sind relevant?
Die wichtigsten Schlüsselwörter sind: Gewinnbeteiligung, Profit Sharing, Produktivität, Beschäftigung, Arbeitnehmerbeteiligung, EU, USA, gesetzliche Rahmenbedingungen, theoretische Überlegungen, empirische Ergebnisse, reverse causality, immaterielle Mitarbeiterbeteiligung.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit beginnt mit einer Einführung, die den historischen Kontext und die Bedeutung des Themas darstellt. Die folgenden Kapitel behandeln nacheinander die Verbreitung und gesetzlichen Rahmenbedingungen, theoretische Überlegungen, empirische Ergebnisse und schließen mit einer Zusammenfassung und Schlussfolgerung. Der Fokus liegt auf den Erkenntnissen für Unternehmen und Arbeitnehmer.
Was ist die Zielsetzung der Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, einen selektiven Überblick über das Thema Gewinnbeteiligung zu bieten und die Erkenntnisse für Unternehmen und Arbeitnehmer zu fokussieren. Sie soll ein besseres Verständnis der Verbreitung, der theoretischen Grundlagen und der empirischen Auswirkungen von Gewinnbeteiligungsmodellen ermöglichen.
- Quote paper
- Diplom Volkswirt Markus F. Enzner (Author), 2007, Gewinnbeteiligung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/93704