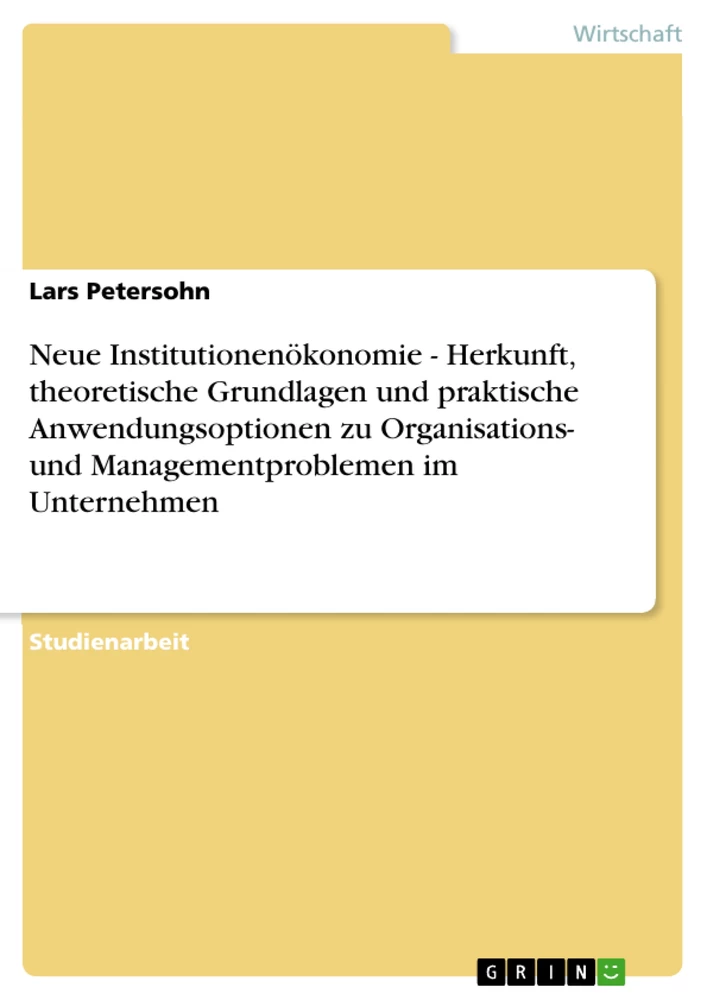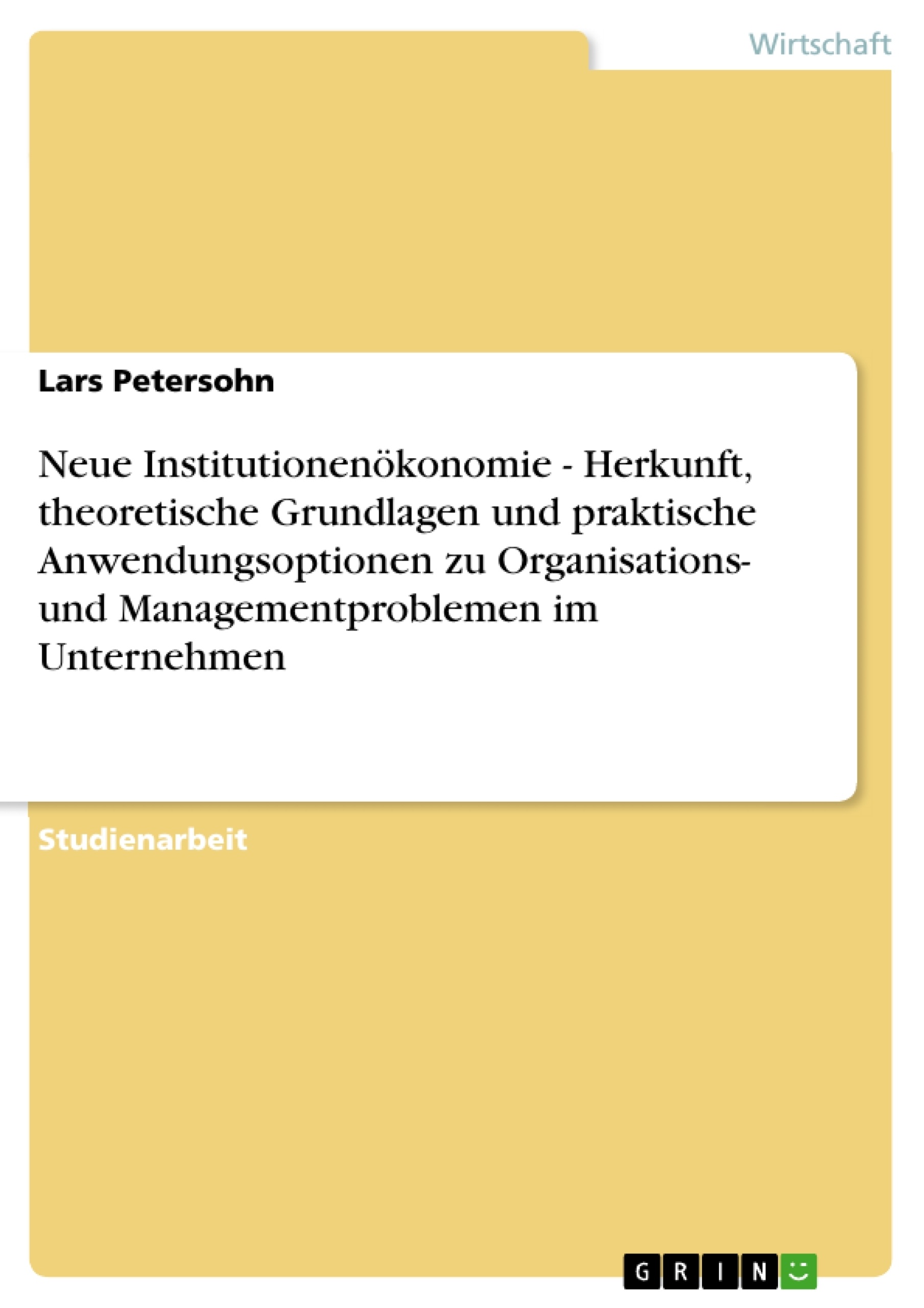Seit den 90er Jahren ist im Bereich sozialwirtschaftlicher Unternehmen eine Kursveränderung spürbar. Den Anfang bildeten die Veränderungen der gesetzlichen Rahmenbedingungen durch die Überarbeitung und Neuauflage des Sozialgesetzes und Einführung der Pflegeversicherung. Ein weiterer ausschlaggebender Punkt sind die immer knapper werdenden öffentlichen Finanzmittel. Das Subsidiaritätsprinzip, fehlende Wirtschaftlichkeit, zu wenig Service, fehlende Kundenorientierung und starre Strukturen sind nur einige Kritik-punkte, welche die Forderung nach Reformen und grundlegender Neuerung des sozial-wirtschaftlichen Sektors laut werden lies und lässt.
Das Theoriegerüst der Neuen Institutionenökonomie bildet eine Grundlage für den Wandel bzw. die Notwendigkeit zur Veränderung intermediärer Organisationen. Doch unter der Besonderheit, dass es sich um soziale Dienstleistungen handelt, stellt sich die Umsetzung als ganzheitliche Herausforderung dar. Der Ansatz liegt in der Übertragbarkeit betriebswirtschaftlicher Instrumente auf sozialwirtschaftliche Unternehmen. Transaktionskosten, Agency Beziehungen und Proberty rights bilden dabei die Grundpfeiler. Doch fehlende eindeutige Kennzahlen bei sozialwirtschaftlichen Unternehmen, wie Gewinn und Umsatz, lassen vieles im Unklaren. Dazu kommt die Problematik des Managements sozial-wirtschaftlicher Unternehmen. Nährlich dazu: „Ein genuines Nonprofit-Management, das die Strukturbesonderheiten von Nonprofit-Organisationen berücksichtigt, existiert in Deutschland jedoch nicht“ .
Die vorliegende Arbeit gibt einen Überblick über die Entstehung und Definition von Institutionen. Die Neue Institutionenökonomie wird erläutert und ihre Grundpfeiler definiert. Zudem ist zu klären, welchen Arten von sozialwirtschaftlichen Unternehmen es gibt und welche Besonderheiten deren sozialen Dienstleistungen aufweisen. Am Beispiel der Wohlfahrtsverbände wird der Reformkurs sozialwirtschaftlicher Unternehmen nachgewiesen und die Verbandssteuerung als Managementaufgabe aus Transaktionskostensicht beschrieben.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Definition
- Institution
- Weitere arbeitsrelevante Begriffe
- Entstehung von Institutionen
- Kollektivistische Ansätze
- Marxistischer Ansatz
- Strukturell funktionalistischer Ansatz
- Autopoietisch-systemtheoretischer Ansatz
- Kollektivistische Ansätze
- Individualistische Ansätze
- Individualistisch-kontrakttheoretischer Ansatz
- Individualistisch-evolutionistischer Ansatz
- Neue Institutionenökonomie
- Transaktionskostensansatz
- Principial-Agent-Theorie
- Proberty rights
- Sozialwirtschaftliche Unternehmen
- Abgrenzung sozialwirtschaftlicher Unternehmen
- Typologisierung
- Sozialwirtschaftliche Unternehmen auf Reformkurs
- Reformbewegung am Beispiel der Wohlfahrtsverbände
- Verbandssteuerung zwischen Konkurrenz und Kooperation am Beispiel Landesverband Nordrhein des Deutschen Roten Kreuz
- Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Neuen Institutionenökonomie und ihrer Bedeutung für die Veränderung sozialwirtschaftlicher Unternehmen. Die Arbeit untersucht die Entstehung und Definition von Institutionen sowie die Grundpfeiler der Neuen Institutionenökonomie, wie den Transaktionskostensansatz, die Principal-Agent-Theorie und Property Rights. Dabei wird besonderer Fokus auf die Herausforderungen und Chancen der Anwendung betriebswirtschaftlicher Instrumente im sozialen Bereich gelegt.
- Entstehung und Definition von Institutionen
- Grundpfeiler der Neuen Institutionenökonomie
- Anwendung betriebswirtschaftlicher Instrumente im Sozialbereich
- Reformbewegung in der Sozialwirtschaft
- Management sozialwirtschaftlicher Unternehmen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die die aktuelle Entwicklung in der Sozialwirtschaft beschreibt und die Relevanz der Neuen Institutionenökonomie für diesen Bereich herausstellt. Im zweiten Kapitel wird der Begriff „Institution“ definiert und verschiedene Ansätze zur Entstehung von Institutionen vorgestellt. Die Arbeit beleuchtet sowohl kollektivistische als auch individualistische Ansätze, die unterschiedliche Perspektiven auf die Entstehung von Institutionen aufzeigen.
Kapitel 3 beschäftigt sich mit der Neuen Institutionenökonomie und ihren zentralen Elementen: dem Transaktionskostensansatz, der Principal-Agent-Theorie und Property Rights. Die Arbeit erläutert die einzelnen Konzepte und verdeutlicht ihre Bedeutung für das Verständnis von Organisations- und Managementproblemen in der Sozialwirtschaft. Das vierte Kapitel analysiert sozialwirtschaftliche Unternehmen, ihre Abgrenzung und Typologisierung. Die Arbeit beleuchtet die spezifischen Herausforderungen, die sich aus der Kombination von sozialen Zielen und ökonomischen Zwängen ergeben.
Das fünfte Kapitel zeigt am Beispiel der Wohlfahrtsverbände die Reformbewegung in der Sozialwirtschaft auf und untersucht die Verbandssteuerung aus Transaktionskostensicht. Die Arbeit beleuchtet die Spannungsfelder zwischen Konkurrenz und Kooperation innerhalb des Verbandssystems und analysiert die Herausforderungen für die Leitung von sozialwirtschaftlichen Organisationen im Kontext der Reformbemühungen.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den Schlüsselbegriffen Institution, Neue Institutionenökonomie, Transaktionskosten, Principal-Agent-Theorie, Property Rights, Sozialwirtschaft, Wohlfahrtsverbände und Verbandssteuerung. Sie beleuchtet die Anwendung ökonomischer Theorien und Instrumente im Kontext der Reformbemühungen in der Sozialwirtschaft und analysiert die Herausforderungen für das Management sozialwirtschaftlicher Unternehmen.
- Citar trabajo
- Lars Petersohn (Autor), 2005, Neue Institutionenökonomie - Herkunft, theoretische Grundlagen und praktische Anwendungsoptionen zu Organisations- und Managementproblemen im Unternehmen , Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/93741