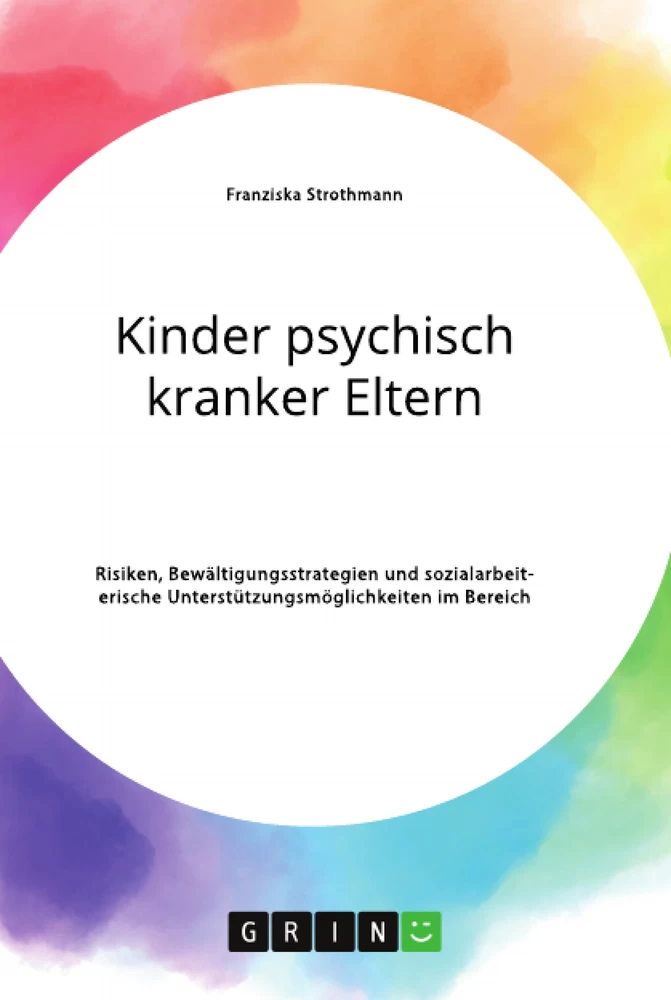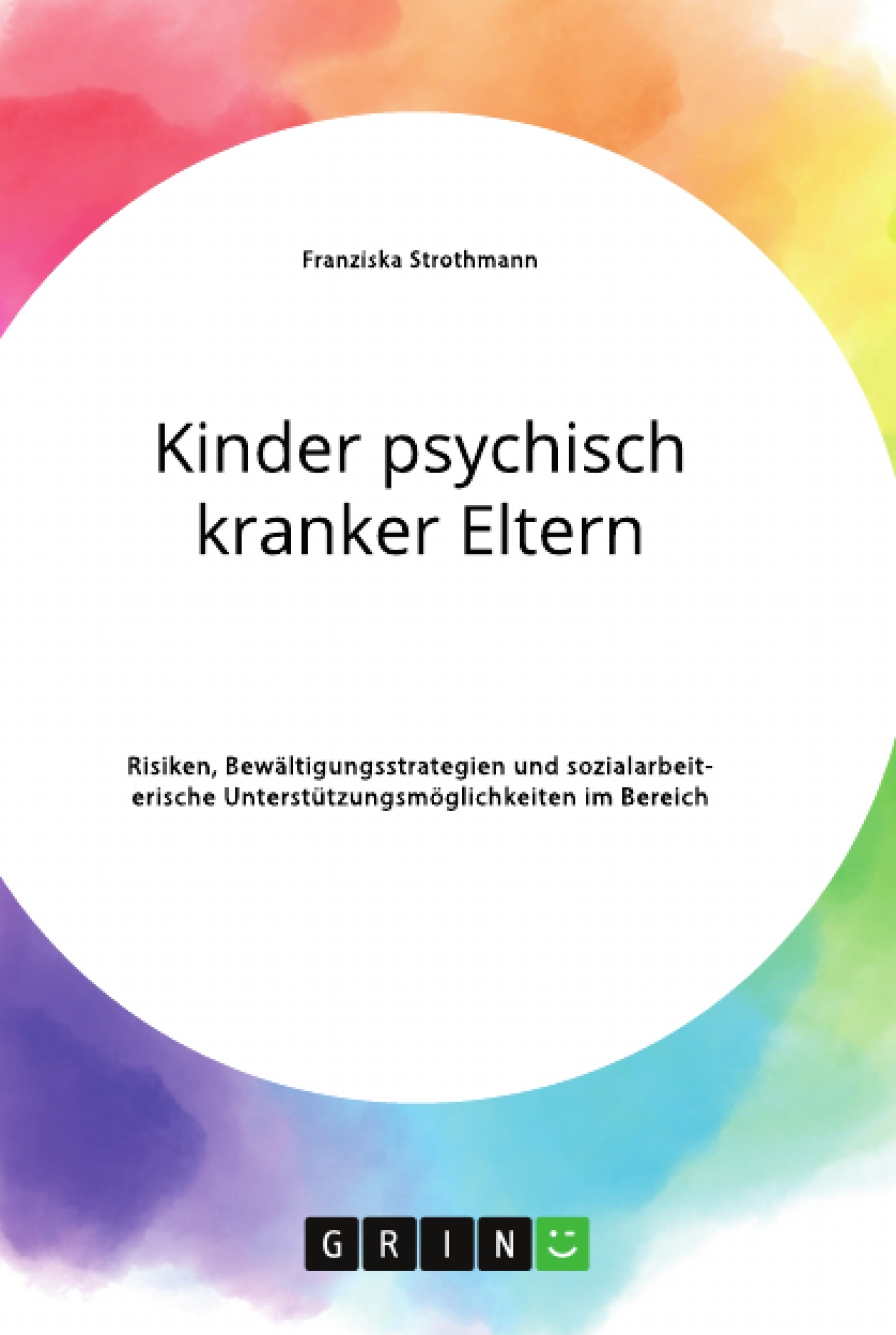Welche Rolle spielt die Soziale Arbeit innerhalb der Psychiatrie bei der Intervention und Prävention zur Stärkung von Kindern in Familien mit mindestens einem psychisch kranken Elternteil? Durch qualitative, leitfadengestützte Experteninterviews soll zudem ein Bezug zu Praxiserfahrungen innerhalb dieser Thematik und der damit verbundenen Forschungsfrage hergestellt werden.
Die Bachelorarbeit ist in einen theoretischen und einen empirischen Teil untergliedert. Der theoretische Teil basiert auf Literaturrecherche und führt nach der Einleitung durch verschiedene theoretische Grundlagen über psychische Störungen und die dazugehörige Epidemiologie und Prävalenz in die Thematik ein. Dabei konzentriert sich diese Arbeit nicht auf eine spezifische psychische Störung, sondern deckt bewusst die häufigsten psychischen Störungen ab, um eine möglichst allgemeine und lebensnahe Betrachtung der Thematik Kinder psychisch kranker Eltern zu ermöglichen.
Darauffolgend befasst sich die Arbeit mit den unterschiedlichen Faktoren, die das Risiko erhöhen können, dass Kinder selbst an einer psychischen Störung erkranken und welchen Einfluss eine elterliche psychische Störung auf die kindliche Entwicklung haben kann. Sowohl das subjektive Erleben von Kindern psychisch kranker Eltern, sowie deren Wissen über die Erkrankung und die Auswirkungen auf deren Gefühlswelt und den Alltag werden beleuchtet, als auch das Erleben der Eltern über ihre eigene psychische Störung und dessen Auswirkung auf das Familienleben.
Ein weiterer Teil widmet sich den unterschiedlichen Schutzfaktoren, welche die Widerstandsfähigkeit und die passenden Bewältigungsstrategien der Kinder fördern können. Anschließend werden unterschiedliche präventive und intervenierende Unterstützungsmöglichkeiten der Sozialen Arbeit in der Psychiatrie dargestellt. Hierzu werden verschiedene Aufgaben und Methoden der Sozialen Arbeit explizit aufgezeigt. Diese umfassen die Mutter- Kind-Behandlung, soziale Einzelfallhilfe, Familienberatung und -therapie, Psychoedukation und Krisenintervention.
Im zweiten Teil der vorliegenden Arbeit werden die theoretisch erarbeiteten Kenntnisse durch eine empirische Untersuchung in die Praxis umgesetzt. Diese Untersuchung besteht aus zwei qualitativen Experteninterviews, deren genaue Durchführung und Ergebnisse erläutert und diskutiert werden. Die vorliegende Arbeit wird anschließend durch eine zusammenfassende Stellungnahme und einen Ausblick abgerundet.
Inhaltsverzeichnis
- Abkürzungsverzeichnis
- Abbildungsverzeichnis
- I Theoretischer Teil
- 1. Einleitung
- 1.1 Anlass
- 1.3 Relevanz der Thematik für die Soziale Arbeit
- 2. Einführung in die psychischen Störungen
- 2.1 Definition psychische Störungen
- 2.2 Psychische Störungen nach ICD-10
- 2.3 Epidemiologie und Prävalenz
- 2.3.1 Prävalenz psychisch kranker Eltern
- 2.3.2 Prävalenz psychisch kranker Kinder
- 3. Erkrankungsrisiko der Kinder bei psychisch kranken Eltern
- 3.1 Genetische Faktoren
- 3.2 Psychosoziale Faktoren
- 3.2.1 Erziehungskompetenz
- 3.2.2 Eltern-Kind-Beziehung
- 3.2.3 Partnerschaftliche Beziehung der Eltern
- 3.2.4 Familienbeziehungen
- 3.2.5 Individuelle kindbezogene Faktoren
- 3.3 Einfluss auf die kindliche Entwicklung
- 3.4 Psychische Störungen und Kindeswohl
- 4. Subjektives Erleben der psychischen Störung
- 4.1 Subjektives Erleben der Kinder
- 4.1.1 Wissen über die psychische Störung der Eltern
- 4.1.2 Tabuisierung und Isolierung
- 4.1.3 Parentifizierung
- 4.2 Subjektives Erleben der Eltern
- 4.1 Subjektives Erleben der Kinder
- 5. Bewältigungsstrategien der Kinder
- 5.1 Resilienz
- 5.1.1 Personale Schutzfaktoren
- 5.1.2 Familiäre Schutzfaktoren
- 5.1.3 Soziale Schutzfaktoren
- 5.1.4 Spezifische Schutzfaktoren Kinder psychisch kranker Eltern
- 5.2 Coping
- 5.2.1 Klassische Copingstrategien
- 5.2.2 Familiäres Coping
- 5.1 Resilienz
- 6. Unterstützungsmöglichkeiten für Kinder psychisch kranker Eltern durch die Soziale Arbeit innerhalb der Psychiatrie
- 6.1 Intervention und Prävention
- 6.2 Die Rolle der Sozialen Arbeit in der Psychiatrie
- 6.3 Spezifische Präventions- und Interventionsangebote für Kinder psychisch kranker Eltern
- 6.3.1 Mutter-Kind-Behandlung
- 6.3.2 Soziale Einzelfallhilfe
- 6.3.3 Gruppenangebote
- 6.3.4 Familienberatung und -therapie
- 6.3.5 Psychoedukation
- 6.3.6 Krisenintervention
- 6.4 Kooperation zwischen Psychiatrie und Jugendhilfe
- 7. Zusammenfassung des theoretischen Teils
- 1. Einleitung
- II Empirischer Teil
- 8. Methode
- 8.1 Zielsetzung der empirischen Untersuchung
- 8.2 Methodische Vorgehensweise
- 8.4 Interviewsetting und -durchführung
- 9. Darstellung der Interviewergebnisse
- 9.1 Persönliche Haltung zur Thematik
- 9.2 Versorgungsangebot
- 9.3 Vernetzung verschiedener Institutionen
- 9.4 Meinung und Erfahrung bezüglich der Rolle der Sozialen Arbeit
- 10. Zusammenfassung der wesentlichen Ergebnisse
- 11. Kritische Betrachtung der Methode
- 8. Methode
- 12. Fazit
- Literaturverzeichnis
- Anhang
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Bachelorarbeit befasst sich mit der Thematik der Kinder psychisch kranker Eltern und analysiert die damit verbundenen Risiken, Bewältigungsstrategien und Unterstützungsmöglichkeiten aus sozialarbeiterischer Sicht im Bereich der Psychiatrie. Ziel der Arbeit ist es, ein tieferes Verständnis für die komplexen Herausforderungen dieser Zielgruppe zu gewinnen und die Rolle der Sozialen Arbeit in der Prävention und Intervention zu beleuchten.
- Erkrankungsrisiko von Kindern psychisch kranker Eltern: Die Arbeit untersucht die genetischen und psychosozialen Faktoren, die das Risiko für die Entwicklung psychischer Störungen bei Kindern erhöhen.
- Subjektives Erleben der psychischen Störung: Die Arbeit beleuchtet die subjektiven Erfahrungen von Kindern und Eltern mit der Erkrankung und den damit verbundenen Herausforderungen.
- Bewältigungsstrategien von Kindern: Die Arbeit analysiert die Resilienzfaktoren und Copingmechanismen, die Kindern helfen, mit den Belastungen umzugehen.
- Unterstützungsmöglichkeiten durch die Soziale Arbeit: Die Arbeit stellt die Rolle der Sozialen Arbeit in der Psychiatrie vor und beschreibt spezifische Präventions- und Interventionsangebote für Kinder psychisch kranker Eltern.
- Kooperation zwischen Psychiatrie und Jugendhilfe: Die Arbeit untersucht die Bedeutung der Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Institutionen, um Kindern und Familien die bestmögliche Unterstützung zukommen zu lassen.
Zusammenfassung der Kapitel
Im ersten Teil der Arbeit wird zunächst die Thematik der psychischen Störungen in ihrer Definition und epidemiologischen Bedeutung dargestellt. Anschließend werden die genetischen und psychosozialen Faktoren beleuchtet, die das Erkrankungsrisiko von Kindern bei psychisch kranken Eltern erhöhen. Des Weiteren wird das subjektive Erleben der psychischen Störung aus Sicht der Kinder und Eltern betrachtet, wobei der Fokus auf Themen wie Tabuisierung, Isolierung und Parentifizierung liegt.
Der zweite Teil der Arbeit befasst sich mit den Bewältigungsstrategien von Kindern, die mit den Belastungen durch die psychische Erkrankung der Eltern umgehen müssen. Hier werden die Konzepte der Resilienz und des Copings sowie die Bedeutung familiärer und sozialer Schutzfaktoren analysiert.
Im dritten Teil wird die Rolle der Sozialen Arbeit innerhalb der Psychiatrie näher betrachtet. Die Arbeit beleuchtet die spezifischen Präventions- und Interventionsangebote für Kinder psychisch kranker Eltern, wie z.B. Mutter-Kind-Behandlungen, soziale Einzelfallhilfe, Gruppenangebote, Familienberatung und -therapie sowie Psychoedukation. Darüber hinaus wird die Bedeutung der Kooperation zwischen Psychiatrie und Jugendhilfe hervorgehoben.
Schlüsselwörter
Kinder psychisch kranker Eltern, psychische Störungen, Prävalenz, Erkrankungsrisiko, Resilienz, Coping, Soziale Arbeit, Psychiatrie, Prävention, Intervention, Mutter-Kind-Behandlung, Familienberatung, Kooperation, Jugendhilfe
- Quote paper
- Franziska Strothmann (Author), 2020, Kinder psychisch kranker Eltern. Risiken, Bewältigungsstrategien und sozialarbeiterische Unterstützungsmöglichkeiten im Bereich der Psychiatrie, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/937446